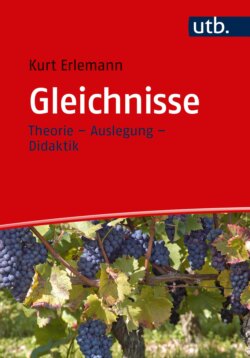Читать книгу Gleichnisse - Kurt Erlemann - Страница 72
2.2.4 Kritik an der ‚metaphorischen Wende‘
ОглавлениеDie Gleichnisforschung seit den 1970er Jahren findet weiterhin in Auseinandersetzung mit Jülichers Ansatz und zusätzlich mit dem Konzept der ‚metaphorischen Wende‘ statt. Gegen Letztere wurden folgende drei Punkte kritisch eingebracht1:
Erstens, eine Gleichsetzung der Metapher als Satzphänomen der Lyrik und des Gleichnisses als narratio sei nicht zulässig:
Wird das Metaphernphänomen der Lyrik auf Gleichnisse übertragen, muss dies fast notwendig zu Verkürzungen im Gleichnisverständnis führen, da hier gleich zwei Grenzen überspielt werden: die Grenze vom Satz zur Erzählung und diejenige von der Gattung Gedicht zur Gattung Gleichnis.2
Ein wichtiger Unterschied zwischen Metapher und Gleichnis bestehe darin, dass die Metapher lediglich Analogien, ein Gleichnis aber auch Differenzen zwischen zwei Wirklichkeitsbereichen sichtbar machen könne.3 Diese Beobachtungen sprechen gegen die Definition des Gleichnisses als einer ‚erweiterten Metapher‘. Ein Gleichnis sei vielmehr eine fiktionale Erzählung, die einzelne Merkmale mit der Metapher gemeinsam hat (Konterdetermination, bleibender Sinnüberschuss, mehrere mögliche Vergleichspunkte und Deutungsbedarf).
Zweitens, das Gesagte gilt auch für die Rede von der po(i)etischen Sprachkraft der Metapher: Die Ansicht, Metapher und Gleichnis hätten eine besondere Sprachkraft und ein Gleichnis sei ein performatives Sprachereignis, wird als unangemessen und apologetisch gewertet.
It would be difficult to document cases of people who in reading a parable or having it read to them experienced in that moment their lives being ‚torn apart‘.4
Die Sprachkraft von Metapher und Gleichnis beschränke sich auf ihre Fähigkeit, bereits vorhandene Analogien sichtbar zu machen.5 Von einem ‚Sprachverlust‘ bei der Verschriftlichung der Gleichnisse zu sprechen (Harnisch 1985), sei daher unsachgemäß, auch weil die Annahme eines kontextfreien, mündlich vorgetragenen Gleichnisses eine Fiktion ist – im Gegenteil: Auch für die Gleichnisse im Munde Jesu seien Kontextmarker ([Vor-]Wissen der Hörerschaft um Jesu Vollmacht, Jesu Taten als situativer Kontext der Gleichnisse u. a.) vorauszusetzen, die das Verstehen der Gleichnisrede vorprägen. Die Gleichnisse seien von Jesus nicht in einem luftleeren Raum, sondern im Kontext seines sonstigen Wirkens gesprochen worden. Absolute Unvoreingenommenheit der Hörerschaft als Voraussetzung dafür, dass das mündlich vorgetragene Gleichnis eine performativ-po(i)etische Wirkung entfalten könne, sei Fiktion.6 Diese Erkenntnis führt in der Folge zur Fokussierung auf die schriftliche Endgestalt der Texte und ihres Kontextes.7
Drittens, die Fokussierung der Metapherntheorie auf poetische Anteile wird als Engführung eingestuft, vergleichbar der rhetorisch-argumentativen Engführung bei Jülicher. Schon Quintilian ordne Metaphern und Gleichnisse dem rhetorischen und dem poetischen Bereich zu.8 Metaphern eigneten sich demnach sowohl zur sachlichen Beschreibung von Sachverhalten als auch zur emotionalen Steuerung der Hörerschaft. Gemeinsam mit der Beobachtung des grundsätzlichen Kontextbezugs ergebe sich daraus methodisch die Aufgabe, Metaphern und Gleichnisse aus ihrem Kontext heraus zu deuten. Die Sprachformen ließen sich durch Interpretation zwar nicht substituieren, aber im Sinne der Autorintention interpretieren. Wesentlich für den Interpretationsrahmen seien der literarische Kontext und der Verstehenskontext der Erstadressaten; deren theologische und zeitgeschichtliche Assoziationen beim Hören von Metaphern und Gleichnissen seien zu rekonstruieren. – Die Rückbesinnung auf die argumentativ-rhetorische Funktion von Gleichnis und Metapher führt im weiteren Verlauf zu einer verstärkt redaktionskritischen bzw. kommunikationstheoretischen Betrachtungsweise.9