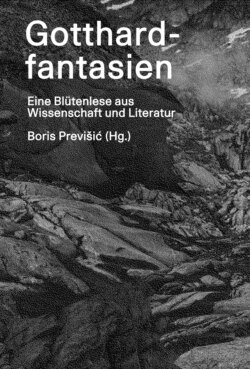Читать книгу Gotthardfantasien - Lars Dietrich - Страница 19
Jakob Hardmeyer 1888
ОглавлениеMeine erste Quelle stammt von Johann Jakob Hardmeyer-Jenny, einem Sekundarlehrer und Kinderbuchautor aus Männedorf, der zahlreiche populäre Schriften über die Landschaft der Schweiz verfasste und viele Porträts von historischen Persönlichkeiten schrieb.3 Ab den 1880er-Jahren betreute er die Schriftenreihe «Europäische Wanderbilder» des Orell-Füssli-Verlags, zu der er selbst zahlreiche Titel beisteuerte. Er schrieb viel, unter anderem über den Zürich- und den Vierwaldstättersee, über Locarno und seine Seitentäler, über Lugano und über das Berner Seeland. Er schrieb auch über eine Reihe von Bahnen: 1888 über die Brünigbahn, 1889 über die Pilatusbahn, 1890 über die Monte-Generoso-Bahn und 1895 über die Seethalbahn.
Jakob Hardmeyers Reiseführer über den Gotthard muss ein grosser Erfolg gewesen sein. Die Schrift erschien ab 1888 in zahlreichen Auflagen und wurde hundert Jahre später, 1979, als Faksimile-Druck neu aufgelegt. Hardmeyer war in der bürgerlichen Welt der Vereine gut vernetzt und dokumentierte zum Beispiel auch eine «Sängerfahrt des Männerchor Zürich nach Mailand», die im April 1888 stattgefunden hatte. Und 1905 verfasste er im Auftrag der Bahngesellschaft einen kurzen Streckenbeschrieb für das breite Publikum mit dem Titel «Nach Italien mit der Gotthardbahn».4 Man kann ihn als den Erfinder der Gotthard-Reise sehen.
Im ersten Betriebsjahr der Gotthardbahn gab es zwischen Luzern und Mailand pro Tag drei Varianten mit dem Bummelzug, bei denen die Fahrgäste umsteigen mussten, und zwei direkte Schnellzug-Verbindungen. Der Fahrpreis betrug bis Mailand in der 1. Klasse 36.65 Franken und in der 3. Klasse 18.05 Franken. Das heisst, dass ein Textilarbeiter damals mehr als einen Wochenlohn für die Reise in der Holzklasse hätte aufwenden müssen, was er natürlich nicht tat. Die Fahrtzeit betrug von Luzern bis Mailand zehn Stunden. Ein Schnellzug fuhr in Luzern jeweils morgens um 10 Uhr los. Eine halbe Stunde später erreichte er Rotkreuz. Hier stiegen die Reisenden zu, die bereits am Vorabend zum Beispiel aus Berlin eingetroffen waren. Eine Stunde nach der Abfahrt in Rotkreuz erreichte der Zug Arth-Goldau, und gut zwei Stunden später, um 12.59 Uhr, traf er in Göschenen ein, wo es eine halbe Stunde Aufenthalt gab. Das war gerade genug Zeit, um im Bahnhofsrestaurant eine Mahlzeit einzunehmen. Die 55 Kilometer der Nordrampe wurden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 Kilometer je Stunde befahren. Die Fahrt durch den Tunnel dauerte von 13.25 bis 13.50 Uhr. Kurz vor 16 Uhr erreichte der Zug Bellinzona. Um 17.25 Uhr war er in Chiasso und um 19.41 Uhr in Mailand. Hier bestanden Anschlüsse nach Turin, Genua, Bologna, Florenz, Rom, Neapel und Venedig. Was haben die Fahrgäste zwischen Luzern und Mailand gesehen? Und welche Gefühle stellten sich möglicherweise bei ihnen ein, als sie diese Strecke befuhren?
Die Schaulust der Reisenden war in den Anfängen der Eisenbahnfahrt stark bedroht durch die Vernichtung der Aussicht aus dem mechanisch beschleunigten Vehikel. Auch wenn der Zug nur mit langsamen 25 Kilometer je Stunde fuhr, liess die dampfgetriebene Eisenbahn einen Gegensatz zwischen der Authentizität eines Ortes und dem schnellen, mühelosen Überwinden geografischer Distanzen entstehen. Der Erfahrungshorizont der Fahrgäste in der 1. Klasse war die Postkutsche, die zwar in hohem Tempo über den Pass fuhr, aber doch kaum mehr als zehn Kilometer je Stunde erreichte. Die Passagiere in der 2. Klasse und in der 3. Klasse hatten den mühseligen Gang mit Maultieren vor Augen, also kaum mehr als fünf Kilometer je Stunde. Für sie war die Dampflokomotive rasend schnell.
Eisenbahnfahrten waren im ausgehenden 19. Jahrhundert mit einer tiefgreifenden Sinnesverwirrung verbunden. Der Dichter Heinrich Heine schrieb 1843 anlässlich der Eröffnung der Linien von Paris nach Rouen und Orléans: «Welche Veränderungen müssen jetzt eintreten in unsrer Anschauungsweise und in unseren Vorstellungen! Sogar die Elementarbegriffe von Zeit und Raum sind schwankend geworden.»5 Unter den Bedingungen des industrialisierten Transports war das Landschaftserlebnis, das die wandernden, reitenden oder kutschenfahrenden Reisenden bisher gekannt hatten, technisch versperrt. In der Eisenbahn waren die Fahrgäste mit dem sie umgebenden Aussenraum nur noch visuell verbunden – doch zu sehen gab es für sie eigentlich nichts. So legt ein anonymer Text aus dem Jahr 1844 nahe: «Beim Reisen in der Eisenbahn gehen in den meisten Fällen der Anblick der Natur, die schönen Ausblicke auf Berg und Tal verloren oder werden entstellt.»6
Die Geschwindigkeit produzierte eine spürbare Verschiedenheit zwischen dem Raum-Zeit-Gefüge im Inneren des Wagens und jenem in der Aussenwelt. Dadurch verlor das Zugfenster seine Fensterfunktion: Es stellte keine Verbindung zwischen Innen und Aussen mehr her, sondern war nur noch ein Loch hin zu einer anderen Dimension, die sich zunächst nicht strukturieren liess. Man sah nichts, oder zumindest nichts, das sich sinnvoll auf den Innenraum hätte beziehen lassen. Hingegen wurde das Innere der Wagen zu einem neuen öffentlichen Raum, der durch Verhaltensregeln organisiert werden musste. Neben dem Lesen, das sich in den Abteilen der 1. und 2. Klasse schnell etablierte, wurde auch das Betrachten der vorbeiziehenden Landschaft bald zu etwas Anständigem. Man las im Reiseführer und schaute zum Fenster hinaus. So wurde es den im Zugabteil zufällig zusammengewürfelten Personen möglich, mit der intimen Nähe zueinander umzugehen.7 Am Fensterplatz gab es zwar weniger zu sehen als vom Maultier aus oder von der Kutsche. Aber die Geschwindigkeit der Bahn führte dem Fahrgast die Welt wie in einem Panorama vor Augen. Die Eisenbahn bot eine effektvolle Reduktion auf die Totale. Die Sicht aus dem Zugfenster, so schrieb ein französischer Beobachter in den 1860er-Jahren, «zeigt Ihnen lediglich das Wesentliche einer Landschaft. […] Verlangen Sie keine Details von ihr, sondern das Ganze, in dem das Leben ist.»8 Die Landschaft wurde zum Strich, in dem einzelne Punkte in Szene gesetzt werden mussten – wie zum Beispiel die Kirche von Wassen.
Jakob Hardmeyer baute im Jahr 1888 auf der Sinnesverwirrung seines Publikums auf und setzte gezielte Orientierungspunkte. Dabei sticht der Streckenabschnitt um Wassen hervor, weil hier ein bedeutendes Stück Steigung durch Kehrtunnels überwunden werden musste. Hardmeyer schrieb:
«Am Fusse des Wassener Kirchhügels überschreitet die Bahn die aus einer grossartig wilden Schlucht hervorschäumende Maienreuss (zum ersten Mal), unterfährt den Kirchhügel, geht südwärts der Reuss entlang, überschreitet sie auf einer Brücke und unweit des Dörfchens Wattingen verschwindet sie im rechtsseitigen Berghang. Es beginnt der Wattingerkehrtunnel, […] Sich nordwärts wendend, geht sie hinter dem Dorfe Wasen und seiner Station in nördlicher Richtung thalauswärts und überbrückt die Maienreuss wieder (zum zweiten Male). Sie hält die nördliche Richtung immer noch ein, um sie im sogenannten Leggisteinkehrtunnel mit der südlichen zu vertauschen. An der Maienreussschlucht tritt sie an’s Tageslicht und überspringt dieselbe auf prachtvoll situierter Brücke (zum dritten Mal), mehr als 100 Meter über dem ersten Übergang.»9
Der Reiseführer unterstellte eine Überforderung der Reisenden und lieferte eine Blickanleitung:
«Der Reisende, der kein Plänchen zur Hand oder keinen Ingenieur an seiner Seite hat, verliert in Folge der nach allen Richtungen gehenden Fahrt vollständig seinen Kompass. Der Wendungen, die der Zug macht, wird er kaum gewahr, da sie drinnen im dunkeln Schosse der Felsen erfolgen. Es scheint ihm, er komme nicht von der Stelle, denn immer wieder sieht er die Wasener Kirche, – über sich, hinter sich, vor sich, neben sich und unter sich[…]. Erst dann, wenn er über dem Dorfe Wasen am Bergabhang dahin fährt …, findet er sich wieder zurecht. Wie ob einem gewaltigen Siege jubeln oft an dieser bewundernswertesten Stelle der Bahn die staunenden Insassen des dahinsausenden Zuges laut auf.»10
Seit den 1880er-Jahren haben Generationen von Fahrgästen auf die Kirche des kleinen Ortes Wassen geschaut, so wie es Jakob Hardmeyer vorschlug.