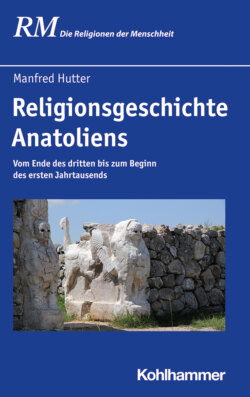Читать книгу Religionsgeschichte Anatoliens - Manfred Hutter - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1 Die Götterwelt als Widerspiegelung gesellschaftlicher Prozesse
ОглавлениеIn den verschiedenen Sprachen der althethitischen Zeit sind mehrere Wörter für Gott(heit) belegt.23 Im Hethitischen lautet – wie erwähnt – das Wort für Gott šiu(ni)-/šiwa(nni)-. Eine Ableitung von diesem Wort (allerdings der »Göttlichkeit« entkleidet) liegt in šiwatt- »Tag« vor. Auch das Luwische zeigt noch einen Reflex dieser indoeuropäischen Wurzel, allerdings nicht als Begriff »Gott«, sondern im Gottesnamen »Tiwad« für den Sonnengott. Vergleichbar dieser sprachlichen Bedeutungsverschiebung und einengenden Spezifizierung auf den Sonnengott im Luwischen ist die Entwicklung im Palaischen, wo der Sonnengott den Namen Tiyaz trägt; der Allgemeinbegriff für »Gott« im Palaischen ist tiu=na-,24 d. h. eine palaische Weiterbildung aus der indoeuropäischen Wurzel. Auch das lydische Wort ciw- für »Gott« im 1. Jahrtausend ist etymologisch damit verwandt. Auch wenn somit sprachlich in der Bezeichnung für Gott in einigen anatolischen Sprachen ein indoeuropäisches Erbe bewahrt blieb, darf man daraus kein Weiterleben einer »indoeuropäischen Gottesvorstellung« in Anatolien ableiten. Indirekt zeigt dies der negative Befund im Luwischen (und im damit verwandten Lykischen im 1. Jahrtausend), da diese beiden Sprachen mit maššan(i)- bzw. maha(na)- ein völlig anderes Wort für »Gott« verwenden, das entweder mit griechisch mega- »groß« verbunden werden kann oder vielleicht aus einer nicht-indoeuropäischen Sprache im westlichen Zentralanatolien stammt. Das hattische Wort für »Gott« lautete šaḫap-; dieses ist sowohl als eigenständiges Wort, aber auch als Teil des Namens der Göttin Tete-šḫapi (wörtlich »die erhabene Göttin«) oder des Gottes Katte-šḫawi/Katte-šḫapi (wörtlich »König-Gott«) bezeugt.