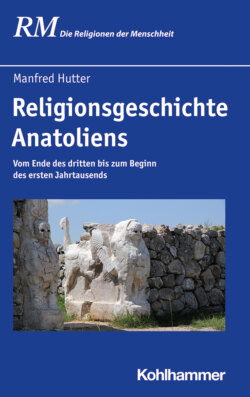Читать книгу Religionsgeschichte Anatoliens - Manfred Hutter - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.1 Zum althethitischen »Staatspantheon«
ОглавлениеWahrscheinlich ist für die althethitische Zeit noch nicht mit einer voll entfalteten Struktur eines »Staatspantheons« zu rechnen. Allerdings lassen sich bereits einige Kernelemente beobachten, die letztlich für die ganze hethitische Geschichte hindurch strukturell bedeutsam bleiben.
In den Annalen Ḫattušilis I. ist u. a. mehrfach davon die Rede, dass er die Kriegsbeute in den Tempel der Sonnengöttin von Arinna, des Wettergottes (des Himmels) und der Göttin Mezzulla gebracht hat.25
So (spricht) Tabarna Ḫattušili, der Großkönig, König des Landes Hatti, der Mann aus Kuššara. … Danach aber zog ich nach Zalpa (in Nordsyrien) und zerstörte es, und seine Götter(bilder) nahm ich mit und drei zweirädrige MADNADU(-Wagen) gab ich der Sonnengöttin von Arinna. Ein Rind aus Silber, eine Faust aus Silber gab ich dem Tempel des Wettergottes, diejenigen (Götterbilder) aber, die übrig waren, die gab ich dem Tempel der Mezzulla. …
In wenigen Tagen überschritt ich den Fluss Puruna (Eufrat) und mit (meinen) Füßen trat ich das Land Ḫaššuwa wie ein Löwe nieder und wie ein Löwe schlug ich (es), und Staub brachte ich auf sie und ich nahm all ihre Habe mit und füllte Ḫattuša damit. … Ferner nahm ich ihm (dem Ort Ḫaššuwa) die Götter(bilder) weg: den Wettergott, Herrn von Aruzza, den Wettergott, Herrn von Ḫalab, Allatu, (den Berggott) Adallur, Leluri, zwei Rinder aus Silber, drei Statuetten aus Silber (und) Gold. … Diese Götter(bilder) von Ḫaššuwa brachte ich zur Sonnengöttin von Arinna. Die Tochter der Allatu, Ḫebat, drei Statuen aus Silber, zwei Statuen aus Gold, diese brachte ich in den Tempel der Mezzulla. Eine IMITTU(-Lanze) aus Gold, ein Szepter aus Gold, fünf Keulen aus Silber, drei Doppeläxte aus Lapizlazuli, eine Doppelaxt aus Gold, diese brachte ich in den Tempel des Wettergottes.
Auch aus anderen nordsyrischen Städten werden die Götter(statuen) durch Ḫattušili nach Ḫattuša gebracht, allerdings ist für die althethitische Zeit zu betonen, dass mit dem Transfer der Götterstatuen nicht die Verehrung dieser Götter in Ḫattuša verbunden wurde, sondern es ging dabei um (materielle) Kriegsbeute, die in den Tempeln der drei wichtigsten Gottheiten der hethitischen Hauptstadt – und damit des »Staates« – deponiert wurden.
Blicken wir genauer auf das »Pantheon« Ḫattušilis, so zeigt sich die Spitzenstellung der Sonnengöttin von Arinna, wobei der hinzugefügte Ortsname »Arinna« auf die Komplexität der religionsgeschichtlichen Entwicklungen hinweist:26 Manchmal wird die Göttin auch bloß als Ariniddu (d. h. die »Arinnäische«) bezeichnet. Die Sonnengöttin war die wichtigste Göttin der Hattier; der Zusatz des Ortsnamens Arinna verweist auf die alte hattische Kultstadt dieses Namens, deren (ursprünglich lokaler) Kult eng mit der Verehrung der Göttin Wurunšemu verbunden wird, deren Name vom hattischen Wort wur-/fur- »Erde, Land« herzuleiten ist. Diese Identifizierung der beiden Namen zeigt die hattisch-hethitische Bilingue KUB 28.6 Vs. 12, in deren hattischer Version der Name Wurunšemu parallel zur »Sonnengöttin von Arinna« der hethitischen Version verwendet wird. Der original-hattische Name der Sonnengöttin war Eštan (im Hethitischen zu Ištanu umgeformt). Dass die Sonnengöttin sicher weiblich war, macht ihr Titel »Königin« (hatt. kattaḫ; logographisch MUNUS.LUGAL) deutlich. Ein hattisches Bauritual (KBo 37.1) beschreibt die Errichtung eines Palastes für diese Sonnengöttin in Liḫzina, wobei die Unterweltsgöttin Lelwani und der Wettergott am Bau mitwirken.27 Im Vergleich mit dem Bauritual KUB 29.1 kann man daraus ableiten, dass wohl auch dieses hattische Ritual die Sonnengöttin mit dem Königtum verbindet. Bemerkenswert ist daran, dass das Ritual anscheinend eine ursprünglich lokale Version der Verbindung der Sonnengöttin mit einem (vorhethitisch lokalen) Königtum in der Stadt Liḫzina erkennen lässt, die jedoch an den »Staatskult« angepasst wurde. Für das »Staatspantheon« ergibt sich daraus, dass man davon ausgehen kann, dass die hattische Sonnengöttin ihre Spitzenstellung aus der hattischen Kultur im althethitischen Staat nicht nur bewahrt hat, sondern durch die Beziehung zur Kultstadt Arinna noch zusätzlich an Renommee gewonnen hat. Aber auch andere lokale Traditionen wurden rezipiert. Mezzulla28 ist die Tochter dieser Göttin, die ursprünglich ebenfalls eng mit Arinna verbunden war, aber gemeinsam mit ihrer Mutter überregionale Bedeutung erhielt. Manchmal wird Mezzulla auch mit dem hattischen Namen Tappinu (wörtlich »ihre Tochter«, gemeint in Bezug auf die Sonnengöttin) bezeichnet. Dadurch ist klar, dass die beiden bei Ḫattušili namentlich genannten Göttinnen aus dem hattischen Milieu stammen.
Dies gilt auch für den Wettergott, obwohl sein Name nur mit dem Wortzeichen DIŠKUR (»Wettergott«) und nicht syllabisch geschrieben ist. Der hattische Name des Wettergottes war Taru,29 wobei der Stier als sein Begleittier gilt. Die Bedeutung der Wettergötter in Anatolien zeigt sich deutlich daran, dass wir aus der hethitischen Geschichte rund 150 Orte kennen, in denen ein Wettergott verehrt wird; solche lokalen Wettergötter werden meist als Söhne des Wettergottes (des Himmels) und der Sonnengöttin (von Arinna) bezeichnet. Die feste Verbindung zwischen dem Wettergott und der Sonnengöttin wird gut ab Ḫattušili I. fassbar.30 Darin ist m. E. eine Neuerung in der kleinasiatischen Religionsgeschichte – zumindest gegenüber den religiösen Verhältnissen, wie sie aus den kārum-zeitlichen Texten aus Kaneš und aus dem Anitta-Text abzulesen sind – zu sehen, da diese älteren Quellen die Verbindung zwischen Sonnengöttin und Wettergott nicht zeigen. Diese erste Paarbildung hat als Konsequenz, dass Mezzulla in der weiteren hethitischen Religionsgeschichte als (eine) Tochter des Wettergottes des Himmels gilt, so z. B. im junghethitischen Gebet der Königin Puduḫepa an die Sonnengöttin von Arinna:31
[Du], Mezzulla, meine Herrin, (bist) für den Wettergott und die Sonnengöttin von Arinna die geliebte Tochter. Was du, Mezzulla, meine Herrin, dem Wettergott, deinem Vater, und der Sonnengöttin von Arinna, deiner Mutter, sagst, das hören sie. Sie weisen es nicht (zurück).
Ḫattušilis Annalen-Text zeigt somit unübersehbar, dass die Sonnengöttin und der Wettergott an der Spitze des »offiziellen« Pantheons des Staats stehen, was auch dem schon vorhin zitierten Palastbauritual (KUB 29.1 i 17–27) entspricht, wenn dem König das Land von der Sonnengöttin und dem Wettergott zur Verwaltung gegeben wird und er diese beiden Gottheiten metaphorisch als Mutter und Vater bezeichnet.
Ein weiteres Charakteristikum der offiziellen Götterwelt in der althethitischen Zeit ist die Bedeutung einzelner Schutzgottheiten, die ebenfalls dem hattischen Milieu entstammen. Einige von ihnen sind eng mit der Jagd verbunden, so dass man vermuten kann, dass ihr Ursprung – zumindest teilweise – in einer weiter zurückreichenden Epoche liegt, von der wir allerdings kein schriftliches Quellenmaterial besitzen. Die Bedeutung dieser Gottheiten geht – wie Gregory McMahon hervorgehoben hat – in der althethitischen Zeit so weit, dass sie nach dem Wettergott und der Sonnengöttin von Arinna (mit ihrer Tochter Mezzulla) praktisch den dritten Rang im Pantheon einnehmen.32 Wenn man in Inar eine der hethitischen Schutzgottheiten sehen darf, deren Name sich hinter der ideographischen Schreibung DLAMMA verbirgt,33 so bietet zumindest der Illuyanka-Mythos mit der Übergabe des »Hauses« an den König einen Anknüpfungspunkt für die (zeitweilige) wichtige Rolle der Schutzgottheit im Staatspantheon.
Damit ist eine erste Zusammenfassung für die althethitische Zeit angebracht: Die politische hethitische Oberschicht übernimmt weitgehend die hattischen Götter in ihr »Staatspantheon«, wobei offensichtlich politische Räson mitgespielt hat. Für den weiteren Verlauf der hethitischen Religionsgeschichte ist dabei als Kontinuum zu betonen, dass vor allem die Vorrangstellung von Sonnengöttin und Wettergott bis zum Ende der hethitischen Zeit sichtbar bleibt; allerdings kommt es auch zu Erweiterungen und Gleichsetzungen mit lokalen Gottheiten, und lokale Kulte werden in Beziehung zum Staatskult gebracht.34 Dabei scheinen solche Prozesse im Laufe der hethitischen Geschichte zugenommen zu haben, um durch die Schaffung von Beziehungsgeflechten zwischen lokalen Göttern und dem Staatspantheon auch zur Festigung der politischen Interessen beizutragen.