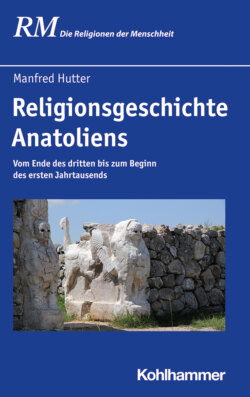Читать книгу Religionsgeschichte Anatoliens - Manfred Hutter - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.4 Ḫattuša
ОглавлениеḪattuša war schon eine vorhethitische hattische Siedlung, die von Anitta zerstört worden war.71 Trotz des Fluchs, der denjenigen treffen sollte, der die Stadt wieder besiedelt, hat Ḫattušili I. den Ort zu seiner Hauptstadt gemacht, wobei die beiden Kernbereiche, der Burgberg (Büyükkale) mit dem Palast und die Unterstadt mit dem Großen Tempel (= Tempel 1), das althethitische Stadtbild geprägt haben.72 Ob bereits Ḫattušili eine Stadtmauer zum Schutz der Siedlung errichten ließ, ist archäologisch nicht geklärt, dürfte aber wahrscheinlich sein. Sein zweiter Nachfolger Ḫantili I. rühmt sich in seinen Annalen, eine Stadtmauer als Befestigung für Ḫattuša errichtet zu haben (KBo 3.57 iii 7–18). Ein Stadttor – das ašuša-Tor – wird im KI.LAM-Fest erwähnt, da das Königspaar durch dieses Tor die Stadt verlässt, um zum Stelenbezirk des Wettergottes zu gelangen; dort begrüßen Priester aus Arinna bzw. Ziplanta den König.73
Für die Bautätigkeit in der Unterstadt ist die Errichtung des Tempels 1 – mit umliegenden Magazinbauten – ein bemerkenswerter Einschnitt. Als ältester Tempel der Stadt unterscheidet er sich in der Gesamtanlage klar von den jüngeren Kultbauten, da es sich dabei um ein geschlossenes Bauensemble handelt, das nur »sakrale« Räume enthält.74 Lagerräume und Bauten, die mit einem Tempel als Wirtschaftsunternehmen verbunden sind, sowie Archivräume bzw. mögliche Wohn- oder Aufenthaltsräume lagen zwar im Tempelviertel, waren aber baulich klar vom eigentlichen Tempelgebäude getrennt. Der Tempelbau ist als Bauwerk von Beginn an durchgeplant, wobei die Erbauung des Tempels eng mit der Errichtung der hethitischen Dynastie in Ḫattuša zu verbinden ist, so dass der Tempel noch im späten 17. oder frühen 16. Jahrhundert entstanden ist. Den Eingang in den Tempel ermöglicht eine Toranlage im Süden des Bauwerks, die in den großen Hof führt. Der Tempelhof ist der Ausgangspunkt, von dem sowohl die beiden Hauptkulträume (Cellae) im Norden des Tempels, als auch weitere Kulträume erreicht werden können. Die besser erhaltene Cella an der Nordseite des Tempels misst 7,9 mal 10,4 Meter und ist der größte Raum im ganzen Tempelareal. An ihrer Nordwand befinden sich links und rechts des Sockels, der die Statue der Gottheit trug, zwei Fenster. Zwei weitere Fenster in der westlichen und östlichen Wand der Cella sind ebenfalls auf den Statuensockel ausgerichtet.75 Westlich von dieser Cella befand sich eine zweite – wohl weitgehend vergleichbare – Cella, die jedoch nur noch sehr schlecht erhalten ist. Hervorzuheben sind als Charakteristikum des Tempels weitere Kulträume als eigenständige »Kapellen« oder »Schreine«, da ihre architektonische Lage im Tempel nicht auf die beiden Cellae an der Nordseite ausgerichtet ist und auch sie nur direkt vom Hof erreichbar sind. Die Größe dieser Kulträume ist deutlich geringer als bei den beiden Cellae, und die Räume unterscheiden sich in ihrer baulichen Gestaltung.76 Dieser Befund erlaubt die Interpretation, dass möglicherweise unterschiedliche Kulte für unterschiedliche Gottheiten in diesen Kulträumen durchgeführt wurden. Hervorzuheben ist jedoch, dass im Tempel 1 durch diese bauliche Gestaltung anscheinend alle wichtigen Gottheiten der althethitischen Zeit innerhalb einer Tempelanlage verehrt wurden, im Unterschied zu den späteren Tempelbauten in der Oberstadt, die jeweils nur für eine Gottheit (oder ein Götterpaar) errichtet waren. Bei den im Tempel verehrten Gottheiten handelt es sich wohl um die wichtigen Gottheiten des althethitischen Staatskults mit hattischen Wurzeln. Lange konnte nur vermutet werden,77 dass die beiden Cellae dem Wettergott von Ḫatti und der Sonnengöttin von Arinna geweiht waren. Diese sehr plausible Annahme kann nun durch Ausgrabungsergebnisse in jüngster Zeit weiter deutlich gestützt werden. In mehreren Texten ist ein »Haus des Bronzeschalenhalters« (É LÚZABAR.DAB) genannt, in dem kultische Aktivitäten stattfanden. Für ein seit einigen Jahren etwas nördlich des Areals des Tempels 1 schrittweise ausgegrabenes großes öffentliches Gebäude hat Oğuz Soysal aufgrund der Sichtung jener Texte, die das »Haus des Bronzeschalenhalters« und die im Zusammenhang mit einem solchen Haus durchgeführten Praktiken nennen, gezeigt, dass diese textlichen Bezeugungen und der archäologische Befund gut miteinander korrelieren, so dass man dieses Bauwerk als »Haus des Bronzeschalenhalters« identifizieren kann. Kleinfunde mit kultischer Funktion aus diesem Gebäude sind in die althethitische Zeit zu datieren. Einblick in Kultpraktiken im »Haus des Bronzeschalenhalters« geben mehrere Texte, bei denen immer wieder sieben Gottheiten78 aus dem Kreis der Sonnengöttin genannt werden. KBo 25.51+ i 7’-17’ beschreibt dies wie folgt:79
Der Aufseher der Köche (und) der Prinz, [voranlaufe]nd, [t]ragen die Götter(statue) [in das LÚZABAR.DAB-Haus f]ort. Der Prinz [verbeugt sich] (vor) der Gottheit [u]nd tritt (in das Gebäude ein). [Er verehrt sieben (Gottheiten) der Reihe nach: Son]nengottheit, Mezzulla, Telipinu], GAL.ZU, Taḫpillanu, [Kuzzanišu], Šušumaḫi. Der Prinz ver]neigt sich. Der Aufseher der Köche [gibt dem Prinzen ein …-Brot, und er (= der Prinz)] nimmt (es) für sich. [Er] kommt [aus dem LÚZABAR.DAB-Haus heraus und] geht […? in den Tempel der Sonnengottheit].
Aufgrund der Beschreibung, dass der Prinz am Ende seiner Handlungen zum Tempel der Sonnengottheit, der zweifellos in der Nähe gelegen sein muss, geht, kann man den Schluss ziehen, dass mit diesem Tempel eben Tempel 1 gemeint ist. Somit gewinnt die vorhin genannte Annahme, dass in der östlichen der beiden Cellae in Tempel 1 die Sonnengöttin verehrt wurde, fast an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit.
Andere Texte der althethitischen Zeit nennen noch weitere Tempel für verschiedene Gottheiten in Ḫattuša. So erwähnt Ḫattušili I. in seinen Annalen solche für die Sonnengöttin von Arinna, den Wettergott und Mezzulla. Möglicherweise bezieht sich diese Aussage ebenfalls auf Tempel 1. Möglich ist aber auch, dass die Lage der von Ḫattušili genannten Tempel im Bereich des Burgberges (Büyükkale) zu lokalisieren ist, wobei in diesem Fall jedoch von architektonisch kleinen Schreinen oder bloßen Kulträumen innerhalb des Palastareals auszugehen ist. Neben diesen Gottheiten nennen weitere Texte auch Tempel für Inar und Ḫalki.80 Ferner werden das ḫešta-Haus für die Unterweltsgöttin Lelwani sowie ein »Haus des kurša-« genannt. Neben den »Tempeln« gab es auch Stelen, die verschiedenen Gottheiten geweiht waren bzw. diese in der Hauptstadt repräsentierten. Zusätzlich zu solchen Textzeugnissen sind drei Tempel in der Oberstadt von Ḫattuša archäologisch nachgewiesen, die als Tempel 2, Tempel 3 und Tempel 5 gezählten Bauwerke, die aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammen.81 Welche Gottheiten in diesen drei Tempeln verehrt wurden, ist unbekannt. Wie weit bei der Felsengruppe von Yazılıkaya außerhalb der Hauptstadt nordöstlich des Burgberges bereits in althethitischer Zeit religiöse Aktivitäten ausgeübt wurden, ist schwer zu sagen.82 Keramikscherben aus diesem Bereich stammen aus der althethitischen Phase, und das so genannte Bauwerk I wurde um ca. 1500 vor der Felskammer A errichtet, anscheinend als Abgrenzung dieser Felskammer gegenüber der Umgebung. Daher kann man vermuten, dass dadurch ein für kultische Zwecke nutzbarer Raum geschaffen wurde. Die Ausstattung mit Reliefs, die bis zur Gegenwart sichtbar sind, ist jedoch erst im 13. Jahrhundert geschehen, eventuell mit einer einzigen Ausnahme, nämlich des als Nr. 65–66 gezählten Reliefs, das ein einander gegenübersitzendes Götterpaar zeigt, was ein – jedoch unsicherer – Hinweis auf eine kultische Nutzung des Platzes bereits in der späten althethitischen Zeit sein könnte.
Fasst man zusammen, so stehen in Ḫattuša hattische Gottheiten im Mittelpunkt des Kultes, wodurch der Kult der Hauptstadt (bzw. der Staatskult) mit den alten lokalen Traditionen verflochten wird. Am deutlichsten ist dies im KI.LAM-Fest zu sehen, wenn Vertreter anderer Orte an diesem Fest in Ḫattuša teilnehmen, allen voran die wichtigen Priester aus Ziplanta bzw. Arinna. Dass Vertreter aus der dritten Kultstadt Nerik nicht bei diesem Fest in Ḫattuša anwesend sind, könnte mit der großen geographischen Entfernung Neriks von der Hauptstadt zusammenhängen, d. h. die Teilnahme von »auswärtigen« Priestern an den großen »Staatsfesten« in der Hauptstadt ist zumindest in der althethitischen Zeit auf jene Orte beschränkt, die nur zwei oder drei Tagesreisen entfernt waren. Ideologisch wichtig an der Teilnahme dieser auswärtigen Priester ist dabei, dass dadurch Religion ein Verbindungsfaktor zwischen dem politischen Zentrum Ḫattuša und den traditionellen hattischen Kultstädten wird.