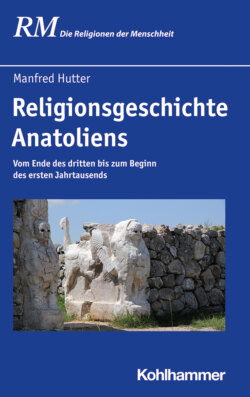Читать книгу Religionsgeschichte Anatoliens - Manfred Hutter - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3 Plätze der Kultausübung 2.3.1 Aussehen und Ausstattung der Tempel
ОглавлениеWahrscheinlich dürfte jeder Ort wenigstens einen Tempel gehabt haben, dessen Größe von der Bedeutung des Ortes abhing. Allerdings sind bislang nur wenige eindeutig als Tempel zu identifizierende Bauten durch Ausgrabungen erschlossen worden. Insofern stützen sich Aussagen über Tempel und ihr Aussehen sowie ihre Ausstattung in althethitischer Zeit auf wenige textliche Hinweise, deren Aussagekraft teilweise durch junghethitische Beschreibungen erhöht werden kann, da man davon ausgehen darf, dass die Vorstellungen über Tempel eine starke Kontinuität aufweisen.83 Der wichtigste Terminus, den die Texte nennen, ist É.DINGIR bzw. in hethitischer Lautung šiunaš parna- bzw. šiunaš per, das »Haus Gottes/der Götter«, wobei anstelle des allgemeinen Begriffes »Gott« auch der Name einer Gottheit genannt werden kann, um den Tempel, der einer spezifischen Gottheit geweiht war, zu bezeichnen.84
Hinsichtlich des Aussehens85 ist festzuhalten, dass die Ausrichtung der hethitischen Tempel nicht verbindlich ist, sondern teilweise den topographischen Gegebenheiten Rechnung tragen musste. Genauso ist als charakteristisch zu erwähnen, dass eine besonders erhöhte Lage innerhalb einer Stadt für den Tempel nicht verbindlich war. Ein Torbau ist der Zugang zum Tempel und führt in einen geschlossenen Hof. Der Hof (ḫila-) wird meist von einer oder zwei Säulenhallen (ḫilammar) an der Seite begrenzt und noch von anderen Bauten, deren genaue Funktion sich nur selten erschließt, umgeben. Auch auf dem Dach der Tempel konnten Kulthandlungen stattfinden, wie etwa eine Abbildung auf der İnandık-Vase zeigt. Wahrscheinlich ist damit zu rechnen, dass der Tempelhof nicht unbeschränkt für alle zugänglich war. Die Cella als zentraler Kultraum lag an einer Schmalseite des Bauensembles, entweder im Anschluss an den Hof, jedoch meist nicht direkt axial zum Torbau oder seitlich des Hofes, so dass man sich um 90 Grad wenden musste. Nachdem man vom Torbau in den Hof getreten war, musste man somit die Blickrichtung bewusst auf die Cella orientieren. Möglicherweise ist damit eine Konzeption ausgedrückt, die dem Tempelbesucher die Differenz zwischen dem »alltäglichen« und dem »sakralen« Raum bewusst machen sollte und so dazu diente, »Unerwünschtes« vom zentralen heiligen Ort innerhalb des Tempels fernzuhalten. Dazu trägt auch bei, dass die Cella nicht direkt zugänglich war, sondern einige vorgelagerte Räume den Weg »erschwerten«, der wohl nur für Priester offen war. Gelegentlich finden sich in einem Tempel auch zwei Cellae, wie dies in Tempel 5 und in Tempel 1 in Ḫattuša der Fall ist. Hervorzuheben ist, dass hethitische Tempel bzw. der Hauptkultraum Fenster haben konnten, so dass man die Statue der Gottheit sehen konnte. Dass dies nicht immer völlig problemlos war, zeigt ein allerdings erst junghethitisches Orakelprotokoll aus Alalaḫ:86
Weil die Gottheit durch ein Orakel im Zorn über ein Sakrileg bestimmt wurde, befragten wir die Tempelleute. Folgendermaßen (sprach) Tila: »Nicht schaut man auf den Wettergott, aber eine Frau hat durch ein Fenster hineingeschaut. Und ein Kind ging in das Innere(?) des Tempels. Ich war zerlumpt(?) und wir gingen in das Innere des Tempels hinein.«
Trotz der kurzen Ausdrucksweise ist klar, dass hier Fälle erörtert werden, die die Grenzen zwischen »außen« und »innen« in Bezug auf den Tempel missachteten, so dass der Wettergott erzürnte. Der unerlaubte Blick durch das Fenster in die Cella wie auch das unbefugte bzw. unangemessene Betreten der Cella erzürnen die Gottheit. Daraus kann man ableiten, dass der Tempel – bzw. die Cella – als ideell abgegrenzter Raum nicht für jedermann, sondern nur für qualifizierte Personen zugänglich war.
Auch zur Ausstattung der Tempel geben manche Texte einige Informationen, die teilweise durch archäologische Befunde ergänzt werden können:87 In der Cella standen ein Altar und die Statue der Gottheit, der der Tempel geweiht war. Ein Tonmodell, das in İnandık gefunden wurde, zeigt wahrscheinlich eine Cella als Modell, in der eine (nackte) Gottheit auf einem Thron sitzt. Eventuell zeigt auch eine Abbildung der so genannten Bitik-Vase ein Götterpaar auf dem Thron in der Cella. Götterstatuen in hethitischen Tempeln waren in der Regel aus Holz (mit Edelmetallüberzug) und nicht allzu groß; manche Texte weisen auf eine Größe der Statuen zwischen 20cm und 60cm hin, so dass anzunehmen ist, dass solche Statuen auf einem Podest oder Thron standen. Die Größe des Podestes in der östlichen der beiden Cellae in Tempel 1 in Ḫattuša lässt jedoch vermuten, dass darauf eine größere Statue platziert war. Erwähnenswert ist auch eine Abflussvorrichtung in der Cella des Tempels des Wettergottes in Šarišša, die wohl den Zweck hatte, die bei den Opfern ausgegossene Flüssigkeit auf geordnetem Weg aus der Cella abzuleiten, um nicht den Boden aufzuweichen.
Über die detaillierte Ausstattung ist wenig bekannt, da manches eher auf zufälligen Funden beruht, z. B. ein Kopf einer Löwenfigur aus Tempel 2 in Ḫattuša, wobei die Figur wohl als Torwächter fungierte; der Kopf einer Sphinx aus Tempel 3 oder die Figur einer Göttin vom Ištar-Typ in Tempel 7; letztere erlaubt zumindest die Vermutung, dass dieser Tempel einer Göttin dieses Typs geweiht war. Dass die Tempelwände mit Malerei versehen waren, zeigen noch Reste derselben in Tempel 9. Erwähnenswert sind auch die – in mehreren Tempeln oder Schreinen – gefundenen Libationsgefäße in Form eines Stierpaares, u. a. aus Ḫattuša, Šarišša, İnandık, Nerik und Šamuḫa, die zwar nicht zur Zuweisung des jeweiligen Tempels an einen Wettergott ausreichen, aber zur Ausstattung für Libationen gehören.
Ein paar Einblicke in die Ausstattung der Tempel geben auch Tempelbaurituale, obwohl deren umfangreiche textliche Dokumentation in jüngeren Kompositionen vorliegt.88 KBo 4.1 zeigt, dass offensichtlich – wie bei einem Wohnhaus89 – der zentrale Pfeiler eine wichtige (architektonische und symbolische) Rolle spielte, so dass bei diesem Pfeiler vier Pflöcke eingebaut sind, die die Festigkeit des Tempels garantierten sollen (Rs. 1–4). Als weitere Ausstattung nennt dieses Ritual einen Löwen aus Gold und zwei Rinderpaare, die jeweils durch ein silbernes Joch zusammengehalten werden und auf einem Sockel stehen (Rs. 7–10); ebenfalls sind Herde und die Türe genannt (Rs. 17–26). Auch KBo 15.24+ zählt als Ausstattung des Tempels die Statue der Göttin auf, die neben dem Pfeiler deponiert wird (ii 48–53), ferner werden ein (Opfer-)Tisch, ein Thron, ein Altar und zwei unterschiedliche Räuchergefäße erwähnt (ii 13–17). Die beiden Texte sind wohl erst in der Großreichszeit entstanden, wobei KBo 15.24+ eng mit dem Milieu von Kizzuwatna verbunden ist. Insofern sollten nicht alle Aussagen dieser beiden Texte eins-zu-eins in die ältere Zeit zurückprojiziert werden. Ebenfalls nur in einer junghethitischen Abschrift vorliegend, aber eventuell im Kern bis in die althethitische Zeit zurückreichend, ist ein hattisch-hethitisches Bauritual (KBo 37.1), das Oğuz Soysal und Aygül Süel jüngst neu untersucht haben.90 Durch die Heranziehung von Textfragmenten aus Ortaköy konnten sie das Verständnis des Textes aus Ḫattuša entscheidend erweitern, weil diese neuen Textzeugnisse einige zusätzliche Abschnitte gegenüber dem Text aus Ḫattuša enthält. Als Bauritual liefert der Text selbstverständlich keine vollständige Beschreibung des Aussehens des Tempels, aber einige Details werden erwähnt: Die Göttin Kataḫzipuri (hatt.) bzw. Kamrušepa (heth.) setzt sich auf den Thron; ferner schmückt sie den Thron mit der Haut eines Löwen und eines Panthers und Tempelbedienstete bringen verschiedene Stoffe zur Dekoration des Tempels herbei (§§ 5f.). Danach wird im Ritual beschrieben, dass die Stiere des Wettergottes auf einem Podest stehen (§ 10).
Diese Baurituale zeigen somit wenigstens teilweise, welche Ausstattung unter anderem in einem hethitischen Tempel zu finden war, wobei Festzeremonien, die in Tempeln durchgeführt wurden, ebenfalls unsystematischen Einblick in die »Tempeleinrichtung« geben. Hier sei daher – aus dem junghethitischen Festabschnitt am 16. Tag des AN.TAḪ.ŠUM-Festes – auf jene »Einrichtungsgegenstände« des Tempels verwiesen, denen Libationen dargebracht werden. Nachdem der König den Tempel betreten hat, heißt es wie folgt: 91
Der Aufseher über die Köche hält eine Ration Wein dem König hin. Der König hält die Hand (daran). Der Aufseher über die Köche libiert vor dem Thron einmal und für Zababa dreimal. Der Aufseher über die Köche und der Aufseher über die Tischmänner reinigen. Der Aufseher über die Köche libiert am Herd einmal, am Thron einmal, am Fenster einmal, am Riegelholz einmal, ferner noch neben dem Herd einmal. Und für die Statue des Ḫattušili libiert er einmal. Der König verneigt sich.
Bei diesen Gussopfern werden somit markante Teile des Tempels hervorgehoben. Der (vergöttlichte) Thron (DḪalmašuit; DDAG) gehört nicht nur zu den wichtigsten Kultobjekten der hethitischen Religion, sondern verweist erneut auf die enge Verbindung zwischen Königtum und Religion. Der Thron war als Ausstattungselement des Kultraumes vorwiegend aus Holz gefertigt. Grundsätzlich war der Thron als Kultplatz leer, da im Verlaufe von Ritualen mehrfach die Rede davon ist, dass einzelne Gegenstände daraufgelegt wurden, etwa in der Fortsetzung des Ritualverlaufs des 16. Tages des AN.TAH.ŠUM-Festes:92
Dann bringt ein Palastjunker das Tuch der Goldlanze und einen Lituus herein. Und das Tuch der Goldlanze gibt er dem König. Den Lituus aber stellt er neben den Thron rechts vom König.
Der leere Thron ermöglichte dabei, dass König (und Königin) bei manchen Ritualen darauf Platz nehmen konnten, was u. a. eine Abbildung auf der İnandık-Vase zeigt.93 Wahrscheinlich stand der Thron neben dem Fenster, einer Säule oder in der Nähe eines Götterbildes. Der Thron und die anderen vorhin genannten Gerätschaften und architektonischen Elemente sind als Teil des Tempels als »Kultobjekte« zu betrachten, da sie durch ihre Verbindung mit dem Tempel Anteil am Göttlichen haben.94