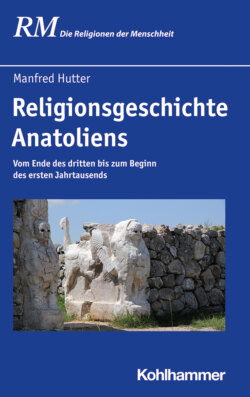Читать книгу Religionsgeschichte Anatoliens - Manfred Hutter - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.1 Nerik
ОглавлениеNerik ist die am weitesten im Norden liegende Kultstadt, wobei durch Geländebegehungen und nachfolgende Ausgrabungen ab 2007 deren Identifizierung mit Oymaağaç Höyük an einem Flussübergang des Kızılırmak etwas südlich der Küste des Schwarzen Meeres gesichert zu sein scheint. Denn in einem bei den Ausgrabungen gefundenen Textfragment ist von einem daḫanga- die Rede. Dieses Wort bezeichnet – in vielen hethitischen Texten aus Ḫattuša42 – sehr wahrscheinlich ein besonderes Gebäude in Verbindung mit der Verehrung des Wettergottes von Nerik, wobei die Texte nur im Zusammenhang mit der Stadt Nerik ein daḫanga- erwähnen.
Bereits in althethitischer Zeit war der Tempel des lokalen Wettergottes von Nerik von überregionaler Bedeutung, ehe die Stadt – vielleicht schon gegen Ende der althethitischen Zeit – von den Kaškäern erobert wurde, so dass der konkrete Kult ersatzweise in die Stadt Ḫakmiš verlegt werden musste.43 Im Selbstverständnis hethitischer Herrscher blieb Nerik aber als alte Kultstadt immer bedeutsam,44 so dass nach der Wiedererlangung des politischen Einflusses über die Stadt in der Großreichszeit die Kultstadt an die vormalige Bedeutung anschließen konnte. Die wechselhafte Geschichte der Stadt bringt mit sich, dass wir über die frühe Periode in Nerik bislang äußerst schlecht informiert sind. Bei den aktuellen Ausgrabungen konnten 2011 die Überreste eines »älteren« Tempels45 entdeckt werden, der – derzeit noch unpräzise – ins 17. oder 16. Jahrhundert datiert wird. Der Tempel war auf dem höchsten Punkt von Oymaağaç Höyük errichtet, wobei ein zentraler Hauptraum (7 mal 5,5 Meter) gefunden wurde, der an den beiden Längsseiten von kleinen schmalen Nebenräumen und an der südöstlichen Seite von einer Vorhalle umgeben ist. Dieses Bauensemble erlaubt die Deutung als Tempel, wobei es im Grundriss dem größeren jüngeren Tempel entspricht, der bei den Ausgrabungen erforscht werden konnte. Südöstlich von diesem Tempel des (lokalen) Wettergottes haben die Ausgrabungen einen weiteren zentralen Bau, der eng mit der religiösen Überlieferung Neriks zusammenhängt, identifizieren können: die so genannte »geliebte Quelle von Nerik« (KUB 36.90 Rs. 32f.). In diese Quelle zieht sich der Wettergott zurück, als er seiner Stadt zürnt, so dass die Fruchtbarkeit in der Stadt erlischt, bis er wieder – aufgrund von Evokationen und Gebeten – aus dieser Quelle, die zugleich einen Zugang zur Unterwelt darstellt, in die Stadt zurückkehrt.46 Die bei den Ausgrabungen entdeckte unterirdische Quellkammer47 liegt rund 9 Meter unter dem Fußbodenniveau, wobei eine Treppe zu dieser Kammer hinabführt, an deren einer Seite sich ein Quellbecken befindet. Das »Quellheiligtum« wurde um ca. 1600 errichtet und zwischen 1520 und 1420 durch eine Erneuerung des Bodenpflasters und den Einbau von hölzernen Installationen für den Wasserlauf erneuert, danach jedoch bis in nachhethitische Zeit nicht mehr verwendet. Diese »Quelle von Nerik« korrespondiert somit zeitlich gut mit der Bedeutung Neriks als Kultzentrum in althethitischer Zeit.
Über die detaillierte religiöse Situation in Nerik in althethitischer Zeit sind wir nicht besonders gut informiert. Der Priester (SANGA) des Wettergottes von Nerik sowie der »Mann des Wettergottes«48 waren bereits in althethitischer Zeit die zentralen Kultfunktionäre in der Kultstadt. Aus der Textüberlieferung des Illuyanka-Mythos scheint aber auch hervorzugehen, dass die GUDU12-Priesterschaft in Nerik versucht hat, die eigene Position in der Hierarchie zu verbessern. Der Illuyanka-Mythos spielt dabei auch im Zusammenhang mit dem purulli-Fest eine zentrale Rolle für Nerik, da der Mythos dafür die »Festlegende« bildet. Der GUDU12-Priester leitet den Text damit ein, dass er nicht nur seinen Text als »Angelegenheit des purulli-Festes« (KBo 3.7 i 3: purulliyaš uttar) erklärt, sondern auch betont, dass man das purulli-Fest feiert, sobald das Land im Frühling wieder gedeiht. Danach erzählt er den Mythos des Kampfes des Wettergottes gegen Illuyanka. Obwohl alle Textexemplare des Mythos nur als junge Abschriften überliefert sind, dürfte der Text selbst zweifellos in die althethitische Zeit zurückgehen, worauf sprachliche Indizien des Textes hinweisen.49 Interessant ist dabei, dass der Mythos in zwei – recht verschiedenen – Varianten überliefert ist, auch wenn in groben Zügen dieselbe Geschichte erzählt wird: Der Wettergott wird zunächst von Illuyanka besiegt, worauf er sich nach menschlicher Hilfe umsieht. In der ersten Version bittet Inar den Menschen Ḫupašiya um Hilfe im Kampf, in der zweiten Version heiratet der besiegte Wettergott die Tochter eines armen Mannes, wobei der Sohn aus dieser Verbindung der Helfer im Kampf gegen Illuyanka wird. In diesem zweiten Kampf des Wettergottes gegen Illuyanka gelingt es ihm, seinen Widersacher zu überwinden. Fragt man nach der Herkunft dieses Mythos, so zeigt sich, dass er eng mit der Kultstadt Nerik verbunden ist, zumal er nicht nur von Kella, dem Priester des Wettergottes von Nerik, rezitiert wird, sondern auch das mit dem Mythos verbundene purulli-Fest in dieser Stadt gefeiert wird. Daraus ergibt sich, dass die hier vorliegende mythologische Überlieferung eine alteingesessene anatolische Tradition widerspiegelt, die – wie der Wettergott der Stadt Nerik – mit dem hattischen Milieu zu verbinden ist. Die erste Version des Mythos erweckt den Eindruck eines höheren Alters. Beide Erzählversionen leiten am Ende des Mythos zum Fest über.50 In der ersten Version übergibt Inar ihr Haus dem König und seither feiert man das purulli-Fest (KBo 3.7 ii 18f.). Anschließend ist davon die Rede, dass der Berg Zaliyanu der Stadt Nerik Regen gibt. Wie dieser Abschnitt genau mit dem vorher erzählten Mythos zusammenhängt, ist unklar, da danach eine Textlücke das Verständnis erschwert. Als der Text wieder einsetzt, wird die zweite Version des Mythos erzählt. Am Ende ist von der Rolle des GUDU12-Priesters die Rede, und es wird die Rangordnung verschiedener Götter im Verhältnis zum Wettergott festgelegt. Dabei spielt auch eine »Kultreise« der Götter nach Nerik eine Rolle. Aus weiteren Texten, die Teile des Festverlaufs beschreiben, ist ferner sichtbar, dass auch der König51 einzelne Orte im Rahmen des Festes besucht und kultische Aktivitäten in Nerik durchführt.52 All dies zeigt die vollständige Einbindung der hattischen Kultstadt Nerik in den Staatskult.