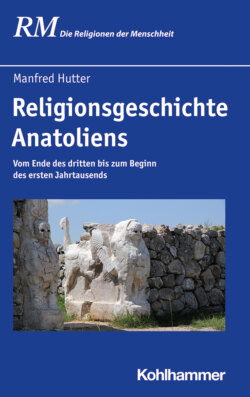Читать книгу Religionsgeschichte Anatoliens - Manfred Hutter - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3.3 Stelen und »naturbezogene« Kultplätze
ОглавлениеEbenfalls zu Plätzen der Kultausübung gehören Stelen, die im Hethitischen als NA4ḫuwaši- oder mit dem Logogramm NA4ZI.KIN bezeichnet werden.98 Diese (pseudo-)sumerographische Schreibweise kann als Wiedergabe des syrischen Wortes sikkannum gelten, worin der Aspekt des Wohnens der Gottheit anklingt (vgl. die semitische Verbalwurzel skn »wohnen«). Das hethitische Wort ḫuwaši- ist etymologisch möglicherweise mit dem luwischen Wortfeld der Wurzel ḫwid-99 »leben, lebendig sein« zu verbinden, d. h. in einer solchen Stele »lebt« eine Gottheit. Man kann Stelen als anikonische Götterdarstellungen bezeichnen, die in einem Tempel als »Kultbild« aufgestellt sein können. Typischer ist aber die Funktion solcher Stelen als Freiluftheiligtümer, die sich oft außerhalb von Siedlungen befinden.100 Manche Texte sprechen davon, dass man in ein ḫuwaši- hineingeht, was auf eine Verbindung zwischen einer ḫuwaši-Stele und einem abgegrenzten Areal verweist, das insgesamt als Ort der Anwesenheit einer Gottheit verstanden wird. Die »Naturverbundenheit« dieser ḫuwaši-Anlagen zeigt sich auch daran, dass diese häufig mit Quellen, Bäumen oder besonderen Felsformationen verbunden sind. Bezüglich der Form und der Größe lassen die Texte erkennen, dass die Größe variabel war, da kleine Stelen auf einen Altar gestellt werden konnten, manche jedoch die Größe eines Menschen haben konnten. Anscheinend konnten mehrere Stelen einen »Stelenbezirk« bilden, in den man wie in einen (offenen) Raum hineingehen konnte.
Stelen als Orte der kultischen Praxis waren sicher bereits in althethitischer Zeit bekannt, wie z. B. indirekt aus der mittelhethitischen Instruktion von Arnuwanda I. an die Grenzkommandeure aus der »Vor-Großreichszeit« hervorgeht, denen folgende Dienstanweisung gegeben wird:101
(Die alte Kultstele im Ort), um die man sich nicht kümmert, um die sollt ihr euch jetzt kümmern. Man soll sie aufrichten. Und die Opfer, die es früher dafür gab, soll man geben.
Die Aussage ist in mehrfacher Hinsicht interessant, da der Zeitbezug wohl weit in die Zeit vor Arnuwanda I. zurückweist, was bestätigt, dass Stelen als Fokussierungspunkte kultischer Handlungen seit der hethitischen Frühzeit zum religiösen Repertoire gehörten. Zugleich zeigt diese Dienstanweisung aber auch, dass diese Kulte nicht nur auf die Hauptstadt beschränkt waren, da Arnuwandas Instruktion sich auf Beamte in der Provinz bezieht – und neben der Restaurierung der Stele auch die Durchführung anderer Kulthandlungen durch die Priester zum Thema hat.102 Dass solche Stelen und Stelenbezirke wichtige Plätze der Kultausübung waren, zeigt ihre mehrfache Nennung in Festritualen, wenn es heißt, dass der König zur Stele(nanlage) einer Gottheit geht. Außerhalb der im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts errichteten Stadt Šarišša lag auf rund 1.900 Metern Seehöhe ein solches ḫuwaši-Heiligtum des Wettergottes neben dem Šuppitaššu-Teich, wobei diese archäologische Entdeckung mit textlichen Hinweisen über Feste in dieser Stadt korreliert.103 Die Lage dieses Heiligtums scheint auf den Großen Tempel des Wettergottes, das so genannte Gebäude C, in der Stadt ausgerichtet gewesen zu sein. Die erhöhte Lage auf einem Berg und neben dem Teich, der aus einer Einsturzdoline entstanden ist, weist auf einen anderen Aspekt »kultischer Orte« der Hethiter hin, da eben natürliche Gegebenheiten wie Quellen, Teiche oder Berge als solche angesehen werden konnten. Auch wenn solche Kultplätze kaum nachweisbar sind, falls es dort – anders als beim eben genannten Beispiel aus Šarišša – keine festen Bauinstallationen gibt, werden sie in Texten mehrfach als Kultplätze genannt. Die vorhin zitierte Instruktion von Arnuwanda I. setzt nach der Aufforderung, die Stelen zu restaurieren, unmittelbar mit dem Auftrag fort, auch die Quellen hinter der Stadt zu besuchen und die Rituale dort durchzuführen; anschließend werden auch die Opfer für die Berge (in der Umgebung der Stadt) genannt (KUB 13.12 iii 13–19).
Somit bot sich für die Hethiter ein weites räumliches Spektrum, wo kultische Handlungen ausgeführt werden konnten – von monumentalen Tempeln über lokalen Schreinen und Kulträumen im Palastbereich, wie etwa dem ḫalentu-Raum bzw. -Gebäude, bis hin zu »Kultanlagen« im Freien an Quellen, Teichen oder Bergen. Manche dieser Anlagen dürften nur temporär gewesen sein, so dass sie nicht archäologisch, sondern lediglich textlich nachweisbar sind. Genauso zeigen die Kultutensilien, die in den Bauwerken in İnandık und Hüseyindede gefunden wurden, dass Kulthandlungen auch an Orten, die nicht exklusiv der Durchführung des Kultes dienten, stattgefunden haben.