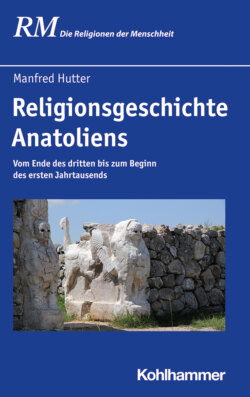Читать книгу Religionsgeschichte Anatoliens - Manfred Hutter - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.2 Einige hattische Gottheiten
ОглавлениеIn der althethitischen Zeit gibt es keine »kanonischen« Götterlisten, die eine genormte Reihenfolge von Götterhierarchien festlegen würden. Allerdings lässt sich anhand von Opferlisten in Festen erkennen, welche Götter innerhalb eines Kultes »wichtig« waren, so dass man daraus zumindest indirekt deren große Wertschätzung in althethitischer Zeit ableiten kann. Dass die Sonnengöttin und der Wettergott die Spitzenposition innehatten, kam schon zur Sprache, so dass hier nur noch andere hattische Götter zu nennen sind. Zu Beginn einer Opferrunde beim KI.LAM-Fest betritt der König den Tempel der Sonnengöttin, um dort Gottheiten durch Opfer und Musik zu verehren. Obwohl der Text nicht vollständig erhalten ist, lassen sich 14 Namen feststellen:35 [Sonnengöttin, Mezzulla], Wettergott, Wašezzili, Inar, [Ḫabantali], Herrin des Palastes, Zababa, Tahampiwu, Waḫzašu, Kataḫḫi, [Telipinu], Ḫašammi, Ḫaratši. Im weiteren Verlauf dieser Opferzeremonie findet ein detaillierter beschriebenes Trinkzeremoniell mit Musikbegleitung für die Gottheiten im Tempel statt, jedoch sind die dabei aufgeführten Götter nicht völlig identisch mit den vorhin Genannten, da wir folgende Aufzählung finden:36 [Sonnengöttin, Mezzulla], Wettergott, Wašezzili, Inar, Ḫabantali, Mondgott, Kunzanišu, Ḫulla, Telipinu, Zababa, (vergöttlichter) Tag, Galzu, Zaiu. Aus verschiedenen, auch junghethitischen Texten ließen sich noch weitere Götternamen, die im Rahmen dieses Festabschnittes mit einem Trinkzeremoniell verehrt werden, hinzufügen.37 Vergleicht man dabei die Liste zu Beginn des Festabschnittes und die (deutlich umfangreichere) Liste in den detaillierten Angaben zum Trinkzeremoniell, so sind die weitgehenden Übereinstimmungen vor allem zu Beginn des Zeremoniells zu finden. Daraus kann man auf die Bedeutung dieser Gottheiten schließen, während im weiteren Festverlauf auch unbedeutendere, vielleicht nur lokale Gottheiten in die Kulthandlung einbezogen werden.
Einige der in diesen Aufzählungen erwähnten Götter kamen vorhin schon zur Sprache, wobei viele hattische Götter hauptsächlich in Texten zu Festen, die aus dem hattischen Milieu stammen, belegt sind – meist in relativ stereotyper Formulierung, so dass es schwierig ist, detaillierte Aussagen über deren Rolle und Aufgaben innerhalb der religiösen Praxis zu machen. Ebenfalls erschwert wird die präzise Bestimmung der Aufgaben mancher hattischer Gottheiten durch den bislang nur unzureichenden Kenntnisstand über hattische Wortbedeutungen. Franca Pecchioli Daddi hat – als wichtigen Schritt in der Deutung – verschiedene Götternamen analysiert.38 Dabei konnte sie einerseits zeigen, dass in manchen Fällen individuelle Namen – z. B. Taru oder Inar – vorliegen, in anderen Fällen jedoch Substantive als Göttertitel bzw. Götternamen verwendet werden. Dazu gehören z. B. Kataḫḫa (»die Königin«), Tappinu (»die Tochter«) oder Zintuḫi (»die Enkelin«). In wieder anderen Fällen ist der Gottesname oder Titel eine Ableitung von Ortsnamen, so z. B. Ariniddi für die Sonnengöttin von Arinna oder Ziplantil für den (lokalen) Wettergott von Ziplanta. Andere Namen stellen Komposita dar, z. B. Wurunkatte (»der König des Landes«) oder Wurunšemu (»die *[se]mu des Landes«). Wieder andere Namen sind Komposita aus einem Adjektiv und einem Substantiv, z. B. Telipinu (»der erhabene/große Sohn«), Kataḫzipuri (»die Königin der Erde«) oder Tetešḫapi (»die erhabene Göttin«). Als besondere Gruppe nennt Pecchioli Daddi schließlich noch jene Namen, die mit dem Suffix -šu gebildet werden.39 Diese letztere Gruppe scheint eng zusammengehörige Götter zu umfassen, die vor allem in Festen der althethitischen Zeit im Norden Anatoliens verehrt wurden, wobei Teile dieser Festtraditionen (und die Götter) bis in die Großreichszeit in den beiden großen Jahreszeitfesten im Frühling (AN.TAḪ.ŠUM-Fest) und im Herbst (nuntarriyašḫa-Fest) weiter rezipiert wurden.
Fasst man die Rolle der hattischen Götter zusammen, so prägen sie das Pantheon der althethitischen Zeit sowohl des Staatskults als auch der lokalen Kulte. Wahrscheinlich darf man annehmen, dass diese Götter auch in der alltäglichen Religionsausübung der Bevölkerung verehrt wurden, die zum Großteil in der althethitischen Zeit in Ḫattuša hattisch gesprochen hat bzw. in der »politischen« Oberschicht wohl hattisch-hethitisch zweisprachig war. »Fremde« Götter – außer den palaischen Göttern, auf die in einem späteren Abschnitt noch eingegangen wird – spielen im »Pantheon« der althethitischen Zeit keine Rolle.