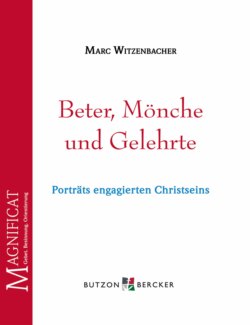Читать книгу Beter, Mönche und Gelehrte - Marc Witzenbacher - Страница 15
Christian Führer: Die Revolution, die aus der Kirche kam
ОглавлениеVertrauen bzw. Glauben und Glaubwürdigkeit heißen die entscheidenden Faktoren unseres Handelns, plus Fantasie und Humor.“ Das schrieb Christian Führer, Pfarrer an der Leipziger Nikolaikirche in den entscheidenden Jahren der friedlichen Revolution. Der nicht gerade groß gewachsene, stets mit einer lässigen, ärmellosen Jeansjacke bekleidete grauhaarige Mann ist rein äußerlich keine wichtige Erscheinung der Weltgeschichte. Sein leises Reden kommt unscheinbar daher, verrät aber eine unerschütterliche Beharrlichkeit. Und eine beruhigende wie gelassene Sicherheit. Darüber, was er denkt und wie er handelt. Zahlreiche Preise hat Führer in seinem Leben schon erhalten. Doch die größte Auszeichnung ist und bleibt für ihn die Freiheit. Das Wahrwerden der friedlich eingeleiteten und durchgeführten Revolution in der ehemaligen DDR, an deren Ende – oder sagen wir besser: Wende – die Einheit des deutschen Volkes stand.
Nicht politisches Kalkül oder aufrührerisches Gedankengut: Grenzen zu öffnen, das erreichte Führer schlicht mit den Worten der Heiligen Schrift. Am Beispiel Jesu, an den Worten der Bergpredigt richteten sich die Revolutionäre aus. Das überzeugte auch diejenigen, für die Jesus nur ein Hirngespinst und das Christentum ein lästiges Überbleibsel aus dem Kapitalismus war. Da ging es nicht um ferne Heilige, in Stein gemeißelt und legendenumrankt. Es waren die Leute bei den Friedensgebeten in der Nikolaikirche und später die Demonstranten auf der Straße, welche die Seligkeit ererben sollten. Davon war Christian Führer überzeugt, dafür lebte und dafür betete er – gemeinsam mit tausenden von Menschen.
Christian Führer wuchs in einem sächsischen Pfarrhaushalt auf. Das prägte ihn, er entschied sich frühzeitig für ein Theologiestudium. Nach dem Studium an der Karl-Marx-Universität in Leipzig war Führer zunächst in Lastau und Colditz, zwei kleinen Orten zwischen Leipzig und Chemnitz, als Gemeindepfarrer tätig. Die zunehmende Kirchenfeindlichkeit der DDR, die in Leipzig mit der Sprengung der Universitätskirche im Mai 1968 ihren traurigen Höhepunkt fand, untermauerte seine kritische Position dem atheistischen Staat gegenüber. Die Proteste gegen die Sprengung der Kirche bezeichnet Führer als „erste große öffentliche Kundgebung gegen die Willkür des Staates seit den Ereignissen um den 17. Juni 1953“. Führer sieht einen inneren Zusammenhang zwischen dem Protest von 1968 und den Ereignissen im Herbst 1989.
1980 nahm er den Dienst als Pfarrer an der Nikolaikirche in Leipzig auf. Dort engagierte er sich verstärkt für Friedensfragen aller Art und übernahm das Modell der Friedensdekade sowie der wöchentlichen Friedensgebete, bei denen Themen wie Frieden und Abrüstung im Mittelpunkt standen. Neben seiner Arbeit für die Kirche setzte er sich für die Andersdenkenden in der DDR ein, die wegen ihrer politischen Überzeugungen in Bedrängnis gerieten. Gemäß dem Motto der Nikolaikirche „Offen für alle“ fanden dort für den Staat und die Kirche ungewöhnliche Veranstaltungen statt: etwa ein Konzert der Band „Wutanfall“ oder die zahlreichen Gespräche über Wehrdienstverweigerung und Ausreise. Führer konnte sich der ständigen Beobachtung durch die Staatssicherheit, aber auch der Kirchenleitung sicher sein. Führer plädierte für eine generelle Öffnung der Kirche für Andersdenkende, für Unbequeme und Ausgegrenzte. Er wollte die Grenzen in den Köpfen öffnen und machte dafür die Türen seiner Kirche auf.
Konflikte blieben dabei nicht aus. Auch und gerade mit den beherbergten Gruppen. 1988 geriet Führer in eine Auseinandersetzung mit den Ausreisewilligen und den oppositionellen Basisgruppen. Die Kirchenleitung nahm den Akteuren die freie Gestaltung der Friedensgebete wieder aus der Hand, um eine politische Radikalisierung der Friedensgebete zu verhindern. Dennoch bemühte sich Führer um die Rückkehr der Basisgruppen in die Nikolaikirche, die man praktisch vor die Tür gesetzt hatte und die ihre Diskussionen nun draußen auf dem Kirchhof und auf der Straße fortsetzten. Die wöchentlichen Friedensgebete in der Nikolaikirche florierten allerdings weiter. Immer mehr Menschen kamen. Die Organisation der Friedensgebete hatte Christoph Wonneberger übernommen. Er verfasste auch mit den Mitgliedern der in seiner Lukaskirchgemeinde tätigen Bürgerrechtsgruppen einen Appell, der in der Nacht zum 9. Oktober mühsam vervielfältigt und am „Tag der Entscheidung“ an alle Interessierten verteilt wurde. Darin tauchte schon das vielfach skandierte „Wir sind ein Volk“ auf.
Nach der Wende wurde Christian Führer von den Medien zum Gesicht der Friedlichen Revolution aufgebaut. Immer wieder wehrte sich der bescheidene Pfarrer gegen eine solche Heldenrolle. Er sei Begleiter und Betreuer gewesen, nicht mehr und nicht weniger. Führer will weiter an die Friedliche Revolution erinnern, auch nachdem er im März 2008 als Pfarrer in den Ruhestand trat. Dies soll nun durch die Stiftung „Friedliche Revolution“ gelingen. Hauptanliegen der Stiftung, zu dessen Vorstand Führer zählt, ist es, die Idee von damals in die Zukunft zu tragen. Es geht um Bürgermut und demokratisches Engagement. Die Friedliche Revolution muss und sie wird weitergehen. Das ist auch eine Überzeugung des Grenzöffners Christian Führer.