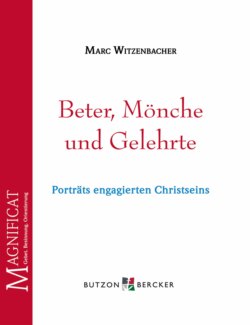Читать книгу Beter, Mönche und Gelehrte - Marc Witzenbacher - Страница 19
Der feinsinnige Doktor: Duns Scotus
ОглавлениеWas Thomas von Aquin für den Orden der Dominikaner, ist Johannes Duns Scotus für die Franziskaner. Beide Theologen haben ihrem Orden, und damit der ganzen Christenheit, viel Stoff zum Nachdenken hinterlassen. Sie gaben den im 13. Jahrhundert entstehenden Universitäten wichtige Impulse. Was man an der Universität des Mittelalters lernte, war das Disputieren: mit einem anderen oder gegen einen anderen um die Wahrheit ringen. Diese Kunst förderten die Dominikaner und Franziskaner in ihren Schulen, besonders in Paris und Köln. Aber nicht nur mit Gegnern des Christentums oder „Ketzern“ wurden teilweise erbitterte Wortgefechte geführt, sondern auch innerhalb der Orden kam es zu Konflikten.
Bei den Franziskanern war es die Frage nach der Armut Christi und inwieweit die Kirche Jesus Christus in seiner Armut folgen müsse. Dieser Konflikt beschwor mehrfach kirchenpolitische Turbulenzen herauf, und er brachte den Orden mehrfach an den Rand der Spaltung. „Dürfen wir überhaupt Wissenschaft betreiben, wenn dafür doch der Besitz von Büchern notwendig ist?“ oder „Ist Jesus wirklich besitzlos gewesen?“, das waren die Fragen, die die Gemüter der Scholastiker damals heftig erhitzten.
Scholastik ist aber alles andere als wirklichkeitsferne Begriffsspalterei. Sie schult vielmehr die Dialog- und Argumentationsfähigkeit. Schließlich könnte sich auch in der Position des Gegners ein Wahrheitskörnchen verbergen. Es war sicherlich die brennende Liebe zur Wahrheit, die auch den großen Lehrer der Franziskaner, Johannes Duns Scotus, bewegte. Geboren wurde er zwischen 1265 und 1270 in Schottland, daher der Beiname Scotus. Studiert hat er in England und Paris. Gelehrt hat er in Oxford, Paris und Köln. Duns Scotus war feinsinnig und subtil, legte auf genaue Unterscheidungen den größten Wert. Bei dem „doctor subtilis“, wie man ihn nannte, fiel kein schnelles Wort, kein voreiliger Entschluss. In jeder Zeile seiner Schriften spürt man eine theologische Fairness, die auch die Meinung des theologischen Gegners vor Augen führt: Letztlich möge der Leser entscheiden. In seinen meistens frei gehaltenen Vorlesungen entwickelte er eine hohe sprachliche Disziplin und lehrte die Studenten die Kunst der Unterscheidung und des eigenen Denkens ohne Besserwisserei. Wo keine Lösung zu finden ist, schreibt Scotus ohne Not auch einfach „nescio“ – „ich weiß es nicht“ – unter eine Disputation.
Die Form des Disputierens und Diskutierens war auch die Grundlage des damaligen Studiums. Vorlesungen waren zur Zeit des Duns Scotus vielmehr offene Dialoge. Man diskutierte vornehmlich eine Sammlung von theologischen Lehrsätzen, die der Italiener Petrus Lombardus zusammengetragen hatte. Dieses Buch, um 1150 entstanden, heißt „Sentenzen“. Duns Scotus setzte sich auch mit den Sentenzen auseinander, er hat sie gleich mehrfach kommentiert. Und es ist bewundernswert, wie er dem vorgegebenen Text immer wieder neue Aspekte abringt. Diese Schule der hohen sprachlichen Disziplin, des Unterscheidens und der offenen Diskussion kann bis heute ein Vorbild der kirchlichen und theologischen Auseinandersetzung sein, die sich oft in Sackgassen theologischer Schlagwörter verrennt.
Scotus ist der Denker der Freiheit Gottes. Er entwickelte eine Theologie, die sich deutlich von der zu seiner Zeit beherrschenden aristotelischen Denkweise distanzierte. Deren Meinung war, Gott ruhe in sich selbst und betrachte gleichsam wie im Spiegel nur seine eigene Vollkommenheit. Für Scotus ist klar: Der biblische Gott lässt sich auf die Menschen ein, er lässt sich in die menschliche Geschichte verwickeln. Seit Augustinus fragte man, warum Gott in der Menschwerdung Jesu Christi sich so ganz und gar auf die Welt eingelassen hat. Und die Antwort darauf war: um die Folgen des Sündenfalls zu beseitigen. Aber diese Antwort genügte Scotus nicht. Die Menschwerdung Gottes sei keine Folge der Sünde, weil dadurch die Freiheit Gottes eingeschränkt werde. Denn sie führt zu der Konsequenz, dass der Sündenfall der Menschen Gott zur Menschwerdung in Jesus Christus veranlasst habe. Auf die Spitze getrieben würde das heißen, die Menschen hätten durch ihre Sünde und ihren Ungehorsam Gott zur Menschwerdung „gezwungen“. Um dieser Folgerung zu entgehen, sucht Scotus nach einer anderen Begründung für die Menschwerdung Gottes: Gott habe sie schon vor dem Sündenfall, schon vor der Erschaffung der Welt vorgesehen. Damit begründete Scotus auch die menschliche Freiheit, Strukturen und Sachzwänge ändern zu können. Nichts muss so sein, wie es ist. Denn alles wurde von Gott geschaffen. Und weil Gott alles erschaffen hat, deswegen sind alle Dinge, alle Geschöpfe kontingent, also nicht notwendig so, wie sie sich gerade darstellen. Auch ich selbst. Ich bin, wie ich bin, ich muss aber nicht so sein, wie ich bin. Ich kann an mir arbeiten. Mit der Lehre von der Kontingenz eröffnete Duns Scotus viele Spielräume in unserer Welt. Dass Dinge zufällige Eigenschaften haben, ist eine Folge der Schöpfung. Und darauf baute Scotus auch die Argumente für die Existenz Gottes auf. Es gibt Kontingenz, weil Gott ist.
Am 8. November 1308 ist Duns Scotus in Köln gestorben. Begraben wurde er in der Kölner Minoritenkirche, in der auch Adolf Kolping seine letzte Ruhestätte fand. Am 20. März 1992 wurde Johannes Duns Scotus von Johannes Paul II. seliggesprochen.