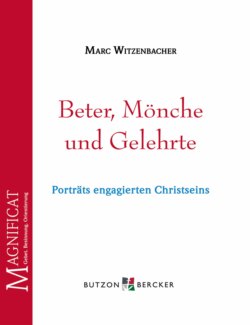Читать книгу Beter, Mönche und Gelehrte - Marc Witzenbacher - Страница 7
Johannes Calvin – Der Schweizer Reformator
ОглавлениеDurch eine plötzliche Bekehrung änderte und unterwarf er sein Herz. Dies sei für ihn der Beginn der Reformation gewesen: eine persönliche Erfahrung und keine theoretische wissenschaftliche Spekulation. So beschreibt der Schweizer Reformator Johannes Calvin den Ursprung der reformatorischen Bewegung. Der Reformator war von Gott in einem unmittelbaren Erleben ergriffen worden. „Ich bringe mein Herz Gott zum Opfer dar“, berichtet er von seinem reformatorischen „Urerlebnis“. Er gab sich von dieser Stunde an selber auf, um Christus nachzufolgen. Jetzt wollte er nicht mehr seinen Willen, sondern den eines anderen tun: „Die Ehre Gottes und das, was zu seinem Reich gehört, muss immer zuerst kommen.“
Calvin wurde im Juli 1509 in Noyon, Frankreich, geboren. Sein Vater, Notar des Domkapitels und Vermögensverwalter des Bischofs von Noyon, bestimmte schon früh seinen Sohn zum Studium der Theologie und versorgte ihn mit zwei Pfründen der Diözese. 1523 begann der junge und begabte Jean, wie er von Hause aus hieß, sein Studium in Paris. Schon damals beschloss er für sich eine ausgesprochen asketische Lebensführung, die ihm schließlich die Gesundheit deutlich gefährdete. 1528 schloss er sein Studium ab und ging anschließend nach Orléans, um dort – ebenfalls auf Wunsch seines Vaters – ein Jurastudium aufzunehmen. 1531 starb der Vater und Calvin ging zurück nach Paris, um seine humanistischen Studien fortzuführen.
Wann Calvin seine reformatorische Bekehrung hatte, ist historisch nicht mehr eindeutig festzumachen, vermutlich in den Jahren 1533 oder 1534. Die Reformation hatte sich schon in zahlreichen Gebieten ausgebreitet. So setzte sich Calvin in Paris intensiv mit Luthers Thesen auseinander und mischte sich in den Streit des Wittenberger Mönchs mit der Kirche ein. Calvin rieb sich sehr an den Thesen Luthers, teilte aber sein Anliegen und gewann ähnliche Einsichten. Außer der Tatsache seiner Bekehrung gewährt der Schweizer Reformator allerdings kaum einen Einblick in sein Privatleben. Ein Zug, der den ganzen calvinistischen Zweig der Reformation prägen sollte. Jedenfalls hatte er sich in diesen Jahren den reformatorischen Ansichten verschrieben und betrachtete sich als „Protestanten“. 1534 verließ er Paris, weil der König den Protestanten drohte, sie zu verhaften und in die Kerker zu stecken. Calvin verzichtete auf seine Pfründe und damit auf ein Einkommen und ging nach Basel, wo er sich unter einem Decknamen dem Studium der Bibel und der Kirchenväter sowie der Schriften Luthers widmete. Dort schrieb er auch schon die ersten Teile seines theologischen Hauptwerkes „Unterricht in christlicher Religion“ (Institutio Christianae Religionis), das 1536 mit einer Vorrede an den französischen König Franz I. in Paris publiziert wurde. Calvin rief den König dazu auf, die neue Sicht des Evangeliums anzunehmen oder zumindest zu tolerieren. Diese erste Fassung war noch ganz an der Form des klassischen lutherischen Katechismus orientiert. Zeit seines Lebens schrieb Calvin an diesem Werk weiter, ergänzte und korrigierte es.
Über Ferrara, wo Calvin bei der Herzogin Renata Unterschlupf fand, Frankreich und Straßburg gelangte der Reformator schließlich nach Genf, wo er, abgesehen von drei Jahren Wirken in Straßburg, bis zu seinem Tode bleiben sollte. Calvin traf dort mit Wilhelm Farel zusammen, der als Evangelist tätig war und in Calvin einen Verbündeten suchte, um die Reformation in Genf einzuführen. Calvin ließ sich überreden und sah darin seine künftige Lebensaufgabe.
So lehrte Calvin in Genf die Heilige Schrift und unterrichtete Kinder und Erwachsene ohne Bezahlung, weitgehend anonym; der Stadtrat nannte ihn einfach „den Franzosen“. Mit den Stadtoberen hatte Calvin auch viel Ärger, schließlich wies man ihn aus. Calvin reiste zunächst nach Basel und fand dann in Straßburg Zuflucht. Drei Jahre musste Calvin im „Exil“ verbringen. In dieser Zeit nahm Calvin an zahlreichen Disputationen und den so genannten Religionsgesprächen teil. Auf diesen Treffen, an denen führende reformatorische Theologen teilnahmen, lernte Calvin die unterschiedlichen kirchlichen Verhältnisse kennen, mit Philipp Melanchthon verband ihn anschließend eine enge Freundschaft. Allerdings konnte auch diese Freundschaft nicht verhindern, dass sich Calvin insbesondere zu Luther und seinen Lehren distanzierte. Calvin entwickelte seine eigene Theologie weiter und suchte dabei weiterhin die Einheit der Kirche, sogar mit den Katholiken verhandelte er weiter, aber für Luther und seine Theologie hatte er meist nur polemische Sätze übrig.
Calvin blieb sein ganzes Leben ein streitbarer Mann. Auch mit den Stadtoberen der Stadt Genf sowie den altkirchlichen Autoritäten geriet Calvin zeitlebens in Konflikt, auch wenn er 1541 auf Wunsch der Genfer Bürgerschaft wieder zurückkehrte. Genf wurde nun Ausgangspunkt der calvinistischen Bewegung, die bald ganz Westeuropa und später sogar Amerika erfasste. Neben der organisatorischen und seelsorglichen Arbeit hielt Calvin unermüdlich Vorlesungen und legte die Bibel aus. Für Calvin ist die ganze Bibel Offenbarung Gottes in seiner souveränen Majestät. Dabei band er seine Auslegungen immer an die kirchliche Praxis und verfiel niemals einem blinden Biblizismus. Reformation ist für Calvin eine Erneuerung der Kirche sowie eine Neuordnung der Gesellschaft. Calvin wandte das Evangelium auf alle Bereiche des Lebens an – Sexualität, Familienleben, Erziehung, Fürsorge – und machte es so zur Grundlage einer neuen Ordnung menschlichen Zusammenlebens. 1564 starb Calvin in Genf.