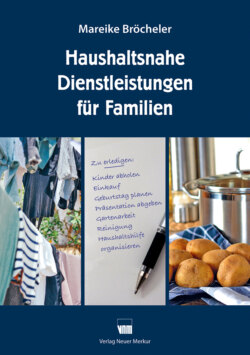Читать книгу Haushaltsnahe Dienstleistungen für Familien - Mareike Bröcheler - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.2 Sozialwissenschaftliche Theorien und Konzepte
ОглавлениеDie Arbeit des Alltags findet sich auch in sozialwissenschaftlichen Theorien und Konzepten wieder, die im Folgenden als Ergänzung zur haushaltswissenschaftlichen Perspektive dienen, um einen möglichst umfassenden analytischen Rahmen für den Gegenstandsbereich des Alltags in Familienhaushalten zu spannen. Die Grundlagen eines Alltagsmanagements werden in umfassender Weise zunächst mit dem Konzept der alltäglichen Lebensführung25 erfasst und beschrieben. Ein Mix aus theoretisch-konzeptionellen Überlegungen (Voß 1991) sowie empirischen Erhebungen und Analysen (Jurczyk, Rerrich 1993a; Projektgruppe „Alltägliche Lebensführung“ 1995) schafft zu Beginn der 1990er Jahre, als Reaktion auf gegenwärtige gesellschaftliche Wandlungstendenzen (insbesondere die zunehmende Flexibilisierung der Erwerbsarbeitssphäre sowie die Veränderung der Lebensentwürfe und -verläufe von Frauen im Spiegel modernisierter Geschlechterrollen), eine neue Perspektive auf den Alltag und das Alltagsmanagement von Individuen. Aus einer subjektorientierten Perspektive erfasst die alltägliche Lebensführung die Art und Weise, wie Individuen tagtäglich in den unterschiedlichsten Settings und Beziehungen ihr Leben führen und ihren Alltag gestalten. Im Gegensatz zum Begriff des Lebensstils, der sich als Forschungsdisziplin parallel entwickelt und ausdifferenziert hat, geht es in diesem Konzept nicht um objektiv sichtbare und der Distinktion dienenden äußere Ausdrucksformen (deutlich etwa durch Konsum, Mode, Musik) oder typische Sinn- und Deutungsmuster, sondern um praktische Gestaltungsweisen, durch die Individuen den jeweiligen Umwelten entsprechend ihre Lebensweise gestalten und dabei diverse Settings des Alltags strukturell und emotional „unter einen Hut bekommen“ müssen. Diese Leistung entspricht der Arbeit des Alltags und ist als eine stetig wachsende Herausforderung anzusehen (vgl. Jurczyk, Rerrich 1993b; Voß 1995; Jurczyk, Voß, Weihrich 2016; Müller 2016).
Das theoretische Konzept der alltäglichen Lebensführung26 lässt sich nach Voß anhand von sieben Eckpunkten umreißen und wird damit in seiner Relevanz für das Alltagsmanagement besser greifbar (vgl. Voß 1995; Jurczyk, Voß, Weihrich 2016):
1) Alltägliche Lebensführung als Tätigkeitszusammenhang: Es geht um die Gesamtheit aller Tätigkeiten, die den Alltag von Personen ausmachen, um eine „alltägliche Synchronie des Lebens“ (Voß 1995: 30). Dies bewirkt eine phasenweise stabile Form des gelebten Alltags, der sich bspw. durch Routinen und Regelmäßigkeiten auszeichnet. Dem zugrunde liegen stets auch Sinnstrukturen, die jedoch nicht im Fokus des Konzeptes stehen – diesen bildet die gelebte Praxis.
2) Alltägliche Lebensführung als Zusammenhang und Form der Alltagstätigkeiten: Die integrative Perspektive ist dabei nicht an der Fülle aller Tätigkeiten interessiert, sondern an den einzelnen Lebensbereichen, die zur Betrachtung ,,dimensional aufgeschlüsselt werden in zeitliche, räumliche, sachliche, soziale, sinnhafte, medial-technische, emotionale oder auch körperliche Aspekte“ (Jurczyk, Voß, Weihrich 2016: 67) und dann als „Arrangement der einzelnen Arrangements“ (Voß 1995: 32) zusammenzuführen sind. Schließlich kann so auch zwischen unterschiedlichen Formen der Lebensführung unterschieden werden.
3) Alltägliche Lebensführung als Handlungssystem der Person: Die Integration aller Tätigkeiten ist die Hauptaufgabe der alltäglichen Lebensführung als Handlungssystem. Sie ist damit das fundamentale und wichtigste System für Individuen als Teil einer Gesellschaft, vermittelt zwischen diesen beiden Sphären. Das Handlungssystem ist unmittelbar an die Person gebunden, also nicht losgelöst zu betrachten oder auf andere Personen übertragbar.
4) Alltägliche Lebensführung als aktive Konstruktion und Leistung: Die Bindung an die Person verweist bereits darauf, dass alltägliche Lebensführung situations- und kontextadäquat „aktiv konstruiert, alltäglich praktiziert und erhalten sowie […] bei Bedarf auch modifiziert werden muss“ (Jurczyk, Voß, Weihrich 2016: 69; Herv. i. Orig.). Es handelt sich dabei um ein strukturiertes Verfahren zur Alltagsgestaltung, welches reflexiv und unbewusst angewandt wird. Dies geschieht zwar in Abhängigkeit der Lebenslage von Personen, wird jedoch in aktiver Auseinandersetzung und daher individuell verschieden ausgearbeitet und lässt einen stabilen Bezugsrahmen entstehen.
5) Die Eigenlogik des Systems alltägliche Lebensführung: Trotz des Charakters einer aktiven Herstellungsleistung ist alltägliche Lebensführung überwiegend Resultat situativer Entscheidungen, die nur begrenzt reflektiert werden. So ergibt sich eine „funktionale wie strukturelle Eigenständigkeit“ (Jurczyk, Voß, Weihrich 2016: 69), eine innere Eigenlogik des Systems.
6) Die nicht-deterministische Vergesellschaftung alltäglicher Lebensführung: Auch als subjektbezogene Herstellungsleistung sind gesellschaftliche Rahmenbedingungen für die alltägliche Lebensführungvon Personen relevant, beeinflussen sie in ihrer Art und Weise. Neben objektiven Lebenslagen wirken auch soziokulturelle Einflüsse (Deutungsmuster, Standards oder Ideologien) sowie Lebens- und Familienformen hier prägend. So verschränken sie sich etwa in Beziehungen oder in privaten Haushalten miteinander, in denen Lebensführung kooperativ entsteht und erhalten wird.
7) Alltägliche Lebensführung als System sui generis: Schließlich ist die alltägliche Lebensführung als System sui generis zu verstehen, welches als Vermittler zwischen Individuum und Gesellschaft dient. Das Verhältnis zwischen diesen Sphären ist durch „Form und Logik“ (Jurczyk, Voß, Weihrich 2016: 72) dieses Systems geprägt, das in jeder einzelnen Tätigkeit von Personen dieses System der Alltagsgestaltung zum Tragen kommt.
Bei allen Unterschieden in der alltäglichen Lebensführung zwischen Individuen lassen sich auch übergreifende Tendenzen analysieren.27 Diese ergeben sich vor dem Hintergrund der zeitdiagnostischen Analyse, die vier wesentliche Modernisierungstendenzen für die alltägliche Lebensführung hervorbringt. Erstens geht es um eine Rationalisierung der Lebensführung28 für die sich u. a. Routinen als besonders bedeutsam erweisen, da sie Kontinuität sichern können und „zur Entlastung von permanentem Entscheidungsdruck“ (Jurczyk, Voß, Weihrich 2016: 63) beitragen. Für den kompetenten Umgang mit unsicheren und flexibilisierten Lebensbedingungen ist Vertrauen zudem eine wichtige Ressource der Lebensführung, die es erlaubt, auch ohne allumfassendes Durchplanen den Alltag kompetent zu gestalten. Zweitens zeigt sich eine Individualisierung der Lebensführung, für die autonome Verhaltensweisen der „Selbststeuerung und Selbstvergesellschaftung“ (Jurczyk, Voß, Weihrich 2016: 63 f.) bedeutsam sind. Hierfür braucht es persönliche und soziale Kompetenzen des Einzelnen, gleichzeitig besteht die intersektionelle Wirksamkeit von Kategorien sozialer Ungleichheit fort. Drittens entwickelt sich eine Egalisierung der Geschlechterverhältnisse, die eine Verringerung traditioneller Geschlechterhierarchien bewirkt. Gleichzeitig jedoch offenbaren sich neue Ungleichheiten, etwa durch die konsistente Verantwortungszuschreibung unbezahlter Arbeit an die weibliche Hälfte der Gesellschaft. Die Wirksamkeit dieser Dichotomie bedeutet in der Folge Herausforderungen für egalitäre Lebensführungsmuster – für Frauen ebenso wie Männer. Viertens zeichnet sich eine Verarbeitlichung des Alltags ab, die von Individuen heute verlangt, Grenzen zu ziehen, um entgrenzten Strukturen entgegenzuwirken. So ist die Arbeit des Alltags zunehmend von „vermehrtem Synchronisations-, Koordinations- und Planungsaufwand aller Beteiligten“ (Jurczyk, Voß, Weihrich 2016: 65) geprägt.
Für den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit interessant ist zudem der aus dem Konzept der alltäglichen Lebensführung hervorgegangene konzeptionelle Ansatz der familialen Lebensführung29 die „als Prozess der alltäglichen Verschränkung individueller Lebensführungen innerhalb der Familie“ (Jürgens 2001: 37) zu verstehen ist. Neben der alltäglichen Lebensführung der Individuen (die Erwachsenen, hier also Eltern30) wird hierzu auf einer zweiten Ebene die intersubjektiv aktiv konstruierte Verschränkung dieser Lebensführungen zu einer gemeinsamen, familialen Lebensführung analysiert. Diese Verschränkung zeigt sich inhaltlich (Vorstellungen über die Art der Lebensführung), räumlich (Streben nach einem gemeinsamen Wohnort), zeitlich (Abstimmung der Zeitstrukturen von Familienmitgliedern und Institutionen), sozial (Aufbau gemeinsamer Netzwerke) sowie emotional (Liebe als wesentliches Bindeglied innerfamiliärer Beziehungen, aber auch emotionale Bedeutsamkeit der familialen Lebensführung als solche). In all diesen Dimensionen wird schließlich der Arbeitscharakter der familialen Lebensführung deutlich, da es jeweils aktiver Herstellungsleistungen durch die Familienmitglieder bedarf, um diese Verschränkungen herzustellen (vgl. Jürgens 2001). Die bereits im Konzept der alltäglichen Lebensführung deutlich gewordene Bedeutsamkeil der Strukturkategorie Geschlecht wird hier ebenfalls in allen Dimensionen sichtbar. So sind es in verschiedenen Untersuchungen jeweils die Frauen bzw. Mütter, die – so wird es für unterschiedliche Lebenslagen und familiale Lebensformen deutlich – in größerem Maße als die Männer bzw. Väter zur Herstellung eines Familienalltags beitragen, indem sie tagtäglich die unterschiedlichen Puzzleteile zusammenfügen und versuchen, sie unter dem Dach des Familienlebens zusammenzuhalten. Nicht selten ist dies eine Herausforderung, die sich nur durch das Zurückschrauben eigener Bedürfnisse (privat wie beruflich), das Aushalten von Unstimmigkeiten und Konflikten und damit unter großer Belastung bewältigen lässt (vgl. Rerrich 1993; Rerrich 1994; Jürgens 2001). Ebenso relevant für eine gelungene familiale Lebensführung ist die Unterstützung durch andere Frauen, seien es unbezahlte Helferinnen aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis oder bezahlte Helferinnen als Au-Pairs, Tagesmütter oder Haushaltshilfen. Sie zeugen von einer neuen Arbeitsteilung, nicht innerhalb von Part-nerschaften, sondern unter Frauen, entlang der sozialen Ungleichheitsdimensionen von sozialer Herkunft, Bildung, Ethnizität und Nationalität – wie von Hochschild (2000) als „global care chains“ bezeichnet und beschrieben – regelmäßig auch über Landesgrenzen hinweg (vgl. Rerrich 1993, 2002; Hochschild 2000; siehe Kapitel 5).
In den Ietzten Jahren hat sich zudem der Begriff des doing family auch in der deutschsprachigen Familienforschung verbreitet. Dieser schließt an die konstruktivistisch angelegten Ausführungen der alltäglichen Lebensführung an, arbeitet sie systematischer (anhand einzelner Dimensionen) auf und begründet sie zeitdiagnostisch (vgl. Jurczyk 2018b). Das Konzept doing family31 stellt eine alltagsnahe, praxeologische Forschungsperspektive32 dar, die insbesondere an das sozialkonstruktivistisch begründete Konzept des doing gender nach West und Zimmerman (1987) oder auch an kulturwissenschaftliche Ansätze anknüpft. Es fokussiert die Alltagspraktiken von Familien und fragt, was Familien und deren Mitglieder konkret tun und wie sie es schaffen, einen gemeinsamen Alltag und eine Identität als Familie herzustellen. Diese erscheint vor allem vor dem als ,,doppelte Entgren-zung“ (Jurczyk, Schier, Szymenderski et al. 2009) beschriebenen Phänomen sich verändernder Alltagswelten in Erwerb und Familie33 als forschungsrelevant (vgl.Jurczyk 2014, 2018a, 2018b).
Zentral für dieses Verständnis von Familie ist zum einen die „sinnhafte Kon-struktion eines gemeinschaftlichen Beziehungsgefüges“ (Jurczyk 2018a: 147), das heißt Aktivitäten, die Familien sich selbst als Familie erkennen und (nach innen wie außen) darstellen lassen. Hierzu dienen vor allem symbolisch aufgeladene Aktivitäten, wie etwa die gemeinsame Familienmahlzeit oder generell die bewusste Organisation von bestimmten Zeitfenstern für Familie und Familienaktivitäten (vgl. Rerrich 1993; Barlösius 2016; Jurczyk 2018b). Neben dieser klar sozialkonstruktivistischen Grundform von doing family ist auch das „Vereinbarkeits- und Balancemanagement“ (Jurczyk 2018a: 146) als tägliche Herstellungsleistung für einen gemeinsamen Familienalltag zu sehen, um trotz verschiedenster Zeit-strukturen und -logiken eine Ko-Präsenz von (allen) Familienmitgliedern zu ermöglichen.34 Letztlich ist Care- bzw. Sorgearbeit für familiale Lebensführungen und doing family von elementarer Bedeutung: 35
„Denn Familie ist ein (multilokales) Netzwerk besonderer Art, das zentriert ist um Care, d. h. um verantwortliche, emotionsgeleitete persönliche Sorge zwischen Generationen und Geschlechtern, die – teilweise existenziell – aufeinander angewiesen sind. […] So verstanden meint Familie als Herstellungsleistung hier die Herstellung fürsorglicher persönlicher Beziehungen, die sich weder auf verheiratete Eltern und ihre Kinder noch auf das Zusammenleben in einem Haushalt beschränken.“ (Jurczyk 2014: 66)
Ein gemeinsames Leben, mit persönlichen Beziehungen, gemeinsamer Zeit in räumlicher Nähe und die Möglichkeit zur Wahrnehmung von Sorgearbeit sind somit wesentliches Ziel von familialer Lebensführung und Inhalt der aktiv zu erbringenden Herstellungsleistungen. Alltagsmanagement als Haushaltsführung und Lebensführung bedeutet letztlich ein Austarieren von unterschiedlichen Di-mensionen des Alltags und der Alltagsstrukturen von Haushaltsmitgliedern und ist dabei zugleich individuelle Konstruktionsleistung. Dieses Verständnis findet sich auch bei Kaufmanns Charakterisierung eines Familienhaushaltes wieder:
„Der Ausdruck sollte beim Wort genommen werden. Denn ,den Haushalt machen‘ bedeutet nicht einfach nur, Staub zu wischen und die Gegenstände an ihren richtigen Platz zu rücken. Durch diese Routinehandgriffe wird Tag für Tag nichts anderes als die Existenzgrundlage der häuslichen Gemeinschaft geschaffen, die ohne diese Handgriffe nichts wäre. ,Den Haushalt machen‘ (im sächlichen Sinne) bedeutet auch, den Haushalt (im personalen Sinne) zu machen, also die Familie zu konstruieren.“ (Kaufmann 1999: 68)
Die Autor/innen des Konzeptes zur alltäglichen Lebensführung resümieren schließlich, dass der Arbeitsbegriff „im Zuge der Modernisierung der Moderne“ (Jurczyk, Voß, Weihrich 2016: 65) nicht mehr allein für den Bereich der Er-werbsarbeit, sondern zunehmend auch für die Sphäre des Privaten gilt. Das Spektrum der unbezahlten Arbeit, die Tätigkeiten der sachbezogenen Hausarbeit, Betreuungs- und Pflegeaufgaben – oder kurz: Sorgearbeit – umfasst, impliziert den Anspruch an deren umfassende Bewältigung (vgl. Jurczyk, Voß, Weihrich 2016). Gleiches gilt damit für die Aufgaben der familialen Lebensführung.