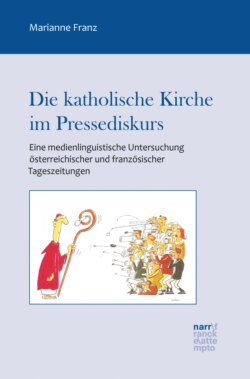Читать книгу Die katholische Kirche im Pressediskurs - Marianne Franz - Страница 13
2.2 Massenkommunikation
ОглавлениеIm untrennbaren Zusammenhang mit (Massen-)Medien steht die sogenannte Massenkommunikation. In beiden Komposita (Massen-Kommunikation und Massen-Medien) drückt „Masse“ aus, dass ein disperses Publikum angesprochen wird. Da die Tagespresse ein Massenmedium ist und daher Massenkommunikation „betreibt“, soll hier kurz auf die Besonderheiten der Massenkommunikation (vor allem im Vergleich zur interpersonalen – privaten – Kommunikation) eingegangen werden.
Maletzke versuchte 1963 eine Definition, die bis heute weit verbreitet ist (zitiert nach Hickethier 2003: 25):
„Unter Massenkommunikation verstehen wir jene Form der Kommunikation, bei der Aussagen öffentlich (also ohne begrenzte und personell definierte Empfängerschaft), durch technische Verbreitungsmittel (Medien), indirekt (also bei räumlicher oder zeitlicher oder raumzeitlicher Distanz zwischen den Kommunikationspartnern) und einseitig (also ohne Rollenwechsel zwischen Aussagenden und Aufnehmenden) an ein disperses Publikum […] gegeben werden.“
Interpersonale Kommunikation wäre demnach eine Form der Kommunikation, bei der die Aussagen privat, mit oder ohne technische Verbreitungsmittel (gesprochene Sprache, Telefon), direkt (face-to-face) oder indirekt (Briefkommunikation, E-Mail, Telefon) und wechselseitig zwischen Aufnehmenden und Aussagenden an eine einzelne Person oder aber ein konkretes Publikum (Gruppe) gegeben werden.
Maletzke verpackte seine Definition der Massenkommunikation schließlich in ein grafisches Modell (Abb. 2), deren Hauptbestandeile die vier Faktoren Kommunikator (K), Aussage (A), Medium (M) und Rezipient (R) bilden.
Abb. 2:
Feldmodell der Massenkommunikation (Quelle: Maletzke 1963: 41, zitiert nach Burkart 2003: 184)
Maletzke selbst beschreibt das Schema bzw. die Beziehung der vier Faktoren zueinander folgendermaßen (1988, zitiert nach Rusch 2002c: 106f.):
„Der KommunikatorKommunikator (K) produziert die Aussage durch Stoffwahl und Gestaltung. Seine Arbeit wird mitbestimmt durch seine Persönlichkeit, seine allgemeinen sozialen Beziehungen (u.a. persönliche direkte Kommunikation), durch Einflüsse aus der Öffentlichkeit und durch die Tatsache, dass der Kommunikator meist in einem Produktionsteam arbeitet, das wiederum einer Institution eingefügt ist. Außerdem muss der Kommunikator die Erfordernisse seines Mediums und des ‚Programms‘ kennen und berücksichtigen, und schließlich formt er sich von seinem Publikum ein Bild, das seine Arbeit und damit die Aussage und damit endlich auch die Wirkungen wesentlich mitbestimmt. Die Aussage (A) wird durch das Medium (M) zum Rezipienten geleitet. Sie muss dabei den technischen und dramaturgischen Besonderheiten des jeweiligen Mediums angepasst werden. Der Rezipient (R) wählt aus dem Angebot bestimmte Aussagen aus und rezipiert sie. Der Akt des Auswählens, das Erleben der Aussage und die daraus resultierenden Wirkungen hängen ab von der Persönlichkeit des Rezipienten, von seinen sozialen Beziehungen, von den wahrnehmungs- und verhaltenspsychologischen Eigenarten des Mediums auf der Empfängerseite, von dem Bild, das sich der Rezipient von der Kommunikatorseite formt und von dem mehr oder weniger klaren Bewusstsein, Glied eines dispersen Publikums zu sein. Schließlich deutet der obere Pfeil im Feldschema an, dass trotz der Einseitigkeit der Massenkommunikation ein ‚Feedback‘ zustande kommt.“
Der Vorteil dieses Modells ist, dass darin auch äußere Einflüsse auf KommunikatorKommunikator und Rezipienten Niederschlag finden. Weder Kommunikator noch Rezipient stehen isoliert da, sondern sind eingebettet in soziale Netzwerke, die sie beeinflussen.
In der wissenschaftlichen Rezeption geht dieses Modell einigen nicht weit genug. Faulstich sieht hier den gesellschaftlichen Kontext (Institutionen, Politik, Wirtschaft u.a.) unberücksichtigt, womit er Maletzke jedoch Unrecht tut. In seinem Schema sind sehr wohl Institutionen angeführt; außerdem lassen sich unter dem Einflussfaktor „Zwang der Öffentlichkeit“ wohl auch Politik und Wirtschaft subsumieren. Gerechtfertigte Kritik übt Faulstich hingegen, wenn er sagt, dieses Modell unterstelle „ein offensichtlich idealisiertes Gleichgewicht“ zwischen KommunikatorKommunikator und Rezipienten (Faulstich 2002: 40) – ein überzeugender Einwand, den auch Kübler (2003: 121) mit Faulstich teilt: Das Modell lässt
„weitgehend ausser Acht, dass sich im Zeitalter professioneller, hochorganisierter, machtpolitisch verstrickter und vor allem ökonomisch – sprich: auf Profitmaximierung – ausgerichteter Medienkommunikation die Gewichte zum Nachteil des Publikums verlagert haben, dass es mithin erhebliche Beeinflussungsmöglichkeiten und wohl auch Abhängigkeiten gibt; sie werden durch das Modell egalisiert und damit eskamotiert.“
Hickethier (2003: 51) sieht außerdem ein Problem darin, dass Maletzke von einem journalistischen Verständnis der Massenmedien auszugehen scheint, „bei dem ein einzelner ‚KommunikatorKommunikator‘ sich einer technischen Apparatur bedient und mit ihr viele ‚Rezipienten‘ erreicht“. Das Modell versagt allerdings, wenn es darum geht, komplexere Medienangebote zu beschreiben (wie Filme), bei der mehrere Personen arbeitsteilig mitwirken (vgl. Hickethier 2003: 51). Auch Pressetexte sind komplexe Medienangebote, die nicht auf einen einzelnen Kommunikator zurückgehen, sondern von mehreren Kommunikatoren oder Autoren produziert werden (siehe dazu auch Abschnitt 3.1.1). Nicht nur dass viele Artikel von Presseagenturen hergestellt und von den Zeitungsredakteuren nur noch angepasst (gekürzt, erweitert usw.) werden, es werden auch unterschiedlichste Quellen zitiert (Politikeraussagen, Grafiken von Statistik-Büros usw.).
Massenkommunikation ist also öffentlich, indirekt und einseitig und richtet sich an ein disperses Publikum. Doch seit den 1960ern hat sich viel getan. Das World Wide Web und die zahlreichen Möglichkeiten der Interaktivitäten brachten große Veränderungen mit sich, die die Grenzen zwischen interpersonaler und Massenkommunikation verschwimmen ließen. Kübler (2003: 124) vertritt die Meinung, dass „angesichts der einhergehenden Transformationen […] nicht mehr so eindeutig und dipodisch zwischen personaler und Massenkommunikation“, zwischen Öffentlichem und Privatem getrennt werden kann. Kübler versucht die Neuerungen in Maletzkes Definition zu integrieren bzw. diese zu aktualisieren:
Unter medialer Kommunikation verstehen wir die (sich mehr und mehr verbreitende) Form der Kommunikation, bei der
Tab. 2:
Definition von medialer Kommunikation (Quelle: Kübler 2003: 124; eigene Darstellung)
Anhand der Online-Medien können diese neuen Entwicklungen am geeignetsten festgemacht werden. Das Internet ist einerseits öffentlich, d.h. von allen (mit Internetzugang) benützbar; andererseits gibt es Bereiche, die privat, etwa durch Passwörter geschützt, sind (Newsgroups, Chatrooms, Blogs usw.). Andere Merkmale der Massenkommunikation waren laut Maletzke die Einseitigkeit der Kommunikation sowie die raumzeitliche Distanz der Kommunikationspartner, die jedoch im World Wide Web zum Teil aufgebrochen scheinen.
„Elektronische Daten sind allerorts (nahezu) gleichzeitig mit ihrer Schöpfung und Eingabe verfügbar, so dass nicht nur der Zeitverzug innerhalb der Produktion, der durch diverse Phasen der Materialisierung und Gestaltung – etwa beim Druck – verursacht wird, wegfällt oder zumindest enorm reduziert wird: Letztlich fallen Produktion und Rezeption zusammen, was mit dem Begriff ‚Echtzeit‘ (Virilio 1996; Kloock 2000, 161ff.) gekennzeichnet wird; beim Internet können sie – wie im personalen Dialog – ständig wechseln. Vor allem das charakteristischste Kriterium der Massenkommunikation, die Einseitigkeit des Kommunikationstransfers, wird mehr und mehr aufgehoben – entsprechend erodiert die Dualität von personaler und Massenkommunikation.“ (Kübler 2003: 125f.)
Auch wenn der Begriff „Echtzeit“ sicherlich nicht zutrifft, da die eingegeben Daten erst übertragen werden müssen, ist die zeitliche Distanz beim Chat, beim Instant Messaging oder etwa bei der Internettelefonie tatsächlich kaum mehr wahrnehmbar.
Kübler mag in vielen Dingen Recht haben; sein Konzept der „allmähliche[n] Aufweichung der Massenkommunikation und [der] Mutationen zur medialen Kommunikation“ (2003: 123) scheint mir ein wenig zu drastisch. Massenkommunikation geht aufgrund der neuen Entwicklungen nicht verloren. Die „alten“ Medien (Fernsehen, Rundfunk, Presse) machen sich die „neuen“ zwar zunutze: Tageszeitungen gehen online, man kann diverse Nachrichtensendungen des ORF im Web ansehen, das Fernsehprogramm nachlesen, Rundfunksender haben Internetauftritte mit verschiedensten Angeboten und sind auch über Internet empfangbar (mit einer kleinen Zeitverschiebung). Dennoch: Die alten, traditionellen Medien mit ihren typischen „massenkommunikativen“ Merkmalen bleiben parallel dazu bestehen. Es ist ein Mehr an Angebot, aber das eine ersetzt das andere nicht.
Manche von Kübler angesprochene Neuerungen sind gar nicht so neu: Privatheit und Öffentlichkeit wurden auch in den „alten“ MassenmedienMassenmedien bereits gerne vermischt (Geburtstagswünsche, Informationen über Schul- oder Studienabschlüsse, Todesfälle usw. im Anzeigenteil der Tageszeitungen, Grüße an den oder die Liebste(n) über das Radio usw.). Auch die Einseitigkeit konnte in gewissen Fällen durchbrochen werden (Leserbriefe, Anrufer beim Rundfunk oder bei Live-Sendungen im Fernsehen). Die von Maletzke angeführten Merkmale der Massenmedien „öffentlich“, „einseitig“, „indirekt“ und „an ein disperses Publikum gewandt“ sind daher nicht ausschließlich zu sehen, sondern vorrangig.
Allerdings stimme ich Kübler in Bezug auf die Online-Medien zu. Das World Wide Web vermittelt neben öffentlicher bzw. Massenkommunikation auch private, interpersonale Kommunikation (E-Mail, Instant Messaging, Blogs, Chats, Plattformen wie Facebook usw. – oft durch Passwörter geschützt). Für dieses „Massen“-MediumMedium trifft es zu, dass die „Massen“-Kommunikation zum Teil aufgeweicht scheint. Es gestattet den Usern wie kein anderes Massenmedium auf Kommuniziertes zu antworten (viele Online-Tageszeitungen ermöglichen ihren Lesern etwa, auf Artikel direkt zu reagieren bzw. KommentareKommentar auf die Website zu posten). Privates und Öffentliches verschwimmen – man denke an zwar private, aber öffentlich zugängliche Blogs, die zum Teil eine große Öffentlichkeit erlangen (z.B. der Warblog eines Mannes aus Bagdad mit dem Pseudonym Salam Pax, der über das Kriegsgeschehen im Irak berichtete und 2003 das weltweite Interesse der Medien, so auch der New York Times, auf sich zog).
Nichtsdestoweniger müsste Küblers Definition, die ja die mediale Kommunikation im Allgemeinen in den Blick nimmt, in Bezug auf die Massenkommunikation abgeändert werden. Ausschließlich auf Massenkommunikation bezogen, könnte also eine Definition folgendermaßen lauten:
Unter Massenkommunikation verstehen wir die Form der Kommunikation, bei der
Tab. 3:
Gedankenexperiment zu einer zeitgemäßen Definition von MassenkommunikationKommunikator
Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit, die ausschließlich die Printausgaben der Tageszeitungen in den Blick nimmt (die Internetauftritte bleiben unberücksichtigt), reicht Maletzkes Definition bzw. sein Modell der Massenkommunikation aus, um die Grundzüge der Kommunikationsvorgänge der Presse zu beschreiben.
Die Tageszeitungen als Printprodukte vermitteln eine Form der Kommunikation, bei der
Tab. 4:
Definition der Massenkommunikation in Tageszeitungen (Printversion)