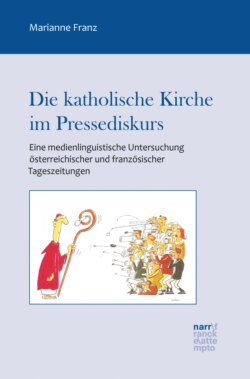Читать книгу Die katholische Kirche im Pressediskurs - Marianne Franz - Страница 15
2.3.1 Nachrichtenwerttheorie
ОглавлениеIm Folgenden werden die zentralen für die vorliegende Arbeit relevanten Aussagen der Nachrichtenwerttheorie dargestellt. Für detaillierte Informationen verweise ich vor allem auf Maier u.a. (2010), auf die ich mich in diesem Abschnitt hauptsächlich beziehe.Nachrichtenfaktoren
Die Nachrichtenwerttheorie lässt sich bis in die 1920er Jahre zurückverfolgen, als sich Walter Lippmann damit auseinandersetzt, wie JournalistenJournalismusforschung (s. a. Kommunikator) Nachrichten auswählen und „welche Kriterien ein Ereignis erfüllen muss, um Redakteuren publikationswürdig zu erscheinen“ (Maier/Stengel/Marschall 2010b: 29). Einige von ihm angeführte Kriterien wie Negativität oder Betroffenheit der Leser sind den später entwickelten Nachrichtenfaktoren bereits ähnlich (vgl. Maier/Stengel/Marschall 2010b: 30). Der Terminus „Nachrichtenfaktor“ selbst fällt erst in den 1960er Jahren. Norwegische Friedensforscher beschäftigen sich mit dem Nachrichtenfluss und führen erstmals auch Inhaltsanalysen durch, um die Auswahlkriterien der Journalisten herauszufinden (vgl. Maier/Stengel/Marschall 2010b: 31). Wichtige Namen sind hier Østgaard, Galtung und Ruge. Østgaard zeigt neben äußeren (politischen und wirtschaftlichen) Faktoren, die auf den Nachrichtenfluss einwirken, auch dem Nachrichtenprozess inhärente Faktoren auf, die sowohl die Ereignisse, über die berichtet wird, betreffen als auch die Journalisten selbst. Solche inhärenten Faktoren sind Vereinfachung, Identifikation und Sensationalismus (vgl. Maier/Stengel/Marschall 2010b: 33f.). Galtung und Ruge zufolge spiegeln Nachrichtenfaktoren „allgemeine menschliche Wahrnehmungsprozesse“ wider (vgl. 1965, zitiert nach Maier/Stengel/Marschall 2010b: 34). Es handelt sich dabei um „Ereignismerkmale, die grundsätzlich das Interesse von Menschen auf sich ziehen, die einen Einfluss darauf haben, wie aufmerksam ein Thema in den Medien verfolgt wird“. Nachrichtenfaktoren sind also „allgemeine kognitionspsychologische Mechanismen“, die nicht nur die Themenauswahl beeinflussen, sondern auch die Rezeption der Berichterstattung (Maier 2010a: 26). Galtung und Ruge (vgl. 1965, zitiert nach Maier 2010a: 23) stellen drei Hypothesen bezüglich des Zusammenwirkens der einzelnen Nachrichtenfaktoren und ihrer Auswirkung auf die NachrichtenselektionNachrichtenselektion auf: 1. die Additivitätshypothese, der zufolge es wahrscheinlicher ist, dass ein Ereignis zur NachrichtNachricht wird, je mehr Nachrichtenfaktoren auf es zutreffen; (2) die Komplementaritätshypothese, die besagt, dass ein nicht vorhandenes Merkmal durch den hohen Wert eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann, so dass das Ereignis dennoch zur Nachricht wird; (3) die Exklusionshypothese, nach der ein Ereignis mit zu wenigen oder keinen Nachrichtenfaktoren keinen Eingang in die Berichterstattung findet.
Kepplinger (2008, zitiert nach Maier 2010a: 18) beschreibt „Nachrichtenfaktoren“ später als „Merkmale von Nachrichten über Ereignisse und Themen, die dazu beitragen, dass diese publikationswürdig bzw. mit Nachrichtenwert versehen werden“. Aus dieser Definition geht hervor, dass zwischen Nachrichtenfaktor und Nachrichtenwert zu unterscheiden ist. Der Wert einer NachrichtNachricht steigt, je mehr Faktoren sie erfüllt. Anzahl und Ausprägung bzw. Intensität der Nachrichtenfaktoren bestimmen somit den Nachrichtenwert.
„Dieser Nachrichtenwert entscheidet darüber, ob ein Ereignis in der medialen Berichterstattung überhaupt verwertet wird und in welchem Umfang. Dieser Nachrichtenwert eines Ereignisses wird seit Schulz (1976) anhand verschiedener (formaler) Maßzahlen gemessen, in denen sich journalistische Beachtung ausdrückt: z.B. anhand der Platzierung eines Beitrags auf der Titelseite einer Zeitung […] oder anhand der Länge des Beitrags […].“ (Maier 2010a: 19)
Seit Schulz ist die Nachrichtenwertforschung vor allem in Deutschland beheimatet (vgl. Maier/Stengel/Marschall 2010b: 39f.). Die Anzahl der Nachrichtenfaktoren, die sich bei Galtung und Ruge noch auf zwölf belief (vgl. Maier/Stengel/Marschall 2010b: 36), wird von Schulz auf 19 erweitert. Er fasst sie aber zu sechs übergeordneten Faktorendimensionen zusammen (Konsonanz, Status, Dynamik, Valenz, Identifikation und Relevanz) (vgl. Schulz 1976 und 1982, zitiert nach Maier/Marschall 2010: 98f.). Auch andere Wissenschaftler, wie Staab, Donsbach, Maier u.a. oder Fretwurst, haben versucht übergeordnete Dimensionen zu erschließen (vgl. z.B. Staab 1990, Donsbach 1991, Maier u.a. 2009, Fretwurst 2008, zitiert nach Maier/Marschall 2010: 98–102), um Redundanz der inzwischen 22 Nachrichtenfaktoren und damit „Mehrfachmessung der journalistischen Auswahlkriterien“ zu vermeiden. Denn allem Anschein nach „berücksichtigen Journalisten bei der Auswahl wichtiger Ereignisse für die Berichterstattung vermutlich nicht so viele Ereignismerkmale, wie die aktuelle Forschung zur Nachrichtenwerttheorie suggeriert“ (Maier/Stengel 2010: 101). Die von den verschiedenen Forschern aufgezeigten Dimensionen sind nachstehend gegenübergestellt (Tab. 6).
Tab. 6:
Übergeordnete Faktorendimensionen der journalistischen Auswahl (Quelle: Maier/Stengel 2010: 103)
Maier und Stengel haben die vergleichbaren Faktorendimensionen zeilenweise nebeneinander angeordnet. Auch wenn sich die Termini zum Teil unterscheiden, sind die dahinterstehenden Merkmale großteils sinnverwandt (z.B. Status, Personalisierung, Prominenz, Personen). Hervorheben möchte ich den Faktor „Visualität“, der in der Tabelle bei Maier u.a. (2003–2009) vorkommt und ursprünglich von Ruhrmann u.a. eingeführt wurde, die sich mit dem Nachrichtenwert im deutschen Fernsehen auseinandergesetzt haben (vgl. Ruhrmann 2003, zitiert nach Maier/Stengel 2010: 108).
„Ausgehend von den Ergebnissen einer Journalistenbefragung zeigen sie zunächst, dass die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigem Film- und Bildmaterial einen der wichtigsten Einflussfaktoren für die Entscheidung über die Publikation eines Ereignisses als Nachrichtenmeldung darstellt (vgl. Diehlmann, 2003).“ (Maier/Stengel 2010: 108)
Dass Bilder in den letzten Jahrzehnten nicht nur im Fernsehen, sondern auch in der Presse immer wichtiger wurden und werden, wird auch in Abschnitt 3.2 erläutert. Rössler, Marquart, Kersten, Bomhoff (2009) sprechen diesbezüglich von Fotonachrichtenfaktoren und übertragen die Text-Nachrichtenfaktoren auf Bilder. Faktoren, die die Bildauswahl sowie den Grad der Aufmerksamkeit der RezipientInnen beeinflussen, sind Schaden, Gewalt und Aggression, Prominenz sowie Sex und Erotik (vgl. Rössler u.a. 2009, zitiert nach Maier/Stengel 2010: 110). Inwieweit das Vorhandensein von Bildern einen Nachrichtenfaktor in der Presse darstellt, ist noch nicht belegt.
Interessant ist, dass bisherigen Studien zufolge die Nachrichtenfaktoren medienübergreifend ähnlich sind. In Frage steht jedoch, ob die Ausprägung der Nachrichtenfaktoren, d.h. die den Faktoren zugesprochenen Werte, je nach MediumMedium und Redaktion unterschiedlich sein kann (vgl. Maier/Stengel/Marschall 2010c: 132f.). Ein weiteres Forschungsdesiderat besteht darin, ob die Nachrichtenwerttheorie auf verschiedene Kulturen gleichermaßen zutrifft, oder inwiefern die Nachrichtenfaktoren themenabhängig sind (vgl. Maier/Stengel 2010: 112f.). Die vorliegende Arbeit kann hier einen Beitrag leisten, da sie die Berichterstattung verschiedener Länder und verschiedener Redaktionen bezüglich eines spezifischen Themas vergleicht.
Kepplinger und Ehmig gehen in ihrer Zwei-Komponenten-Theorie davon aus,
„dass sowohl die Merkmale der Ereignisse (Nachrichtenfaktoren) als auch der Nachrichtenwert, den jeder einzelne Nachrichtenfaktor für ein spezifisches MediumMedium hat, die Nachrichtenauswahl bestimmen. Sie argumentieren, dass davon auszugehen sei, dass bestimmte Nachrichtenfaktoren z.B. für BoulevardzeitungenBoulevardzeitung wichtiger seien als für QualitätszeitungenQualitätszeitung. Daher versuchen sie den relativen Einfluss jedes einzelnen Nachrichtenfaktors zu errechnen und testen dann anhand einer zweiten StichprobeStichprobe (s. a. Künstliche Woche) die Qualität dieses Prognosemodells. Ihrer Meinung nach ist diese Prognosemöglichkeit eine der herausragenden Eigenschaften der Nachrichtenwerttheorie […]. Allerdings variieren diese Maßzahlen eben von Medium zu Medium und von Redaktion zu Redaktion, und auch die Forschung hierzu steht noch am Anfang […].“ (vgl. Kepplinger 2008 und Kepplinger/Ehmig 2006, zitiert nach Maier 2010a: 19)
Vorab kann festgestellt werden, dass die Nachrichtenwerttheorie die Hypothesen, von der die vorliegende Arbeit ausgeht (siehe Abschnitt 1.2), zu bestätigen scheint, wenn es um die tendenziell negative Darstellung der Kirche geht. Denn bisherige Studien zeigen:
„Das Weltbild in unseren Medien ist durch negative Ereignisse geprägt, die in relativer Nähe zu uns stattfinden, in denen vorrangig prominente Personen und aggressives Verhalten vorkommen, und die sich gut in (bewegten) Bildern darstellen lassen. Negativität, Personalisierung, Visualisierung, Boulevardisierung: all das sind oft beklagte mediale Trends unserer Zeit […].“ (vgl. Maier/Stengel/Marschall 2010c: 133)
Vorherrschende Methode, um festzustellen, welche Ereignisse welche Nachrichtenfaktoren aufweisen, ist die InhaltsanalyseInhaltsanalyse bereits publizierter Medienbeiträge. Dazu werden Nachrichtenfaktoren meist auf Artikel- oder Beitragsebene codiert (vgl. Maier 2010b: 53), indem durch „eine subjektive Interpretationsleistung“ „die Merkmale des berichteten Ereignisses“ analysiert „und auf der zur Verfügung stehenden Skala“ eingeordnet werden (Maier 2010b: 55). Die Distribution der Nachrichtenfaktoren gibt Aufschluss über ihre Relevanz bei der NachrichtenselektionNachrichtenselektion. Daneben wird, wie bereits erwähnt, auch der Nachrichtenwert festgestellt, indem man den Beachtungsgrad des Ereignisses in der Berichterstattung anhand seiner Platzierung und seiner Berichtlänge misst (vgl. Maier 2010a: 21). Damit die Zuweisung der Nachrichtenfaktoren nicht beliebig geschieht, muss ein Codebuch erstellt und Inter- bzw. Intracoder-Reliabilität sichergestellt werden.
In der vorliegenden Arbeit ist eine Intercoder-Reliabilität, bei der verschiedene Codierer dasselbe Material auf dieselbe Weise codieren, nicht möglich. Umso wichtiger ist die Einforderung der Intracoder-Reliabilität, bei der derselbe Codierer zur Überprüfung dasselbe Material mithilfe desselben Codebuchs mit zeitlichem Abstand ein weiteres Mal auf dieselbe Weise codiert (vgl. Maier 2010b: 58). Geachtet werden muss darüber hinaus auf Inhaltsvalidität (vollständiges KategorieKategoriensystem, das misst, was die Forschungsfrage beinhaltet) sowie Kriteriumsvalidität (externe Stützung der Studie durch andere Studien, frühere Befunde) und Inferenzvalidität (Prüfung der Plausibilität der vorgenommenen Inferenzschlüsse mit Ergebnissen anderer Studien oder Daten) (vgl. Rössler 2005, zitiert nach Maier 2010b: 60). Empfohlen wird eine Triangulation auf mehreren Ebenen (z.B. Daten-, Methoden-, Theorien- oder Forschertriangulation; vgl. Maier 2010b: 69), die in der vorliegenden Arbeit z.B. durch die JournalistInnen-Befragung versucht worden ist.
In der hier vorgenommen Untersuchung werden die Nachrichtenfaktoren im Rahmen der ThemenfrequenzanalyseThemenfrequenzanalyse relevant. Ziel ist es herauszufinden, inwieweit die Nachrichtenwerttheorie auf die Berichterstattung über die katholische Kirche zutrifft, welche Nachrichtenfaktoren vornehmlich Eingang finden, und welche Ereignisse von den JournalistInnen bevorzugt werden. Dazu werden die Themen der Artikel mit den Nachrichtenfaktoren abgeglichen, wofür ich auf die 22 Nachrichtenfaktoren nach Ruhrmann u.a. zurückgreife (vgl. 2003, zitiert nach Maier/Marschall 2010: 80–84). Ich behalte mir jedoch vor, die Liste, wenn nötig, abzuändern. Die 22 Faktoren sind:
| Status der EreignisnationOrtsstatusBeteiligung der jeweiligen Nation (Österreich/Frankreich; bei Ruhrmann u.a.: deutsche Beteiligung)Räumliche NähePolitische NäheKulturelle NäheWirtschaftliche NäheEtablierung des ThemasEinfluss (z.B. von Personen oder Gruppen)Prominenz | PersonalisierungFaktizitätReichweiteÜberraschungNutzen/ErfolgSchaden/MisserfolgKontroverseKontroverseAggressionDemonstrationDarstellung von EmotionenDarstellung von Sex/ErotikVisualität |
Was mit den einzelnen Faktoren gemeint ist, wird im Codebuch näher erläutert (siehe Abschnitt 16.1).Gatekeeping