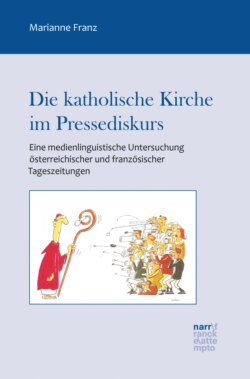Читать книгу Die katholische Kirche im Pressediskurs - Marianne Franz - Страница 5
Оглавление
1 Einleitung
Abb. 1:
Französische Karikatur zum Beziehungsproblem „Kirche und Medien“ (Quelle: Guézou 2009: 3)
| Deutsche Übersetzung: | |
| Bischof: | „Was die Aufhebung der Exkommunikation von Bischof Williamson betrifft, Gott präserviere uns vor jeglichem voreiligen Urteil!…“ |
| JournalistInnen: | „Präserv… …atif!! Es ist soweit! Er hat es gesagt!“ – „Wie furchtbar!“ |
| Bischof: | „Um deutlich zu sein, ja, aber nein …, aber gut. Naja, je nachdem.“ |
| Bildunterschrift: | „Eindringliche Zusammenhanglosigkeit angesichts einer ausgeprägten Fixierung.“1 |
Den Ausgangspunkt dieser Dissertation bildet eine Beobachtung, die wohl auch der KarikaturKarikatur in Abb. 1 zugrunde liegt: ein dem Anschein nach vorhandenes Beziehungsproblem zwischen der katholischen Kirche und den öffentlichen Medien.2
Tatsächlich muss man kein Experte sein, um zu erkennen, dass das Verhältnis zwischen Kirche und Medien nicht ausschließlich freundschaftlich ist. Kirchenmitglieder klagen immer wieder über die Medienmaschinerie und ihre Vorliebe für Skandale und Negativschlagzeilen. Die Kirche werde schlechter dargestellt, als sie sei, die positiven Aspekte würden ignoriert. Die Kirche fühlt sich (manchmal mit Absicht) missverstanden. Mitunter werden sogar Verschwörungstheorien ins Spiel gebracht, die Medien wollten die Kirche schädigen. Umgekehrt beschweren sich MedienvertreterInnen über die mangelnde kirchliche Kommunikationskompetenz. In der KarikaturKarikatur lässt sich das an der verwickelten Sprechblase erkennen. Der Bischof wirkt unbeholfen und weiß nicht so recht, was er sagen soll. Den Konflikt auf den Punkt bringen die Fotoapparate der JournalistInnen, aus denen offensichtlich Geschosse fliegen.
Befinden sich Kirche und Medien im Krieg? Was ist dran an diesem angeblichen Missverhältnis zwischen den beiden? Wie schreiben die Medien wirklich über die Kirche? Gibt es hier im internationalen Vergleich Unterschiede? Auf diese Fragen auf wissenschaftliche Art und Weise Antworten zu finden, ist das Ziel dieser Arbeit. Das Werkzeug dazu liefern allen voran die Linguistik, aber auch einige andere Forschungsdisziplinen wie die Medien- und Kommunikationswissenschaft, aus denen geschöpft wird.
Die Beforschung der medialen Berichterstattung ist kein Neuland, sondern hat Tradition. Neu ist das Thema, mit dem sich die vorliegende Arbeit auseinandersetzt. In einer durchaus säkularen Gesellschaft drängt sich die Frage auf, warum man sich mit dem medialen Bild einer Organisation befasst, deren Mitgliederzahlen ohnehin rückläufig sind und deren Untergang sich für manche schon abzuzeichnen scheint. Dass die Kirche aber immer noch eine gesellschaftliche Größe von nicht unbeträchtlicher Relevanz ist, spiegelt sich auch in ihrer unvermutet starken medialen Präsenz wider. Michael Fleischhacker, Chefredakteur der Presse, zählt Kirchenberichterstattung nicht zuletzt zu den „großen journalistischen Herausforderungen“ und gesteht ihr „Kulturkampfpotenzial“ zu (Fleischhacker 2010). Er spielt wohl darauf an, dass die erwähnte gesellschaftspolitische Relevanz der katholischen Kirche nicht unumstritten ist, ebenso wie zahlreiche ihrer Positionen oder Handlungen. Dabei geht es weniger um religiöse Glaubensinhalte (die im öffentlichen DiskursDiskurs nur selten Platz haben), sondern vielmehr um die daraus resultierenden (moralischen) Werthaltungen und Weltanschauungen, die zum Stein des Anstoßes werden.
Nichtsdestoweniger wurde die Kirche bislang als Thema sowohl in der Linguistik als auch in der Medien- und KommunikationswissenschaftKommunikationswissenschaft weitgehend ignoriert. Dort konzentriert man sich vor allem auf die Analyse der Presse-Berichterstattung in Hinblick auf politische Themen (z.B. Ausländerfeindlichkeit in der Presse; ethnische Minderheiten, Kernenergie, die EU-Erweiterung, politische Parteien im Vorlauf diverser Wahlen usw.) (vgl. auch Abschnitt 8).
Dass Kirche Kulturkampfpotenzial hat, zeigte sich auch schon in der Geschichte Frankreichs (vgl. Abschnitt 7.2). Heute herrscht dort eine strikte Trennung zwischen Staat und Kirche; viel strikter, als es in Österreich der Fall ist (vgl. Abschnitt 7.1), wo Staat und Kirche in vielen Bereichen kooperieren. Gerade dieser Unterschied macht einen Vergleich dieser beiden Länder interessant. Es bleibt festzustellen, ob sich die unterschiedlichen Staat-Kirche-Systeme in der Berichterstattung der Medien widerspiegeln. Auch dieser länderübergreifende Vergleich bildet ein Novum, das aufschlussreiche Ergebnisse zu den soziokulturellen und sprachlichen Besonderheiten der beiden Länder verspricht.
Alle Medien zu untersuchen sprengt die Ressourcen einer einzelnen Dissertantin. So wurde das MediumMedium der Tageszeitung ausgewählt, das nicht nur ein verhältnismäßig leicht zu handhabender Untersuchungsgegenstand ist, sondern das sowohl in Österreich als auch in Frankreich ein sehr beliebtes Medium und insofern repräsentativ ist (vgl. Kapitel 9).
Im Folgenden werden das Forschungsobjekt, die der Untersuchung zugrunde liegenden Hypothesen, das Untersuchungsdesign und der Aufbau der vorliegenden Arbeit genauer erläutert.