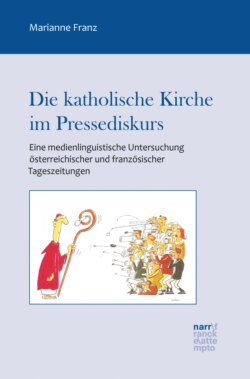Читать книгу Die katholische Kirche im Pressediskurs - Marianne Franz - Страница 21
2.4 Medieninhaltsforschung
ОглавлениеBonfadelli (2006b: 173) beschreibt Medieninhalte als „die von den Medien im Kommunikationsprozess verbreiteten Botschaften und die damit übermittelten symbolischen Bedeutungen“. Im Englischen gibt es hier die Unterscheidung zwischen „message“ (z.B. Zeitungsartikel, d.h. Texte und Bilder) und „meaning“ (die Bedeutung des Übermittelten).
Zu bedenken ist jedoch, dass in den verschiedenen Forschungsrichtungen statt „Medieninhalt“ auch andere Begriffe wie Medienaussagen, TextTextMedientextMedientext oder Medienprodukte verwendet werden, so dass hier eine gewisse terminologische Unschärfe besteht (vgl. Bonfadelli 2006b: 173).
„Die Analyse der Inhalte der modernen MassenmedienMassenmedien stand wegen ihrer massenhaften Verbreitung sowie ihrer enormen Popularität, und nicht zuletzt wegen der damit verknüpften Wirkungsvermutungen bezüglich des Publikums von Beginn an sowohl im Zentrum der empirischen Forschung der Publizistikwissenschaft als auch im Fokus der kritischen Öffentlichkeit.“ (Bonfadelli 2003: 79)
Medieninhaltsforschung als eigenständiges Forschungsfeld der Medien- und KommunikationswissenschaftKommunikationswissenschaft zu bezeichnen, mag jedoch auf den ersten Blick näher liegen, als es das auf den zweiten Blick tut. Sie beschäftigt sich vor allem mit dem „Who says What“ der Lasswell-Formel – mit dem Was, dem MedientextMedientext. Doch dies tut sie nicht, ohne auch andere Aspekte der Lasswell-Formel zu berücksichtigen. Nach Bonfadelli (vgl. 2003: 79) werden Medieninhalte deshalb gerne analysiert, weil sie besonders leicht zugänglich sind (im Gegensatz etwa zu den Kommunikatoren). Sie werden aber selten sozusagen um ihrer selbst willen untersucht, sondern meist unter einer bestimmten Perspektive.
„Für sich allein bilden [die Medieninhalte] selten einen eigenständigen Gegenstand, außer aufgrund von quantifizierenden Aussagen- bzw. Inhaltsanalysen (vgl. Früh 1998; Merten 1995) oder qualitativen Textanalysen (Hijmans 1996), welche die ‚sekundäre‘ Medienrealität zu erfassen und beschreiben versuchen.“ (Bonfadelli 2003: 82)
Die Medieninhaltsanalyse der vorliegenden Arbeit versucht genau dies: Sie will die sekundäre MedienrealitätMedienwirklichkeit mittels einer InhaltsanalyseInhaltsanalyse sowie einer qualitativen Textanalyse, nämlich der DiskursanalyseDiskursanalyse, erfassen. Die Analyse wird jedoch aus der Kommunikatorperspektive vorgenommen (s.u.), d.h., sie soll Erkenntnisse einerseits über die sekundäre Medienrealität, andererseits über die Kommunikatoren ermöglichen.
Die Unterscheidung zwischen Botschaft und Bedeutung bzw. „message“ und „meaning“ entspricht im Grunde bereits den zwei Grundtypen der Medieninhaltsforschung, wie sie Marcinkowski und Marr benennen. Das Erkenntnisinteresse des ersten Grundtyps liegt demnach in der reinen Deskription und
„beschränkt sich im Sinne einer Kartographie auf die Bestandsaufnahme und Klassifikation des medialen Angebots. Von Interesse sind dabei allgemeine Strukturmerkmale wie Umfang, Positionierung, Präsentationsweisen oder Genres mit denen verschiedene Angebotsformen vermittelt werden, die diesbezüglichen Unterschiede zwischen den Medientypen (Presse, Rundfunk, Internet) sowie ihre Veränderungen im Zeitverlauf.“ (Marcinkowski/Marr 2005: 427f.)
Der zweite Grundtyp interessiert sich für die InferenzenInferenz der Medieninhalte, d.h. für die durch die Medieninhalte gewonnenen Erkenntnisse bezüglich der Kommunikatoren, der Wirkung der Medieninhalte, der Zusammenhänge der Medieninhalte untereinander sowie des Realitätsbezugs der Medieninhalte (vgl. hierzu die Ausführungen von Marcinkowski/Marr 2005: 428f.).
Bonfadelli nennt vier ähnliche Perspektiven zur Analyse von Medieninhalten, die er zusammen mit den jeweiligen Analyseinstrumenten in einem Schaubild darstellt (Abb. 5).
Abb. 5:
Perspektiven und Instrumente zur Analyse von Medieninhalten (Quelle: Bonfadelli 2003: 80)
Bonfadelli stellt im Weiteren fest (2003: 82), „dass Medieninhalte meist in Relation zu den Kommunikatoren oder zu den Rezipienten untersucht werden“. Oder wie Scholl (2005: 231) es formuliert: „[…] man kann die Analyse von Medieninhalten und ihren Strukturen als Schnittstelle für die Analyse ihrer Entstehung und Folgen betrachten“.
Die Bandbreite der Fragestellungen in der Medieninhaltsforschung ist enorm, doch gibt es einige Themen, denen vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt wird. Bonfadelli (vgl. 2003: 82–87) führt eine Liste solcher Themen an, die er nach Durchsicht publizistikwissenschaftlicher Fachzeitschriften zusammengestellt hat:
| Repräsentanz bzw. Stereotypisierung von Bevölkerungsgruppen und Minoritäten,Darstellung von Frauen und Männern in den Medien,Medienkultur und Wertewandel,Kriminalität und Gewalt,Ausländerfeindlichkeit und Rechtsradikalismus,Konflikte, Krisen, Terrorismus und Kriegsberichterstattung,Umwelt, Wissenschaft, Technik und Risiken, | Gesundheit, Krankheit und Medizin,Mediale Konstruktionen von Medienereignissen,Nachrichtengeografie,Gehalt, Vielfalt, Verständlichkeit, Redundanz,Format-Analysen und schließlichProgrammqualität, Medienleistungen, Benchmarking1 |
Scholl (2005: 232) nennt einige Fragestellungen, mit denen sich die Forschung vor allem im Bereich der journalistischen Berichterstattung auseinandersetzt, was für die vorliegende Arbeit von Interesse ist. Die Fragestellungen überschneiden sich weitgehend mit denen in Bonfadellis allgemeinerer Aufzählung. Weitere, bei Scholl angeführte Themen sind „Politik und politische Prozesse im Allgemeinen; Wahlkampf; Skandale; […] Sexualität (vor allem in Boulevardmedien); […] Wirtschaft; Sport“.
In der Medieninhaltsforschung gibt es entsprechend den vielen Fragestellungen bzw. Perspektiven auch sehr viele methodische Zugänge. Der Zusammenhang zwischen Perspektive und Analyseinstrument wurde bereits in Abb. 5 deutlich. Etabliert hat sich vor allem die (quantifizierende) InhaltsanalyseInhaltsanalyse. Sie nimmt in der Medieninhaltsforschung einen derart großen Stellenwert ein, dass der Untersuchungsgegenstand „Medieninhalte“ oft sogar über sie definiert wird (vgl. Bonfadelli 2003: 79). Auch die vorliegende Arbeit greift auf sie zurück (siehe Abschnitt 2.4.2). Daneben gibt es eine Reihe von qualitativen Verfahren der Textanalyse, die hier – mit Ausnahme der DiskursanalyseDiskursanalyse – nicht von Bedeutung sind.2 Diskursanalytische bzw. linguistisch-semiotische Verfahren repräsentieren auch bei Beck (vgl. 2007: 176) einen von vier Ansätzen der Medieninhaltsanalyse.3 Die linguistisch-semiotischen Ansätze versuchen die „Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem“ zu rekonstruieren und die Konnotationen zu erfassen (Beck 2007: 176). Neben Analysen von visuellen Zeichen (z.B. Layout oder Anzeigen- und Plakatwerbung) und bewegten Bildern ist es vor allem die Analyse von MedienspracheMediensprache (s. a. Pressesprache), die sie für die vorliegende Arbeit interessant macht.
Diskursanalytische Verfahren, die einen geistes- und kulturwissenschaftlichen Hintergrund haben, analysieren Medieninhalte und deren Strukturen – meist mit dem Ziel, kritisch dahinterstehende IdeologienIdeologie (s. a. Welt- und Wertvorstellungen) aufzuzeigen (vgl. Beck 2007: 176). „Mit linguistischen Verfahren werden Argumentationsmuster, Stereotype, rhetorische Figuren, Narrationsverfahren, Zitationen und Stil untersucht, um an die Bedeutung hinter der Bedeutung zu gelangen.“ (Beck 2007: 176). Der Vorteil der DiskursanalyseDiskursanalyse ist, dass sie auch latente Bedeutungen untersucht, während die InhaltsanalyseInhaltsanalyse (vor allem die quantifizierende) vordergründig manifeste Inhalte erhebt (vgl. Beck 2007: 174) (zur Diskursanalyse in der Linguistik siehe Abschnitt 5).
Als Forscher ist es jedoch notwendig, sich dessen bewusst zu sein, dass wir im Grunde „niemals an die ‚objektiven‘Inhalte herankommen“. „Im Gegensatz zur spontanen Rezeption im Medienalltag“ ist es allerdings möglich,
„auf systematische und methodisch kontrollierte, also intersubjektiv nachvollziehbare Weise zumindest die sog. ‚manifesten Inhalte‘ [zu] rekonstruieren und [zu] untersuchen. Als ‚manifest‘ bezeichnet man jene Inhalte oder besser: materielle Zeichen und Zeicheninterpretationen, auf die wir uns gemeinsam verständigen können. Weitaus schwieriger ist es, auf intersubjektiv nachvollziehbare Weise ‚latente Inhalte‘ zu analysieren, also (weitere, nicht denonative) Bedeutungen, die möglicherweise ‚mitschwingen‘ oder konnotiert werden; hierüber können wir mithilfe semiotischer Verfahren Hypothesen formulieren.“ (Beck 2007: 174)
Die vorliegende Arbeit unternimmt den Versuch sowohl manifeste als auch latente Inhalte der Berichterstattung über die röm.-kath. Kirche zu untersuchen. Wie dabei vorgegangen wird, ist in den Abschnitten 6.1 und 13 nachzulesen.
Wie die Medieninhaltsanalyse gestaltet wird, hängt allerdings nicht nur von der Perspektive ab (KommunikatorKommunikator, Rezipient, Medien, Realität), auf die die Analyse ausgerichtet ist, sondern auch vom medientheoretischen Hintergrund, von dem der Forscher ausgeht:
„In Anlehnung an Bonfadelli (2002: 43–45) können grob vier medientheoretische Grundpositionen unterschieden werden:
Idealistische Konzepte sehen die Medien als unabhängige Variable, d.h., die Medien beeinflussen zwar Gesellschaft und Kultur, werden selbst aber von diesen kaum beeinflusst.
Materialistische Konzepte erkennen in den Medien einen Spiegel (Überbauphänomen) der Gesellschaft (Basis); sie sind abhängig von der Gesellschaft, den Produktions- und Machtverhältnissen (Kapitalismus etc).
Interdependenz-Konzepte konstatieren eine wechselseitige Beeinflussung und Abhängigkeit von Medien einerseits und Gesellschaft bzw. Kultur andererseits; d.h., Medien sind Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse, können sie aber auch beeinflussen und zum Wandel beitragen.
Autonomie-Konzepte sehen die Medien als relativ eigenständige Sphären oder gar (autopoietische) Systeme, die sich der gesellschaftlichen Steuerung weitgehend entziehen, umgekehrt aber auch nur begrenzte Steuerungsmacht auf andere gesellschaftliche Bereiche oder Systeme ausüben können.“ (Beck 2007: 173)
Von den vier vorgestellten Konzepten schließe ich mich dem Interdependenz-Konzept an, da mir die anderen drei Konzepte zu kurz greifen. Idealistische Konzepte ignorieren etwa den Einfluss der Ökonomie auf die Medien. Materialistische Konzepte berücksichtigen dies zwar, ignorieren hingegen die inzwischen empirisch nachgewiesene Medienwirkung auf die Rezipienten. Autonomie-Konzepte schließen die Medien von der Gesellschaft aus bzw. sehen sie als etwas Eigenständiges, Separates. Medien sind Teil der Gesellschaft, werden von dieser beeinflusst und beeinflussen diese auch selbst; letzteres allein schon aufgrund ihrer reinen Existenz. Medien wie das Radio, das Fernsehen, das Internet oder auch die neuen Handy-Technologien haben unser Leben, unser Verhalten nachhaltig verändert; man denke nur an Menschen, die ihren Rhythmus nach Fernsehserien ausrichten. Und hier ist noch nicht einmal die Rede vom Einfluss der Medieninhalte z.B. auf unser Kaufverhalten, der zwar schwieriger festzumachen ist, jedoch ein eigenes Forschungsfeld der Medien- und KommunikationswissenschaftKommunikationswissenschaft darstellt und zu dem es inzwischen zahlreiche Studien gibt.
Ich vertrete das Interdependenz-Konzept auch in Bezug auf die Tageszeitungen. Auch für sie gilt der wechselseitige Einfluss zwischen ihnen selbst und der Gesellschaft. Eine der (sogar staatspolitisch vorgesehenen) Aufgaben der Tageszeitungen ist neben der Information die Meinungsbildung.4 Wirkung ist also vorgesehen und intendiert. Wenn die Tageszeitungen nun über die röm.-kath. Kirche berichten, ist diese Berichterstattung z.B. für Personen, die nichts mit Kirche zu tun haben, oft die einzige Informationsquelle, der einzige Zugang zur Realität „Kirche“. Das mediale Bild der Kirche wird unter Umständen auf diese Personen übergehen. Diese Tatsache bildet eines der Motive dieser Arbeit, die zum Ziel hat, die Beschaffenheit der medial konstruierten Wirklichkeit „Kirche“ nachzuzeichnen.
Das Interdependenz-Konzept stimmt außerdem mit der hinter der DiskurslinguistikDiskurslinguistik stehenden Theorie überein, nach der DiskurseDiskurs Wissen reproduzieren, aber auch produzieren und Macht ausüben, indem sie Handlungen induzieren. Mediendiskurse bilden hier als Teile des gesamtgesellschaftlichen Diskurses keine Ausnahme (siehe Abschnitt 5).
Die Frage, auf welche Weise die Gesellschaft nun auf die Berichterstattung der Tageszeitungen über die röm.-kath. Kirche Einfluss nimmt, fließt insofern in die Fragestellung der Arbeit ein, als sie die Berichterstattung in den Ländern Österreich und Frankreich miteinander vergleicht. Es wird sich weisen, inwiefern sich gesellschaftliche Unterschiede in den Berichterstattungen widerspiegeln.
Blickt man auf die bisherige Medienforschung zurück, gibt es noch eine weitere grundlegende Unterscheidung bzw. „zwei grundsätzliche Herangehensweisen“, die die Ausrichtung der Analyse wesentlich beeinflussen. Diese unterscheiden sich in „entgegengesetzten Vorstellungen über die Funktion der Medien in der Gesellschaft“ (Marcinkowski/Marr 2005: 430); es geht kurz gesagt darum, ob die Medien die sogenannte Realität wiedergeben (sollen/können) oder nicht.
Die folgenden Ausführungen sind für diese Arbeit grundlegend. Sie schildern die theoretischen Hintergründe, auf denen sowohl die Hypothesen als auch die Methodik basieren. Aufgrund ihrer Bedeutung wird ihnen ein eigener Abschnitt gewidmet. Im Anschluss wird die Methode der InhaltsanalyseInhaltsanalyse vorgestellt.