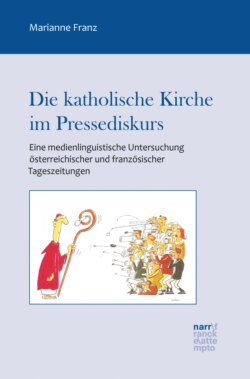Читать книгу Die katholische Kirche im Pressediskurs - Marianne Franz - Страница 22
2.4.1 Medieninhalte oder: Gibt es objektive BerichterstattungBerichterstattung, objektive (s. a. Realität, objektive)?
ОглавлениеDie zentrale Frage lautet: Gibt es eine objektive RealitätRealität, objektive? Und wenn ja, ist diese erschließbar? Mit dieser eigentlich erkenntnistheoretischen Problemstellung setzte sich schon Platon in seinem Höhlengleichnis auseinander: Entspricht das, was wir wahrnehmen, was wir für wahr halten, tatsächlich der Wirklichkeit?
Auf die MassenmedienMassenmedien übertragen geht es hier um die Frage nach ihrem Verhältnis zur Realität. In der Kommunikationsforschung gibt es zwei verschiedene Antworten darauf, die Schulz (1989) mit den Metaphern die „ptolemäische“ und die „kopernikanische“ Antwort bezeichnet. Die ptolemäische Antwort war in der Kommunikationsforschung der 70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts vorherrschend. Die Grundannahme war folgende:
„Da Medien ein hochgradig strukturiertes und oft verzerrtes Bild der Wirklichkeit präsentieren und da die Menschen ihr Verhalten – wenigstens teilweise – an diesem Bild der Wirklichkeit ausrichten, haben die MassenmedienMassenmedien einen starken Einfluß auf das Individuum und auf die Gesellschaft insgesamt.“ (Schulz 1989: 140)
Diese Annahme impliziert erstens, dass MassenmedienMassenmedien und Gesellschaft einen Gegensatz bilden, sowie zweitens, dass die Medien dazu da sind, die Realität originalgetreu widerzugeben. Medien sind demnach ein Spiegel der Wirklichkeit und haben Abbildfunktion (siehe zur Veranschaulichung Abb. 6). Die Forschungsfrage lautete sozusagen „Wie (gut oder schlecht) bilden die Medien die Wirklichkeit ab?“ (Burkhart 2002: 274).
Abb. 6:
Ptolemäische Perspektive: Medien als Spiegel der Wirklichkeit (Quelle: Burkart 2002: 272)
Die Folge dieser Ansicht war massive MedienkritikMedienkritik an der sogenannten „verzerrten“ MedienwirklichkeitMedienwirklichkeit (vgl. Schulz 1989: 140f.).1
Viele Studien hatten das Ziel, MedienrealitätMedienwirklichkeit mit außermedialer Realität zu vergleichen und die Verzerrung dieser objektiven RealitätRealität, objektive durch die Medien nachzuweisen. Es entstanden Theorien wie das Modell der Schweigespirale, die Gate-Keeper-Forschung sowie die News-BiasNews-Bias-Forschung oder auch in ihren Anfängen die NachrichtenwerttheorieNachrichtenwert (vgl. Marcinkowski/Marr 2005: 431; Schulz 1989: 140).
Im Laufe der Zeit musste jedoch festgestellt werden, dass auch außermediale Realitäten (Umfragen, Statistiken usw.) nicht mit der „objektiven RealitätRealität, objektive“ gleichzusetzen waren, oder wie Luhmann sagt: dass es keine „ontologische, vorhandene, objektiv zugängliche, konstruktionsfrei erkennbare Realität“ gibt, wie es das Wort „Verzerrung“ unterstellt (Luhmann 1996: 20). Schulz (1976: 9) stellt dazu fest: „Jede Wahrnehmung, auch wenn sich der Beobachter um noch so akribische Feststellung der ‚Tatsachen‘ bemüht, ist immer schon eine Interpretation der Realität“. Und Schulz ein Jahrzehnt später (1989: 143):
„Die Annahme einer ‚Verzerrung‘ kann, wenn man es genau nimmt, immer nur als Hypothese aufrecht erhalten werden, die sich niemals falsifizieren läßt, die also immer ungesichert bleiben muß. Dasselbe gilt für die Annahme der Wirklichkeitstreue.“
Es kam zu einer kopernikanischen Wende – weg vom RealismusRealismus hin zum Konstruktivismus. Der KonstruktivismusKonstruktivismus ist keine Neuerfindung des 20. Jahrhunderts, das trifft lediglich auf den Terminus zu. Konstruktivistisches Denken gab es im Grunde bereits in der griechischen Philosophie der Antike. Die grundlegende Aussage des Konstruktivismus lautet:
„‚[…] daß wir – nach den Operationsweisen unserer Gehirne – nur Modelle von Wirklichkeiten entwerfen, nicht aber auf ‚die Realität‘ direkt zugreifen können. Bei dieserWirklichkeitskonstruktion Wirklichkeitskonstruktion geht es nicht um absolute Maßstäbe wie ‚wahr‘ oder ‚richtig‘, sondern um subjektabhängige Wirklichkeiten, mit deren Hilfe der einzelne Mensch in der prinzipiell unzugänglichen Realität durchkommt.‘“ (Weischenberg 1992/1993, zitiert nach Maletzke 1998: 128f.)
Radikale Konstruktivisten vertreten die Meinung, dass der Mensch „immer nur etwas von sich selbst [weiß], niemals aber etwas über die Realität außerhalb seiner selbst“; Maletzke (1998: 128) spricht vom radikalen KonstruktivismusKonstruktivismus, radikaler auch als „erkenntnistheoretischen Agnostizismus“. Die Beschränktheit geht auf die autopoietische Geschlossenheit des Menschen zurück, der von der Umwelt abgetrennt, aber zugleich auch mit ihr gekoppelt ist (vgl. Weber 2003b: 185). Der Begriff „Autopoiesis“ stammt ursprünglich vom Neurobiologen Maturana, dessen Bio-Epistemologie den KonstruktivismusKonstruktivismus wesentlich beeinflusst hat. Die Sinnesorgane und das Nervensystem des Menschen können zwar durch Reize der Umgebung irritiert werden, zur Sinngebung, zum Verstehen kommt es erst im bzw. durch das kognitive System, also im bzw. durch das Gehirn des Menschen.
„Es lassen sich also Signale oder Reize übermitteln, nicht jedoch Informationen oder Bedeutungen. […] Lediglich die Tatsache, dass wir Menschen über ein gemeinsames biologisches Erbe sowie innerhalb der Gesellschaft auch über kulturelle und soziale Gemeinsamkeiten verfügen, macht es möglich, dass wir uns verstehen. Kommunikation ist also ein sehr unwahrscheinlicher und voraussetzungsvoller Prozess.“ (Beck 2007: 47)
Hier drängt sich schon der erste Einwand auf: Wie kann es sein, wenn Kommunikation doch so unwahrscheinlich ist, dass derart häufig kommuniziert wird und diese Kommunikation dann auch noch gelingt? Die Theorie des (radikalen) KonstruktivismusKonstruktivismus steht im Widerspruch zur Alltagswahrnehmung, aber auch zu Wissenschaftlern wie etwa Paul Watzlawick, auf den der berühmte Satz zurückgeht „Man kann nicht nicht kommunizieren.“
Die Rede war von der autopoietischen Geschlossenheit des Menschen: Die autopoietische Systemtheorie sieht Menschen als autopoietische, selbst-referentielle, in sich geschlossene Systeme (Maletzke 1998: 128). Niklas Luhmann überträgt schließlich die Rede von der autopoietischen Geschlossenheit auf soziale Systeme. Luhmanns Systemtheorie findet in den KonstruktivismusKonstruktivismus insofern Eingang (manche sprechen diesbezüglich auch vom operativen Konstruktivismus (vgl. Marcinkowski 2006: 139) oder von konstruktivistischer Systemtheorie (vgl. Weber 2002: 24)), als dass nun auch MassenmedienMassenmedien „als operativ geschlossenes Kommunikationssystem, dessen Kontakt zur Umwelt sich auf Beobachtung beschränkt“, konzipiert werden (vgl. Marcinkowski 2006: 139). Beobachtend konstruieren sie ihre mediale Wirklichkeit. Es sind also nicht nur Menschen, die Wirklichkeit schaffen, sondern auch Medien oder andere Systeme (vgl. Weber 2002: 24).
Diese Erkenntnisse des KonstruktivismusKonstruktivismus blieben nicht ohne Auswirkungen auf die Medienforschung, denn:
„Wenn Realität immer nur über Informationsverarbeitungsprozesse konkret erfahrbar ist, dann läßt sich der Anteil der Verzerrung nie genau bestimmen. Eine Überprüfung der MedienrealitätMedienwirklichkeit an einer von subjektiver Informationsverarbeitung, von Selektion und Strukturierung unbeeinflußten, gleichsam ‚reinen‘ Realität ist nicht möglich.“ (Schulz 1989: 143)
Auch die Arbeiten der Soziologen Berger und Luckmann in den 1960er Jahren („Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“, 1966; dt. 1969) waren für die Wende in der Medienforschung von Bedeutung. Demnach ist Wirklichkeit oder: sind die vielen verschiedenen Wirklichkeiten (Alltagswelt, Kunst, Theater, Religion u.a.) gesellschaftliche Konstruktionen. Erhalten und auch modifiziert wird die Wirklichkeit durch einen „permanenten Konstruktionsprozeß“ – und zwar durch Kommunikation. Dabei „leistet die Sprache die Übersetzung der objektiven in die subjektive Wirklichkeit“ und ist auch die Verbindung zwischen den verschiedenen Wirklichkeiten (Früh 1994: 18).
Medien „als Mittel[n] zur kollektiven Konversation“ kommt bei der Wirklichkeitskonstruktion „eine zentrale Rolle“ zu (Früh 1994: 18). Die kopernikanische Antwort der Medienforschung sieht die Medien als Teil der Gesellschaft und nicht länger als Spiegel der Realität (Abb. 7).
Abb. 7:
Kopernikanische Perspektive: Medien als Teil der Wirklichkeit (Quelle: Burkart 2002: 273)
Die Aufgabe der Medien wird forthin nicht mehr in der Abbildung der Realität gesehen, sondern darin „die Stimuli und Ereignisse in der sozialen Umwelt zu selektieren, zu verarbeiten, zu interpretieren“ (Schulz 1989: 142) und so eine „valable Zweitversion“ der Realität herzustellen und zu verbreiten, nicht zuletzt um „eine gesellschaftlich geteilte Vorstellung von Wirklichkeit als Basis gemeinsamen Handelns zu schaffen“ (Marcinkowski/Marr 2005: 431). Schulz (1989: 141f.) nennt Medien daher auch „Weltbildapparate“: „Die Realität, die in der ‚ptolemäischen‘ Auffassung als Gegenstand und Voraussetzung von Kommunikation angesehen wird, ist in der ‚kopernikanischen‘ Sichtweise deren Ergebnis.“
Wenn die Medien nun aber Wirklichkeit konstruieren und nicht spiegeln, bringt massenmediale Berichterstattung
„niemals ein Abbild der Wirklichkeit zustande. Keine Nachrichtenberichterstattung kann daher auch nur im entferntesten Sinne ‚umfassend‘ oder ‚vollständig‘ sein, denn sie ist ihrem Wesen nach eher das Gegenteil: Ereignisse werden erst dadurch zu Nachrichten, daß sie aus der Totalität und Komplexität des Geschehens ausgewählt werden. Nur durch die Unterbrechung und Reduktion der raum-zeitlichen Kontinuität und der Ganzheit des Weltgeschehens läßt sich Realität umsetzen in Nachrichten.“ (Burkart 2002: 275)
Es gibt nach dem radikalen KonstruktivismusKonstruktivismus, radikaler keine Berechtigung, die mediale Wirklichkeit mit „wirklicher Realität“ zu vergleichen, da beides menschliche Konstruktionen sind (vgl. Maletzke 1998: 130). „‚Die Berichterstattung spiegelt die Realität weder angemessen noch unangemessen. Sie stellt vielmehr ein Konstrukt dar, das nichts anderes reflektiert als die Arbeitsbedingungen der Journalisten‘“ (Kepplinger 2011: 60). Was bedeutet dies aber für die Medieninhaltsforschung? Marcinkowski und Marr antworten auf diese Frage folgendermaßen:
„Inhaltsforschungen, die diesem Paradigma folgen, interessieren sich weniger für die Übereinstimmungen zwischen medialer und nicht-medialer Realität, sondern vielmehr für die spezifischen Prinzipien, denen die mediale Realitätskonstruktion folgt.“ (Marcinkowski/Marr 2005: 431)
Die Forschungsfrage der Medieninhaltsforschung aus kopernikanischer Perspektive lautet also:
„‚Wie konstruieren die Medien die Wirklichkeit?‘ oder genauer: ‚Worin bestehen die Selektions- und Interpretationsregeln, nach denen Realität für uns in den Nachrichtenmedien definiert wird?‘ ‚Gibt es möglicherweise einen allgemeinverbindlichen Konsensus unter den Nachrichtenproduzenten?‘“ (Burkart 2002: 274f.)
Theorien, die dieser kopernikanische Ansatz hervorgebracht hat, sind etwa die FrameFraming-Theorie oder eine weiterentwickelte NachrichtenwerttheorieNachrichtenwert (vgl. Marcinkowski/Marr 2005: 431).
Neben den vielen Einsichten, die dem kopernikanischen Ansatz zu verdanken sind, wirft er auch einige neue, vor allen Dingen medienethische Fragen auf. So scheint er einen gewissen Relativismus nach sich zu ziehen, eine „Beliebigkeit, die jegliche Kritik an den Medien von vornherein ausschliesst“ (Marcinkowski/Marr 2005: 431f.). Wenn alles Konstruktion ist, wie kann dann festgestellt werden, ob eine Berichterstattung objektiv ist oder nicht? Haben Begriffe wie „Wahrheitstreue“ oder eben „ObjektivitätRealität, objektive“ ausgedient? Ist jede Forderung nach Objektivität illegitim? Oder wie Schulz es formuliert:
„Wenn das, was wir für Realität halten, ein soziales Konstrukt ist, das in starkem Maße von den MassenmedienMassenmedien bestimmt wird, müssen wir dann nicht die Vorstellung einer objektiven, unabhängig vom Beobachter existierenden Realität aufgeben – und damit auch wichtige Regeln der journalistischen Profession wie Sachlichkeit, Wahrhaftigkeit, Unparteilichkeit?“ (Schulz 1989: 145)
Radikale Konstruktivisten würden diese Frage klar bejahen (vgl. Maletzke 1998: 130f.). Bedeutet dies also das Ende der MedienkritikMedienkritik? Burkart (2002: 273f.) beschreibt einen Ausweg aus diesem Dilemma: „ObjektivitätRealität, objektive, Wahrheit, Neutralität als Prinzipien journalistischen Handelns“ seien „idealtypische Zielvorstellungen“ bzw. „handlungsleitende Normen, die das faktische Verhalten bestimmen sollen“. Dennoch: Die normative Forderung nach Objektivität würde umgewandelt zu einer unverbindlichen Empfehlung.
Eine weitere Frage, die sich auftut: Wenn alles konstruiert ist – wie kann dann Forschung (natur-, geistes- sozialwissenschaftliche …) noch Allgemeingültiges hervorbringen? Anstatt von ObjektivitätRealität, objektive, von Verifikation und Falsifikation ist im Konstruktivismus die Rede von Viabilität und Validierung (vgl. Weber 2003b: 187).
Es ist nachvollziehbar, dass für die vorliegende Arbeit, die von einer einseitigen, nicht neutralen, negativen Berichterstattung über die röm.-kath. Kirche ausgeht, solche Fragen zentral sind und nicht zuletzt über ihren Sinn und Unsinn entscheiden.
Innerhalb der kopernikanischen Antwort bzw. der zahlreichen Spielarten des KonstruktivismusKonstruktivismus gibt es einige Lösungsansätze, diesen konstruktivistischen Relativismus zu umgehen. An dieser Stelle wird auf zwei Ansätze eingegangen, die fruchtbare Aspekte in die Debatte einbringen. Zum einen ist dies Schmidts Ansatz der zirkulären Wirklichkeitskonstruktion, zum anderen Benteles rekonstruktiverRekonstruktion Ansatz.
Der Medienkulturwissenschaftler Schmidt hat in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts ein non-dualistisches Modell der „zirkulären Wirklichkeitskonstruktion“ entwickelt. Non-Dualismus meint hier die Überwindung des Entweder-Oder von RealismusRealismus und KonstruktivismusKonstruktivismus bzw. der seit der griechischen Philosophie bestehenden Dichotomie von Wahrnehmung und Realität. Dadurch, so Schmidt, wird die Rede von Annäherung (der Wirklichkeitskonstruktion an die Realität) und Scheitern bzw. von der Wahrheit und der Realität hinfällig (vgl. 2000: 55).
Wirklichkeit wird nach Schmidt „im Kreislauf von Kognition, Kommunikation, Medien und Kultur“ erzeugt und hängt nicht nur vom Subjekt und seinem kognitiven System allein ab (Weber 2003b: 187f.). Medien sind semiotische Kommunikationsinstrumente wie natürliche Sprachen, Kommunikationsmaterialien wie Zeitungen, technische Mittel wie Computer oder Kameras, soziale Organisationen wie Verlage oder Rundfunkanstalten sowie Medienangebote wie Zeitungsartikel oder Radiosendungen (vgl. Weber 2003b: 188).
Abb. 8 fasst den Prozess der zirkulären Wirklichkeitskonstruktion gut zusammen:
Abb. 8:
Zirkulärer Prozess der Wirklichkeitskonstruktion (Quelle: Schmidt 1999: 123)
Einerseits lebt jeder in seiner eigenen Wirklichkeit, andererseits geschieht die individuelle Wirklichkeitskonstruktion jedoch in Abhängigkeit von einem gesellschaftlichen Prozess der Wirklichkeitskonstruktion. Schmidt (1999: 124) sieht dabei die Individuen vor allen Dingen als Träger der Konstruktion und „nur bedingt als Gestalter“:
„Mit anderen Worten, Wirklichkeitskonstruktionen von Aktanten sind subjektgebunden, aber nicht subjektiv im Sinne von willkürlich, intentional oder relativistisch. Und zwar deshalb, weil die Individuen bei ihren Wirklichkeitskonstruktionen […] immer schon zu spät kommen: Alles, was bewußt wird, setzt vom Bewußtsein unerreichbare neuronale Aktivitäten voraus, alles was gesagt wird, setzt bereits das unbewußt erworbene Beherrschen einer Sprache voraus; worüber in welcher Weise und mit welchen Effekten gesprochen wird, das setzt gesellschaftlich geregelte und kulturell programmierte DiskurseDiskurs in sozialen Systemen voraus. Insofern organisieren diese Prozesse der Wirklichkeitskonstruktion sich selbst und erzeugen dadurch ihre Ordnungen der Wirklichkeit(en).“
Kultur und Sozialisation sagen uns, wie wir uns in bestimmten Situationen zu verhalten haben. So wird beispielsweise das Gelingen der Kommunikation gewährleistet. Aufgrund unserer Erfahrungen haben wir unserem Gesprächspartner gegenüber eine bestimmte Erwartungshaltung. Mehr als das – wir erwarten, dass unser Gesprächspartner wiederum von uns Bestimmtes erwartet. Dies gilt nicht nur für sprachliche, sondern für jegliche Art von Handlungen. Schmidt spricht diesbezüglich von „Erwartungserwartungen“ sowie von „kollektivem Wissen“ (Schmidt 2000: 56). Geglückte Erwartungserwartungen bestätigen unser kollektives Wissen, bestätigen uns in unserem Tun.
Das kollektive Wissen spielt auch eine bedeutende Rolle in der Frage nach dem Wahrheitsanspruch und nach der (Un-)Möglichkeit empiristischer Forschung. Bei Letzterer handelt es sich nicht um das Herausfinden der Realität, sondern um das Herausfinden von gemäß unserer Kultur und Erfahrung verlässlichen Fakten (vgl. Schmidt 2000: 55). Schmidt vertritt also ebenfalls die konstruktivistische Auffassung, dass Realität in keiner Weise zugänglich ist (nicht so Bentele: s.u.). Empirie ist möglich, sagt jedoch nichts über Realität aus, sondern erhebt „unsere Welt“, unsere gemeinsam konstruierte Welt, über die wir nicht hinaus können.
Was sagt Schmidt zur Wirklichkeitskonstruktion in den Medien? Sie sind „menschliche Konstruktionen, die für menschliche Konstruktionen genutzt werden können. Darum bleibt der Mensch für sie verantwortlich“ (1999: 127). Schmidt lehnt es ab, Medien zu verabsolutieren, sie als Totalität zu sehen. Hinter den Medien stehen soziale Institutionen und Organisationen, die auf den ökonomischen Erfolg des Mediums aus sind (vgl. Schmidt 2000: 100–102).2 Die Wirklichkeitskonstruktion der Medien, ihre gesellschaftlichen Regelungen (etwa die Mediengesetze), aber auch ihre Inhalte werden demnach beeinflusst von „technische[n], ökonomische[n] und rechtliche[n] sowie politische[n] Faktoren“ (Schmidt 1999: 126).
Doch nicht nur die Gesellschaft wirkt auf die Umwelt, auch die Medien nehmen Einfluss auf die Gesellschaft und die gesellschaftliche Wirklichkeitskonstruktion (ganz dem erwähnten Interdependenz-Modell entsprechend, s.o.). Nach Schmidt (2000: 103f.) wird massenmedialer Kommunikation oft unbegrenzte Nutzerreichweite unterstellt, was dazu führt, dass der Eindruck gewonnen wird,
„alle wüßten, was man selbst weiß, und orientierten sich in vergleichbarer Weise an den Wirklichkeitskonstrukten, die in den Medien inszeniert werden. Damit wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, daß Aktanten dazu neigen, solche medialen Wirklichkeitskonstruktionen in ihre eigenen Wirklichkeitskonstruktionen einzubauen, was wiederum zu einer Parallelisierung der individuellen Wirklichkeitskonstruktionen und damit zur Fiktion gesellschaftlicher Homogenität führt. Insofern tragen auch Medienangebote in massenmedialer Kommunikation zur Sozialisation der Aktanten wie zur strukturellen Kopplung von Kognition und Kommunikation bei und erzeugen über die geschilderten virtuellen Strukturen bei Beobachtern erster Ordnung die intuitive Überzeugung der gesellschaftlichen Verbindlichkeit der eigenen Wirklichkeitskonstruktion.“
Gesellschaftliche und individuelle Wirklichkeitskonstruktion sind untrennbar miteinander gekoppelt. Es handelt sich eben um „zirkuläre Wirklichkeitskonstruktion“. Die Kopplung macht schließlich auch die Definition eines Mediums als vermittelnde Instanz sinnlos (vgl. Schmidt 1999: 127). Schmidts Modell „gilt bis heute als Standardmodell des soziokulturellen und medienkulturellen KonstruktivismusKonstruktivismus“ (Weber 2003b: 188).
Nun zum zweiten Ansatz, der das Relativismus-Problem des KonstruktivismusKonstruktivismus zu überwinden versucht und dabei noch etwas weiter zu gehen scheint als der von SchmidtRekonstruktion: Es handelt sich um Benteles rekonstruktiven Ansatz, dessen Basis die Evolutionäre ErkenntnistheorieErkenntnistheorie, evolutionäre bildet und der die Denkrichtungen des RealismusRealismus und des Konstruktivismus in sich integriert. Bentele geht von der Frage aus, warum manche Wirklichkeitskonstruktionen mehr Erfolg haben als andere, warum einige akzeptiert werden, andere hingegen nicht, d.h., er spricht die Objektivitäts- bzw. Viabilitätsproblematik an.
„Während der KonstruktivismusKonstruktivismus – soweit ich sehe – nicht erklären kann, warum bestimmte Wahrnehmungen und Erkenntnisse nun viabel sind und andere nicht, warum sie erfolgreich sind, kann die EE [= Evolutionäre ErkenntnistheorieErkenntnistheorie, evolutionäre] dies erklären. Richtige Wahrnehmungen, wahrheitsgemäße Erkenntnisse, und – im journalistischen Bereich – objektive BerichterstattungBerichterstattung, objektive (s. a. Realität, objektive) sind deshalb erfolgreicher im Vergleich zu falschen Wahrnehmungen, unwahren Erkenntnissen und verzerrter Berichterstattung, weil die entsprechenden Teilstrukturen aufeinander ‚passen‘. Das Konzept der ‚Passung‘ stellt damit gleichzeitig die evolutionsbiologisch fundierte Begründung für die Möglichkeit von objektiver Erkenntnis im Rahmen der EE dar.“ (Bentele 1996: 132)
Die Evolutionäre ErkenntnistheorieErkenntnistheorie, evolutionäre besagt nämlich, dass es sehr wohl objektive bzw. reale Strukturen gibt, die durch Wahrnehmung zumindest teilweise auch erkennbar sind. Bentele stellt diesbezüglich fest (1996: 133): „Auch wenn sich RealismusRealismus weder beweisen noch widerlegen läßt, ist es vernünftig, sie als real anzusehen. Alles Wissen über diese Realität ist hypothetisch, also vorläufig fehlbar, nicht völlig gewiß.“
Der subjektive Erkenntnisprozess ist geprägt von den drei Prinzipien Perspektivität, Selektivität und Konstruktivität (vgl. Bentele 1996: 133f.). Objektive und subjektive Erkenntnisstrukturen sind nicht völlig unabhängig voneinander, sondern „passen aufeinander wie ein Werkzeug auf das Werkstück, wie eine Fußsohle auf den Boden paßt oder die Flossen der Fische zum Wasser passen“. Die Evolutionäre Erkenntnistheorie begründet diesen „Passungscharakter“ aller menschlichen Erkenntnis (Bentele 1996: 134) biologisch.
Bentele macht diese Positionen der Evolutionären ErkenntnistheorieErkenntnistheorie, evolutionäre für seinen rekonstruktiven Ansatz fruchtbar. Dieser unterscheidet verschiedene Realitätstypen und setzt sie zueinander in ein Verhältnis: natürliche, soziale, kommunikative Realität, MedienrealitätMedienwirklichkeit, fiktive Realität. Die drei Wahrnehmungs- bzw. Erkenntnisprinzipien Perspektivität, Selektivität, Konstruktivität werden dabei nicht nur auf das einzelne Individuum bezogen, sondern auch auf den Prozess der öffentlichen Kommunikation (vgl. Bentele 1996: 135). Diese Prinzipien „lassen sich mit kommunikationswissenschaftlichen Teiltheorien wie dem Agenda-SettingAgenda-Setting, der Nachrichtenfaktorentheorie oder dem Kultivierungsansatz gut kombinieren“ (Bentele 1996: 135).
Ähnlich wie Schmidt stellt Bentele (1996: 135) einen Einfluss der Umwelt (bei Schmidt Kultur und Medien) auf die Wirklichkeitskonstruktion fest: „Eine bestimmte Menge von Realitätsausschnitten ist sozial konstituiert, eine Teilmenge dieser Realitätsausschnitte wird durch die Existenz von Medien mitkonstituiert.“ Voraussetzung für die Wirklichkeitskonstruktion ist die Kommunikation (wieder eine Parallele zu Schmidt), die Sprache (Bentele 1996: 137): „Durch verbale Kommunikation sind Menschen in der Lage, außersprachliche Sachverhalte zu repräsentieren oder dies nicht zu tun, also z.B. zu lügen. Aber auch die Fähigkeit zu lügen setzt immer die Fähigkeit, die Welt zu erkennen, voraus.“
„Mediensysteme produzieren trotz aller Unschärfe und trotz aller Unterschiede meist ein ausreichend adäquates Bild über das Geschehen in lokalen, regionalen und internationalen Räumen. Ansonsten könnten wir uns überhaupt nicht über das politische, wirtschaftliche, sportliche oder kulturelle Weltgeschehen informieren.“ (Bentele 1996: 136f.)
Dies bedeutet, dass es eine vom Berichterstatter relativ unabhängige (ontologische) Realität gibt, die in die Berichterstattung auch tatsächlich einfließt – so die erste von fünf Grundpositionen Benteles zur journalistischen Berichterstattung.
„Jeder Akt der Berichterstattung ist nur durch das Wechselspiel von subjektiven Strukturen der Berichterstattung und des Berichterstatters einerseits und objektiven Wirklichkeitsstrukturen andererseits beschreib- und erklärbar.“ (Bentele 1996: 135)
Ereignisse werden von Bentele als „zeitlich, räumlich, örtlich abgrenzbare Realitätsausschnitte“ bzw. „Prozesse“ gesehen, die „bestimmte Charakteristika (Nachrichtenwerte) aufweisen müssen“, damit sie überhaupt in die Berichterstattung Eingang finden (Bentele 2008: 281). Neben Ereignissen können auch Entwicklungen und Trends zu Realitätsausschnitten werden. Sobald über sie berichtet wird, sind sie schon zur MedienrealitätMedienwirklichkeit geworden. Berichtete, bewertete Ereignisse, deren Berichte dann wiederum bewertet werden, können sich zu einem Thema oder einem Realitätskomplex entwickeln (vgl. Bentele 2008: 281f.).
Die zweite Grundposition bezüglich journalistischer Berichterstattung lautet: „Jeder Akt der Berichterstattung ist nur durch das Wechselspiel von subjektiven Strukturen der Berichterstattung und des Berichterstatters einerseits und objektiven Wirklichkeitsstrukturen andererseits erklärbar“ (Bentele 2008: 279). Die MedienrealitätMedienwirklichkeit ist also ein „Produkt der Realitätsverarbeitung durch Journalisten, Redaktionen und Medien“. Sie ist „zumindest in ihrer informierenden Komponente [Nachrichtensendungen, BerichteBericht, aber auch KommentareKommentar usw.] Rekonstruktion der Realität“ (Bentele 2008: 282). Journalistische Berichterstattung vollzieht sich in einem Prozess sogar mehrstufiger Realitätsrekonstruktion (durch Presseagentur, Redakteur, Chefredakteur, Rezipient usw.) (vgl. Bentele 2008: 283).
Die dritte Grundposition wird von Bentele (2008: 279) folgendermaßen formuliert: „Eine bestimmte Menge von Realitätsausschnitten ist sozial konstituiert, eine Teilmenge dieser Realitätsausschnitte wird durch die Existenz von Medien mitkonstituiert.“ MedienwirklichkeitMedienwirklichkeit ist nicht zuletzt wirklich in dreifachem Sinn: wirklich als real existierende konstruierte Zeichenwirklichkeit, die wahrgenommen (gelesen, angesehen, gehört) werden kann; wirklich als Repräsentation anderer Realitäten, die andere Menschen direkt erfahren haben und die die Medien mehr oder weniger präzise (oder wirklich) wiedergeben (vgl. Bentele 1996: 137f.); und wirklich im Sinne von „wirkend“: Die Medienwirklichkeit zieht „gesellschaftliche Auswirkungen und psychologische Wirkungen“ (auf Leser, Zuseher, Zuhörer) nach sich (Bentele 1996: 138). Das heißt, Medienwirklichkeit ist nicht nur Rekonstruktion der Realität, sondern selbst auch Teil davon.
Die vierte Grundposition besagt:
„Nachrichten werden normativ als Rekonstruktion von Wirklichkeit aufgefaßt, unabhängig davon, ob Wirklichkeit sozial konstituiert ist oder nicht. Empirisch ist feststellar, inwieweit sie (mehr oder weniger) adäquate Rekonstruktionen darstellen, oder inwieweit sie verzerrt sind.“ (Bentele 2008: 279f.)
Adäquate Realitätskonstruktion, also „wahrheitsgemäße und objektive Berichterstattung“Berichterstattung, objektive (s. a. Realität, objektive) (Bentele 1996: 135) ist nach diesem Ansatz (im Gegensatz zum radikalen Konstruktivismus) nicht nur möglich, sondern auch überprüfbar. Der Begriff „Verzerrung“, im radikalen KonstruktivismusKonstruktivismus, radikaler seines Sinns entleert, erhält im rekonstruktiven Ansatz wieder eine Bedeutung. Bentele (1996: 135) präzisiert: „Verzerrung ist nicht mit Selektivität identisch, allerdings können aus selektiven Darstellungen – ebenso wie aus perspektivischen oder aus der Konstruktion selbst Verzerrungen entstehen.“
Das Mediensystem enthält im Grunde bereits durch seine Beschaffenheit „eine Art von ‚eingebautem‘ Unschärfemechanismus, ein Prinzip des Medienrelativismus“ (Bentele 2008: 286). Dies ist unumgänglich, weil einerseits journalistische Selektion für die Berichterstattung notwendig und andererseits Falschberichterstattung unvermeidbar ist (Bentele 2008: 286): „[…] die mehrstufige Selektion von Information […] basiert auf einem Set von NachrichtenwertenNachrichtenwert, die – kulturell entstanden – relativ stabil sind und in welche Journalisten jeweils ‚einsozialisiert‘ werden.“Realität, objektive
Doch Selektion muss noch nicht Verzerrung oder Missachtung der RealitätsadäquatheitRealitätsadäquatheit bedeuten. Innerhalb der Mediensysteme gibt es neben der Voraussetzung der Sprache und den angesprochenen NachrichtenwertenNachrichtenwert auch vorgegebene, historisch gewachsene und sich weiterentwickelnde Normen (bei Schmidt in etwa „Kultur“), die einerseits die Rekonstruktionsfähigkeit und andererseits die Realitätsadäquatheit gewährleisten bzw. beeinflussen:
„Die journalistische Objektivitätsnorm und auf der Rezipientenseite der Glaubwürdigkeitsmechanismus können in dieser Perspektive als Gegentendenzen zu medialen Verzerrungstendenzen aufgefaßt werden. Diskrepanzerfahrungen des Publikums sind wichtig, weil sie über negative ökonomische und imagebezogene Auswirkungen auf die entsprechende Medienorganisation deren Präzisionsgrad und deren Bezugnahme auf die soziale Wirklichkeit mitsteuern.“ (Bentele 1996: 137)
Diese Diskrepanzerfahrungen sind schließlich auch ein Indiz, wenn nicht sogar ein Beweis dafür, dass es so etwas wie RealitätsadäquatheitRealitätsadäquatheit bzw. -verzerrung gibt.
Die fünfte und letzte Grundposition steht mit der vierten in unmittelbarem Zusammenhang:
„Objektive Berichterstattung ist daher – verstanden als adäquate Realitätsrekonstruktion – nicht nur normativ sinnvoll, sondern auch faktisch realisierbar. Die Feststellung irgendeiner Art von verzerrender Berichterstattung setzt logisch immer die Möglichkeit unverzerrter Berichterstattung voraus.“ (Bentele 2008: 280)
Die Frage ist nun: Was bedeutet „die Realität adäquat rekonstruieren“? Bentele definiert dazu den Objektivitätsbegriff neu. Objektivität sei über subjektive Akte möglich und weise Merkmale auf wie „Richtigkeit der verwendeten Aussagen“ (Wahrheitspostulat) und „Vollständigkeit in Bezug auf den verwendeten Sachverhalt“ (Vollständigkeitspostulat). Wichtig ist die gleichzeitige Erfüllung beider Kriterien. Eine Aussage kann zwar richtig, in den falschen Kontext gebracht (also entkontextualisiert) jedoch alles andere als „realitätsadäquat“ sein. Ebenso können die berichteten Informationen zwar richtig sein, wichtige andere hingegen („absichtlich oder unabsichtlich“) verschwiegen worden sein (Bentele 2008: 328). Das Vollständigkeitspostulat will dem entgegenwirken. Es besagt, dass „journalistische Aussagen über Ereignisse und Sachverhalte nicht nur richtig, sondern auch angemessen proportioniert zu produzieren“ sind. Vollständigkeit meint damit nicht die hundertprozentige Abbildung der Realität (die ja nicht möglich ist), sondern „die adäquat proportionierte Darstellung komplexer Realität“ (Bentele 2008: 328). Objektive Berichterstattung muss darüber hinaus möglichst transparent und damit auch nachvollziebar und letztlich nachprüfbar sein (vgl. Bentele 2008: 325f.).
Noch einige Präzisierungen: Wie oben bereits erwähnt, ist Selektion nicht gleichzusetzen mit Verzerrung, sie steht nicht im Widerspruch zu Objektivität. Selektion bzw. die Erkenntnisprinzipien „Perspektivität“, „Selektivität“ und „Konstruktivität“ sind für die Berichterstattung unumgänglich, genauso wie die sprachliche Formulierung der einzelnen Realitätsausschnitte. Die Konsequenz ist Bentele zufolge (2008: 326), dass in den berichteten Ereignissen unweigerlich „eine Reihe subjektiver Momente enthalten“ ist. „Allerdings lassen sich ‚notwendig‘ subjektive, also konstitutive Anteile des Subjekts an der Produktion von Texten von solchen unterscheiden, die nicht notwendig sind.“ Selbst unterschiedliche Perspektiven desselben Ereignisses, so Bentele weiter (2008: 327), können immer noch objektive Darstellungen sein; dies ist jedoch nicht der Fall, „wenn eines der allgemeinen Objektvitätsprinzipien oder eine der Objektivitätsregeln verletzt wird (z.B. Richtigkeit; Vollständigkeit; Trennung von Deskription und BewertungBewertung [Stichwort Transparenz], etc)“.
Ein Objektivitätsbegriff, wie er von Bentele beschrieben wird, erlaubt es nun wieder (zumindest teilweise, d.h., dort, wo die Metakriterien der Transparenz und Nachprüfbarkeit erfüllt sind), journalistische Berichterstattung auf ihre Realitätsadäquatheit zu überprüfen.
Ziel dieses Abschnitts war es, die Grundprobleme realistischer und konstruktivistischer Ansätze zu umreißen und die eine oder andere Perspektive aufzuzeigen. Weder RealismusRealismus noch KonstruktivismusKonstruktivismus in ihren radikalen Versionen erscheinen mir für eine medienwissenschaftlicheMedienwissenschaft Untersuchung brauchbar zu sein. Realismus ist zu naiv. Eine objektive Realität ist selbst dem Forscher nicht zugänglich. Auch wenn ihm präzisere Analyseinstrumente zur Verfügung stehen, während wir im Alltag auf unseren Wahrnehmungsapparat allein angewiesen sind, ist seine Herangehensweise, seine Analyse, seine Interpretation der Ergebnisse durch seine Sicht der Wirklichkeit beeinflusst und daher immer subjektgebunden (wenn auch nicht subjektiv und willkürlich, wie Schmidt sagt). Der Realismus greift also zu kurz.
Der radikale KonstruktivismusKonstruktivismus lässt jedoch empirische Untersuchungen sinnlos werden. Jeder ist Konstrukteur seiner eigenen Welt, die Realität, mag sie auch vorhanden sein, ist uns nicht zugänglich. Wir können über sie nichts erfahren. Das einzig Mögliche ist, verschiedene konstruierte Wirklichkeiten miteinander zu vergleichen. Dieser Vergleich bleibt jedoch auf Beschreibung beschränkt. In Bezug auf Berichterstattung kann nicht festgestellt werden, welcher Bericht der objektivere ist, der besser recherchierte. Objektivität wird umgewandelt zu Viabilität. Medienethische Forderungen sind nicht länger normativ, sondern allenfalls Zielvorstellungen, wenn nicht nur leise Empfehlungen.
Auch diese Denkrichtung greift zu kurz. Sie entspricht nicht unseren Alltagswahrnehmungen, den Leserbriefen, in denen falsche Berichterstattungen kritisiert werden, den Widerrufen und Klarstellungen der Redaktionen. Wieso klarstellen, wenn alles nur Konstruktion ist? Warum sollen manche Konstruktionen mehr Gültigkeit haben als andere?
Für die vorliegende Fragestellung wähle ich nun einen Weg dazwischen, den auch Schmidt und vor allem Bentele gehen. Beide haben versucht, mit ihren Ansätzen den „epistemologischen Solipismus“ (Bentele 1996: 131) des radikalen KonstruktivismusKonstruktivismus, radikaler hinter sich zu lassen und empirische Untersuchungen der Medienwirklichkeit bzw. MedienkritikMedienkritik wieder möglich zu machen. Ich ziehe für die Fragestellung meiner Arbeit nun folgendes Resümee:
1 Es ist nicht möglich, die untersuchten Medienwirklichkeiten 1:1 mit der ontologischen Realität zu vergleichen.
2 Da die Realität nach Bentele jedoch zumindest teilweise wahrnehmbar ist, ist es daher auch möglich, die Berichterstattung auf ihre Objektivität hin zu untersuchen, oder: auf ihre RealitätsadäquatheitRealitätsadäquatheit. Objektivitätskriterien sind dabei Richtigkeit, Vollständigkeit, Transparenz und Nachprüfbarkeit.
3 Es ist außerdem möglich, einen intermedialen Vergleich zu ziehen – was auch getan wird, indem erstens drei unterschiedliche österreichische Zeitungen untersucht werden und zweitens drei französische. So werden einerseits sechs einzelne Medienwirklichkeiten, andererseits die Medienwirklichkeiten der zwei betroffenen Länder nachgezeichnet.
4 Die Medienwirklichkeiten hängen nicht nur von den Journalisten ab, sondern auch vom dahinterstehenden System, wie Schmidt und Bentele feststellen. Das heißt, es handelt sich um Medienwirklichkeits (re)konstruktionen auf mehreren Ebenen (Presseagentur, Redakteur, Redaktion usw.). Eine Rolle spielt dabei auch die Kultur (im Sinne Schmidts). Dies wird in Bezug auf den Vergleich der österreichischen und französischen Medienwirklichkeiten besonders interessant: Inwiefern werden hier die verschiedenen Kulturen sichtbar?Inhaltsanalyse