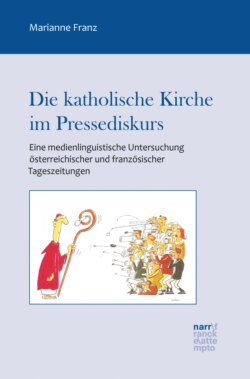Читать книгу Die katholische Kirche im Pressediskurs - Marianne Franz - Страница 38
3.2.3 Sprache-Bild-Bezüge
ОглавлениеStöckl (2004: 243) empfiehlt vom usuellen Terminus „Text-Bild-Relationen“ abzugehen, da er keinen Sinn macht, wenn man, wie in Abschnitt 3.2.1 erläutert, Bilder als (Teil-)Texte versteht. Es geht demnach nicht um die Beziehung zwischen Text und Bild, sondern um die Beziehung von verbalen und visuellen (Teil-)Texten. Die verschiedenen Möglichkeiten, diese Teil-Texte miteinander zu verknüfen, sind derart vielseitig, dass Stöckl ihre erschöpfende Beschreibung bezweifelt. Er versucht dennoch einige Grundmuster der Sprache-Bild-Bezüge nachzuzeichnen und aufzuzeigen, welche Funktionen die beiden Kodesysteme übernehmen (vgl. 2004: 245). Als Grundlage für die Beschreibung der Sprache-Bild-Bezüge ist eine Gegenüberstellung der Unterschiede zwischen den Zeichensystemen „Sprache“ und „Bild“ notwendig. Dazu greife ich auf die übersichtliche tabellarische Darstellung durch Stöckl zurück:
Tab. 8:
Sprache und Bild in der Gegenüberstellung (Quelle: Stöckl 2004: 246f.; eigene Darstellung)
Mit den in der Tabelle enthaltenen Fragezeichen will Stöckl darauf hinweisen, dass diese semantischen Bild-Charakteristika aufgrund der Vielseitigkeit der Bilder und ihrer unterschiedlichen Pragmatik aufgehoben werden können. So können Infografiken etwa auch Illokutionen beinhalten (vgl. Stöckl 2004: 248f.).
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Sprache und Bild liegt sicherlich in der semantischen Klarheit, die bei der Sprache viel größer ist (vgl. Burger 2005: 392). Bilder bleiben „vage und deutungsoffen“ (Stöckl 2004: 248).
Stegu (2002: 24) beschreibt drei große Möglichkeiten des Bezugs zwischen Bildern und ihren Bildunterschriften mit dem eigentlichen Artikel: (1) Abbildung des erwähnten Ereignisses oder eines der erwähnten Ereignisse, (2) Abbildung von etwas, das mit dem Ereignis „metonymisch“ verbunden ist (z.B. eine Szene/der Ort vor/nach/während des Ereignisses; eine Person/ein Gegenstand, die/der „eine relevante Rolle“ spielt; ähnliche Personen/Gegenstände/Orte aus einem anderen Kontext) und (3) Abbildung ohne erkennbaren Zusammenhang zum Artikel („praktisch nur bei Irrtum“).
Hinsichtlich der Sprache-Bild-Bezüge geht Stöckl (2004: 244) von einer „generelle[n] Reziprozität“ zwischen verbalen und visuellen Teil-Texten aus. Um die textuellen Gebrauchsmuster von Sprache-Bild-Bezügen zu beschreiben, berücksichtigt er fünf Kriterien: (1) Art des Bildes (z.B. Bildaufbau, Bildgestaltung), (2) Textstrukturen (z.B. Art der Integration der Bilder in ein sprachliches Textmuster), (3) semantisch-pragmatische Brücke zwischen Sprache und Bild (z.B. Art der Verschmelzung von Bild und Sprache zu einer Gesamtbotschaft), (4) kognitive Operationen zur Sinnstiftung zwischen Sprache und Bild (RekonstruktionRekonstruktion von Textproduktions- und Textrezeptionsprozessen) und (5) Bild-Bild-Bezüge (Art der semantischen Bezüge zwischen mehreren Bildern) (vgl. 2004: 252f.). Auf Basis dieser Kriterien analysierte Stöckl journalistische Texte überregionaler Tages- und Wochenzeitungen und konnte verschiedene textuelle Gebrauchsmuster festmachen, die in Tab. 9 wiedergegeben werden.
Für Details hinsichtlich der einzelnen Gebrauchsmuster verweise ich auf Stöckl (2004: 242–300), der ihnen ein ausführliches Kapitel mit Beispielen journalistischer Sprache-Bild-TexteSprache-Bild-Texte widmet.
Tab. 9:
Systematik wichtiger Sprache-Bild-Bezüge (Quelle: Stöckl 2004: 297–299; eigene Darstellung)