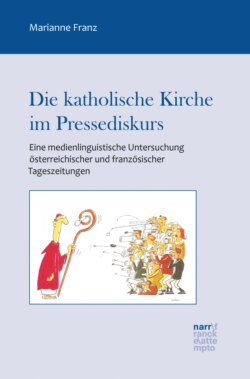Читать книгу Die katholische Kirche im Pressediskurs - Marianne Franz - Страница 41
Оглавление
4 TextlinguistikTextlinguistikPressetextsortenBericht
Innerhalb der umfangreichen Disziplin der TextlinguistikTextlinguistik spielt für die vorliegende Analyse vor allem die Textsortenlinguistik eine Rolle. Sie hilft, die einzelnen Pressetextsorten zu unterscheiden und diesen die untersuchten Zeitungsartikel zuzuordnen.
„In allgemeiner und systematischer Form beschäftigt sich die TextlinguistikTextlinguistik mit den Bedingungen und Regeln des Textverstehens und der Textbildung. Ihre zentrale Aufgabe ist die systematische Beschreibung der allgemeinen Prinzipien der Textkonstitution (der Textbildung), die den konkreten Texten zugrunde liegen, und die Erklärung ihrer Bedeutung für die Textrezeption (das Textverstehen).“ (Brinker 2010: 19)
Als TextMedientext gilt nach Brinker (2010: 19f.) „eine sprachliche und zugleich kommunikative Einheit“, „eine begrenzte, grammatisch und thematisch zusammenhängende (kohärente) Folge von sprachlichen Zeichen, die als solche eine erkennbare kommunikative Funktion (Textfunktion) realisiert“.
Auch die Textsortenlinguistik beschäftigt sich als Teilgebiet der TextlinguistikTextlinguistik mit dem Phänomen „Text“ und ermittelt Textsorten und deren konstitutive Merkmale. Brinker (2010: 125) definiert „Textsorten“ folgendermaßen:
„Textsorten sind konventionell geltende Muster für komplexe sprachliche Handlungen und lassen sich als jeweils typische Verbindungen von kontextuellen (situativen), kommunikativ-funktionalen und strukturellen (grammatischen und thematischen) Merkmalen beschreiben. Sie haben sich in der Sprachgemeinschaft historisch entwickelt und gehören zum Alltagswissen der Sprachteilhaber; sie besitzen zwar eine normierende Wirkung, erleichtern aber zugleich den kommunikativen Umgang, indem sie den Kommunizierenden mehr oder weniger feste Orientierungen für die Produktion und Rezeption von Texten geben.“
Einige Textsorten wie Kochrezept oder Wetterbericht sind stärker normiert als andere wie Zeitungskommentar oder Werbeanzeige. Die Beschreibung und Abgrenzung der weniger stark normierten Textsorten ist nicht immer leicht. Brinker (vgl. 2010: 125–133) nennt drei Kriterien zur Differenzierung von Textsorten, die allerdings nur zur ersten Orientierung dienen können: (1) Textfunktion, (2) kontextuelle Kriterien (Kommunikationsform, Handlungsbereich), (3) strukturelle Kriterien (Textthema, Form der Themenentfaltung). Mithilfe der Textfunktion wird die Textsortenklasse definiert, mithilfe der kontextuellen und strukturellen Kriterien werden die einzelnen Textsorten innerhalb dieser Klasse differenziert. Für eine genauere Charakterisierung müssen außerdem sprachliche Elemente wie Syntax und Lexik berücksichtigt werden. Brinker (vgl. 2010: 126) teilt den Bereich der Gebrauchstexte in fünf Textklassen ein: (1) Informationstexte (z.B. NachrichtNachricht, Bericht), (2) Appelltexte (z.B. Werbeanzeige, KommentarKommentar), (3) Obligationstexte (z.B. Vertrag), (4) Kontakttexte (z.B. Danksagung, Ansichtskarte) und (5) Deklarationstexte (Testament, Ernennungsurkunde). Texte mit Obligations- und Deklarationsfunktion spielen in der Presse kaum eine Rolle. Dort sind es vor allem Informations- und Appelltexte, die zum Einsatz kommen.