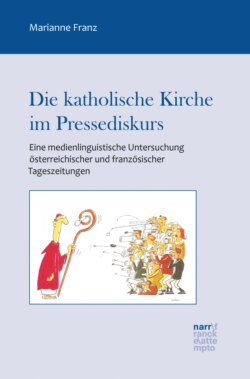Читать книгу Die katholische Kirche im Pressediskurs - Marianne Franz - Страница 28
3.1.2 Besonderheiten der Pressesprache
ОглавлениеEine Pressesprache im Sinne eines einheitlichen Stils aller Zeitungen gibt es nicht. Zurückzuführen ist dies auf die verschiedenen Presseprodukte mit ihren unterschiedlichen Inhalten und verschiedenen journalistischen Textsorten mit ihren jeweiligen Funktionen (vgl. Straßner 2000: 5). Nichtsdestoweniger ist die Verwendung der Sprache in der Presse immer wieder untersucht worden. So versuchte man z.B. von den dort aufgefundenen sprachlichen Phänomenen auf Tendenzen der Gegenwartssprache zu schließen. Ein anderes Interesse lag darin, den Funktionalstil der Presse in Abgrenzung zu anderen Medien wie Rundfunk zu beschreiben (vgl. Lüger 1995: 2). Dahinter steht die Auffassung,
„dass es einen korrelativen Zusammenhang gibt zwischen Außersprachlichem (Tätigkeitsbereiche, Kommunikationssituationen, gesellschaftliche Aufgaben) und sprachlichen Gebrauchsweisen (typische Verwendungsweisen von Ausdrucksmitteln des Systems).“ (Fix/Poethe/Yos 2003: 33)
Allerdings ist es aufgrund der erwähnten Heterogenität journalistischer Texte umstritten, von einem Funktionalstil der Presse zu sprechen, und man untergliedert zumindest in Substile, d.h. in Textsortenstile (vgl. Fix/Poethe/Yos 2003: 33f.). Heute untersucht man vor allem den Sprachgebrauch bzw. stiltypische Merkmale bestimmter Zeitungen rund um bestimmte Themen (wie es in der vorliegenden Arbeit der Fall ist) (vgl. Lüger 1995: 22).
Dass die Mediensprache von gewissen Kommunikationsbedingungen beeinflusst ist, wurde bereits im vorangehenden Abschnitt erläutert. Lüger (1995: 46f.) beschreibt die Kommunikationssituation der Presse in Anlehnung an Maletzke (siehe Abschnitt 2.1) als „öffentlich“, „vermittelt durch das periodisch erscheinende MediumMedium ‚Zeitung‘“, „indirekt“ (Sender und Empfänger räumlich entfernt) und „einseitig“. Die Produktionsbedingungen von Zeitungen mit ihrer „Kette von Bearbeitungsinstanzen“ sowie die notwendigen inhaltlichen Kürzungen bedingen beispielsweise die „sprachliche Verdichtung“, die Pressetexte auszeichnet (siehe unten). Die Periodizität der Presseprodukte, die den KommunikatorKommunikator aufgrund bisheriger Berichterstattung ein bestimmtes Leser-Wissen voraussetzen lässt, spiegelt sich sprachlich in der „Artikelselektion“ oder in der „Verwendung von bestimmten Ausdrücken“ wider. Die Rezipientenorientierung spielt überhaupt eine große Rolle und wirkt sich dementsprechend auf die Pressesprache aus. Pressetexte wollen unterhalten, entspannen, attraktiv sein (und damit den Absatz fördern). Dies und etwa auch die politische Ausrichtung der LeserInnen bzw. der Zeitung, die vom Journalisten vermuteten Erwartungen und Einstellungen der LeserInnen (sogar hinsichtlich der Zeitungssprache) beeinflussen die Auswahl und Gewichtung von Themen bzw. Information sowie die sprachstrukturellen Mittel (z.B. Verwendung von Umgangssprache in der Boulevardpresse). Die sprachlichen Handlungen sollen Erfolg bei den LeserInnen haben (vgl. Lüger 1995: 49). Dies führt uns zu einem weiteren Faktor, der die Pressesprache beeinflusst: die Intentionalität des Textes. Welche Textintention verfolgt wird, wirkt sich auf „die inhaltliche Gliederung“ sowie „die Auswahl und Kombination lexikalischer und syntaktischer Mittel“ aus (Lüger 1995: 51; Näheres zur Textintention siehe Abschnitt 4.1).
Obwohl es die Pressesprache im Grunde nicht gibt, stellt Lüger – wobei er verschiedene wissenschaftliche Studien rezipiert – folgende allgemeine sprachliche Merkmale bzw. Tendenzen fest: