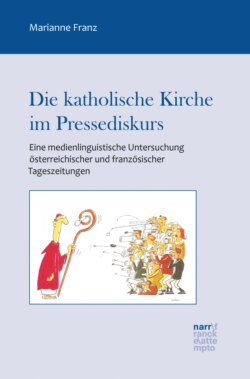Читать книгу Die katholische Kirche im Pressediskurs - Marianne Franz - Страница 32
3.2 Sprache-Bild-TexteSprache-Bild-Texte
ОглавлениеDie Komplexität der Problematik von Sprache-Bild-TextenSprache-Bild-Texte kann hier nur in Ansätzen dargestellt werden. Für Genaueres verweise ich auf die zitierten Werke.
Bestanden Tageszeitungen in ihren historischen Anfängen so gut wie ausschließlich aus sprachlichen Zeichen bzw. Texten, sind sie heute ohne Bilder verschiedenster Erscheinungsformen nicht mehr vorstellbar – und wohl auch nicht mehr verkaufsfähig. Auch die meisten QualitätszeitungenQualitätszeitung haben sich diesem Trend, der ursprünglich vom Boulevard ausging (z.B. von der deutschen BILD-Zeitung) und seit Beginn der 1990er Jahre durch technische Verbesserungen hinsichtlich des Druckverfahrens (vgl. Straßner 2002: 25) vorangetrieben wurde, angepasst. Einige seriöse Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (vgl. Straßner 2002: 24) oder Le Monde haben lange gezögert, Bilder aufzunehmen. Diese Zurückhaltung hinsichtlich der Bebilderung zeugt von der Infragestellung des informativen Mehrwerts von Bildern in der Berichterstattung. Das heißt nicht, dass Bilder keine Informationen transportieren – im Gegenteil. Doch ihr tatsächlicher Nutzen könnte Stegu zufolge (2000: 309) „von einer kritischen Metaposition aus gesehen in vielen Fällen angezweifelt werden“: Wozu dient es zu wissen, wie PolitikerInnen aussehen? Nichtsdestoweniger herrscht in der Presse ein „prinzipieller Bilder-Imperativ“, den sich Stegu unter anderem mit dem primär optischen Wesen des Menschen erklärt, der Bilder sehr leicht und schnell verarbeiten kann (2000: 308f.). TextMedientext hingegen muss „Wort nach Wort aufbereitet werden“ (Straßner 2002: 22f.).
Die Kronen Zeitung ist eine der Zeitungen, die sich die Wirkung von Bildern sehr stark zunutze machen. In ihr sind sehr viele sogenannte BildnachrichtenBildnachricht zu finden, die sich dadurch auszeichnen, dass der Schwerpunkt eindeutig auf dem Bild liegt. Sprachlicher Text ist sekundär. Dieses Verhältnis ist in der Presse im Allgemeinen umgekehrt (vgl. Stegu 2000: 310).
Der nächste Abschnitt befasst sich damit, was ein Medien-TextMedientext bzw. ein Sprache-Bild-Text ist, und durch welche Merkmale sich ein solcher kennzeichnet. Dazu greife ich vor allem auf die Arbeit von Stöckl (2004) zurück, der sich auf sehr umfassende Weise mit der Verknüpfung von Sprache und Bild in massenmedialen Texten auseinandersetzt. Stöckl fasst die vielen Informationen immer wieder in übersichtliche Tabellen zusammen, die für eine Grundlagendarstellung, wie ich sie vornehmen möchte (bzw. aus Platzgründen muss), sehr dank- bzw. brauchbar sind. Einige von ihnen sind nachstehend wiedergegeben.