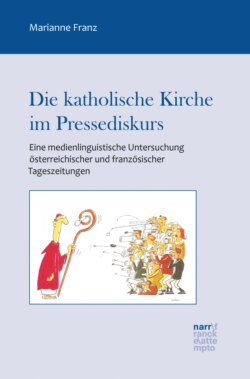Читать книгу Die katholische Kirche im Pressediskurs - Marianne Franz - Страница 25
Оглавление
3 Medienlinguistik
Die vorliegende Arbeit versteht sich als medienlinguistische Untersuchung. Die Medienlinguistik befindet sich an der Schnittstelle zwischen Medien- bzw. KommunikationswissenschaftKommunikationswissenschaft und Sprachwissenschaft. So verortet Beck (vgl. 2007: 157) Medienlinguistik als Teildisziplin der Kommunikationswissenschaft, Perrin (vgl. 2006a: 30) aber als Teildisziplin der Linguistik. Beheimatet ist sie irgendwo dazwischen, sich mit dem mehr oder weniger gleichen Forschungsgegenstand auseinandersetzend, aus beiden Traditionen schöpfend, was Theorien und Methoden anbelangt.
„Die Medienlinguistik und die Kommunikations- und MedienwissenschaftMedienwissenschaft (KMW) befassen sich beide mit öffentlicher Kommunikation – mit der Produktion und der Rezeption von Kommunikationsangeboten, mit den Produkten selbst und mit der Umwelt, die diese Kommunikation beeinflusst und durch sie beeinflusst wird. Interdisziplinäre Zusammenarbeit drängt sich hier auf […].“ (Perrin 2006a: 33)
Ganz ähnlich argumentiert Jannis Androutsopoulos, seit 2009 Professor für Linguistik des Deutschen und Medienlinguistik an der Universität Hamburg (vgl. Androutsopoulos 2009): Er (2003: 1) nennt die Medienlinguistik eine „Bindestrich-Disziplin“, die „Theorien und Methoden der empirischen Sprachwissenschaft“ (z.B. Text- und Soziolinguistik) „mit Konzepten und Fragestellungen der Medienwissenschaften“ verbindet. Dabei hebt sich die Medienlinguistik von den Medienwissenschaften durch ihre „Einschränkung auf die verbal-kommunikativen Aspekte von Medienprodukten“ sowie von Medienproduktion und -rezeption ab:
„Von anderen produktorientierten Ansätzen der Medienwissenschaften (Inhaltsanalyse, Mediensemiotik) unterscheidet sich [die Medienlinguistik] durch ihren Schwerpunkt auf Sprache (gegenüber den anderen Zeichensystemen, die bei der Konstitution von Medientexten mitwirken) sowie durch den Rückgriff auf linguistische Methoden.“
Wie Androutsopoulos weist auch Perrin (2006a: 31) darauf hin, dass die Medienlinguistik disziplinenüberschreitend ist: „Fragen nach einer angemessenen Methodik oder nach dem Sprachgebrauch in publizistischen Medien zum Beispiel greifen über die Medienlinguistik hinaus.“ Forschung ist multi- (Zusammenarbeit verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen), inter- (Zusammenarbeit wissenschaftlicher Disziplinen und gemeinsame Entwicklung von Methoden und Theorien) oder transdisziplinär (Zusammenarbeit wissenschaftlicher Disziplinen mit außerwissenschaftlichen Fächern). Die vorliegende Arbeit wäre demnach interdisziplinär angelegt, da sie linguistische und medien- bzw. kommunikationswissenschaftliche Methoden und Konzepte vereint.
Doch wie lässt sich nun Medienlinguistik definieren? Womit beschäftigt sie sich genau? Perrin (2006b: 177) beschreibt in einem Lexikoneintrag Medienlinguistik als
„Teildisziplin der (Angewandten) Linguistik, die sich mit der Sprache und dem Sprachgebrauch in medial vermittelter menschlicher Kommunikation befasst. ‚Medial‘ bezeichnet dabei ein technisches (Massen-)Kommunikationsmedium (Film, TV, Internet, SMS, Blogs etc); ‚menschliche‘ Kommunikation ist zu verstehen als privat oder öffentlich, mündlich oder schriftlich usw. – mit allen Zwischenstufen.“
Androutsopoulos (2003: 1) beschreibt Medienlinguistik bzw. linguistische Medienanalyse als „Sammelbegriffe für sprachwissenschaftliche Ansätze zur Untersuchung von Massen- und Individualmedien“. Im Vergleich zur Medien- und KommunikationswissenschaftKommunikationswissenschaft, bei der der Fokus sehr stark auf öffentlicher Kommunikation bzw. MassenkommunikationMassenkommunikation liegt, ist der linguistische Medienbegriff weiter gefasst und schließt auch Medien, die der privaten Kommunikation dienen, mit ein (Genaueres zum Medienbegriff in der Medien- und Kommunikationswissenschaft siehe Abschnitt 2.1).
Der Forschungsgegenstand der Medienlinguistik ist demnach grob gesagt die MedienspracheMediensprache (s. a. Pressesprache) bzw. der „Zusammenhang von Sprache und Medien“ (Perrin 2006a: 30). Die grundlegende Forschungsfrage sieht Androutsopoulos (2003: 1) darin,
„wie die technischen und institutionellen Rahmenbedingungen der Medienkommunikation den Sprachgebrauch in Medientexten und -gesprächen prägen […]. Spezifische Fragestellungen der Medienlinguistik betreffen u.a.:
die Auswirkung der technischen Einschränkungen von Presse, Radio, Fernsehen und Internet auf die Realisierung von Sprache;
die Beschreibung massenmedialer Darstellungsformen in ihren formalen und funktionalen Aspekten;
die Beziehung zwischen Sprachgebrauch und Zielgruppen der Medienkommunikation;
die Inszenierung von Mediengesprächen und das strategische Handeln ihrer Akteure;
die unterschiedliche Repräsentation von Wirklichkeit in den MassenmedienMassenmedien und ihre Rolle in der Konstituierung öffentlicher DiskurseDiskurs;
das Verhältnis zwischen Medien und Sprachwandel, den Wandel des Sprachgebrauchs in den Medien sowie den Einfluss der MassenmedienMassenmedien auf den allgemeinen Sprachwandel.“
Für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit sind die technischen und institutionellen Rahmenbedingungen der Presse bedeutsam (z.B. der Produktionsprozess). Von den angeführten Punkten werden Punkt 2 und Punkt 5 (die Beschreibung massenmedialer Darstellungsformen sowie die Repräsentation von Wirklichkeit in der Presse) in der Arbeit berücksichtigt.
Etwas anders beschreibt Perrin (2006b: 177) das typische Erkenntnisinteresse der Medienlinguistik, das nach ihm primär
„den Zusammenhängen von Sprachwandel und Mediennutzung oder von Sprachgebrauch und Medienwirkung [gilt]. […] Die M[edienlinguistik] greift im Sinn Angewandter Linguistik aber auch Probleme der Medienpraxis auf und kann zum Beispiel beitragen zur Untersuchung und Optimierung der Textproduktionskompetenz einer Medienredaktion. Auf einer Metaebene schließlich hinterfragt die M[edienlinguistik] etwa die Tradition der Linguistik, zur Untersuchung von Alltagssprache auf die öffentlich zugänglichen Sprachdaten aus (massen-)medialen Kontexten zu greifen.“Pressetextsorten
Die vorliegende Arbeit ist nicht in der Angewandten Linguistik anzusiedeln, im Sinne dessen, dass sie Gegebenes analysiert, Probleme ortet und im Anschluss den Redaktionen Vorschläge zur Optimierung liefert. Sie möchte sehr wohl aufzeigen, hinweisen und eventuell zur Optimierung anregen, doch das Wie der Optimierung wird nicht behandelt. Thema der Arbeit ist die Beschreibung der verwendeten Sprache, also des Sprachgebrauchs, des Wortschatzes, des Stils und der damit transportierten manifesten und latenten Inhalte und WertungenBewertung.
Hinsichtlich ihrer Methoden zur Datenerhebung und -auswertung hat die Medienlinguistik nichts vollkommen Neues entwickelt, „sondern lehnt sich an Forschungstraditionen der empirischen Sprachwissenschaft an, die dem spezifischen Gegenstandsbereich angepasst werden“ (Androutsopoulos 2003: 5). Die gebräuchlichsten Methoden sind nach Androutsopoulos die Analyse von Textsorten und Gattungen, die sogenannte Variationsanalyse (Analyse des Zusammenhangs zwischen Sprachgebrauch und Zielgruppe, z.B. indem Qualitäts- und BoulevardzeitungenBoulevardzeitung miteinander verglichen werden), die Gesprächsanalyse sowie die Kritische Linguistik und die DiskursanalyseDiskursanalyse. Die kritische Linguistik will aufzeigen, „welche Details der sprachlichen Formulierung zur Reproduktion sozialer Stereotype bzw. Verschleierung politischer Verantwortung beitragen können“ (Androutsopoulos 2003: 7). Perrin nennt außerdem noch die Versionenanalyse („linguistisches Verfahren zur Datengewinnung und -analyse, das sprachliche Merkmale in intertextuellen Ketten verfolgt“ (2006a: 50), also zum Beispiel Zitate nachverfolgt: ursprüngliches Zitat, Agenturmeldung, endgültige Druckversion), Progressionsanalyse (Verfahren zur Untersuchung von Textproduktionsprozessen; vgl. 2006a: 57) und Metadiskursanalyse (Verfahren zur Untersuchung des Sprachbewusstseins, z.B. das Leitbild einer Zeitungsredaktion; vgl. 2006a: 71).
Für die im Rahmen der vorliegenden Arbeit vorzunehmende Analyse der Zeitungsartikel wurde u.a. die Methode der DiskursanalyseDiskursanalyse gewählt (Genaueres siehe Abschnitt 5.3). Im Rahmen des Vergleichs verschiedener österreichischer und französischer Tageszeitungen wird aber auch eine Variationsanalyse vorgenommen, die es ermöglicht auf die verschiedenen RedaktionslinienRedaktionslinie rückzuschließen.
Es folgen nun relevante Forschungsergebnisse der Medienlinguistik.