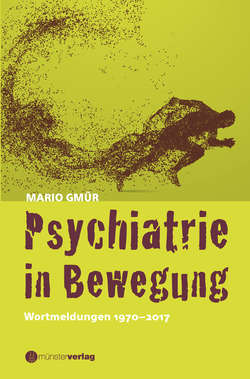Читать книгу Psychiatrie in Bewegung - Mario Gmür - Страница 36
Оглавление5.Die Grenzen der Methadonbehandlung von Heroinfixern
Aus: Schweizerische Ärztezeitung, 1982, Band 63, Heft 8
Die Methadonbehandlung von Heroinfixern wird seit Monaten wieder vermehrt in der Öffentlichkeit diskutiert. Viele Stellungnahmen widerspiegeln eine starke Verunsicherung von Behandelten und Behandelnden. Obzwar die Rahmenbedingungen betreffend Indikation und Durchführung in einem eidgenössischen Gesetz und in kantonalen Verordnungen festgelegt sind, scheint über die Zielsetzung und Praxis der Methadonbehandlung vielerorts Unklarheit zu herrschen. In Ergänzung zu meinem Aufsatz «Die Konzeptualisierung der Methadonbehandlung von Heroinfixern» in der «Schweizerischen Ärztezeitung» Nr. 32/1979 möchte ich noch einmal den Versuch unternehmen, etwas zur Klärung beizutragen. Dabei kann ich wiederum nur meine persönliche Auffassung vertreten, die sich auf eine mehrjährige Erfahrung in der Betreuung eines Methadonprogrammes und auf die weltweite Literatur stützt. Daran knüpfe ich die Hoffnung, dass die zuständigen Gesundheitsbehörden und Ärzte sich von meinen Überlegungen und Argumenten überzeugen lassen, die ich in Form «dringlicher Empfehlungen» vorbringe. Es sind zwei Gründe, weshalb ich mich zu diesem Empfehlungsschreiben veranlasst fühle und auch glaube, dass die ärztliche Freiheit sich einige Abstriche im Bereiche der Methadonbehandlung gefallen lassen muss: Erstens ist der Methadonbehandlung ebenso wie der Heroinsucht eine epidemiologisch-sozialmedizinische Dimension, die auch die Schüler Äskulaps nicht verschont, nicht abzusprechen. Diese kommt unübersehbar etwa schon darin zum Ausdruck, dass das (oft gutgemeinte) unbekümmerte und freizügige Mitgeben von Methadon an Patienten durch wenige Ärzte den Drogenmarkt mit Suchtstoffen überschwemmt und damit die Grenze zwischen Therapie und Drogenhandel verwischt. Zweitens sind die Argumente der auf Abstinenzbehandlung eingeschworenen Therapeuten und Fixer gegen die Methadontherapie (demotivierende Wirkung auf Heilungswillen. Förderung des Schwarzmarktes, Konkurrenzierung der Entwöhnungsbehandlung) immerhin von solchem Gewicht, dass auf die Methadonbehandlung höchste Sorgfalt zu verwenden ist, will sie sich nicht um ihre Chance bringen, ein wertvoller Beitrag zur Linderung des Drogenproblems zu sein. Neben dem epidemiologischen Aspekt betreffen meine Ausführungen, aus mehr therapeutischer Sicht, besonders die Erwartungshaltung, die auf die Methadontherapie gerichtet wird. Sie hängen mit einer Einsicht zusammen, die in den letzten Jahren in vielen Bereichen der Medizin zunehmend an Bedeutung gewonnen hat: nämlich, dass der Medizin nicht nur die Aufgabe obliegt, Heilung zu bringen, sondern auch zu vermitteln, wie Patienten mit ihrer Krankheit leben und sich arrangieren können. Das Nebeneinander so unterschiedlicher Ziele wie Eliminierung und Integration der Krankheit stellt sich mit Bezug auf die Heroinsucht als das Nebeneinander von Abstinenztherapie und Substitutionstherapie dar. Nichts kann eine medizinische Behandlung so sehr belasten wie ein Missverständnis zwischen Arzt und Patient über die Behandlungsziele. Auf einige Quellen von Missverständnissen, welche das Unbehagen über die Methadonbehandlung speisen, möchte ich daher hinweisen.
1. Teilerfolge – keine Heilerfolge
Die Methadontherapie ist grundsätzlich keine auf Heilung angelegte Behandlung, sondern auf weiteste Sicht eine Palliativmassnahme, indem erstens Suchtfreiheit nicht erreicht wird und zweitens der Patient einige Beschwernisse der Behandlung wie den täglichen Erscheinungszwang und vereinzelte vegetative Nebenwirkungen (Obstipation, Schweissausbrüche) auf sich nimmt. Immer wieder aufkeimende Hoffnungen oder gar Forderungen nach Erreichung von Suchtfreiheit durch Entzug von Methadon ziehen regelmässig depressive Enttäuschungsreaktionen mit Rückkehr in die Drogenszene nach sich. Dass es auch Verläufe zur Heilung gibt, ist kein Grund, den Anspruch auf Heilung an den in einer palliativen Massnahme behandelten Patienten heranzutragen. Heilungserfolge, welche Palliativerwartungen Lügen strafen, sind selbstredend besser zu ertragen als ein dauerndes Defizit gegenüber Heilungsansprüchen.
2. Behandlungsfreiheit – kein Zwang
Dass der suchtkranke Fixer neben den vielen Zwängen, in welche ihn das Leben einfängt, einem besonderen Zwang zur Drogenbeschaffung unterliegt, kennzeichnet auch seine Lage, wenn er sich um eine Therapie bewirbt. Dieser pharmakologische Zwang bestimmt, quasi als Mitgift, auch seine Bereitschaft zu einem therapeutischen Arbeitsbündnis und prägt den weiteren Therapieverlauf. Als angesprochene Ärzte können wir dem Patienten nur einen Therapiewahlvorschlag verschiedener von uns definierter Behandlungskonzepte machen, wofür er freie Option haben soll. Grundsätzlich steht ihm jederzeit die Wahl zwischen Drogenszene (mit allen juristischen Implikationen), Entwöhnungsbehandlung oder Substitutionstherapie zu. Über die Entscheidungskompetenz des Fixers und diejenige seiner und unserer Umwelt können wir, über unsere suggestive Einflussnahme hinaus, nicht verfügen. An uns ist es nur, unser Expertenwissen und Therapiekonzepte anzubieten und in der politischen Diskussion allenfalls unseren Standpunkt geltend zu machen.
3. Konzeptualisierung nicht nur bei der Indikationsstellung – sondern auch bei der Durchführung der Methadonbehandlung
Meines Erachtens wurden in der schweizerischen Methadonpolitik (teilweise auch in den USA) unsere Sorgfaltsbemühungen einseitig auf die Indikationsstellung zuungunsten der Durchführung gelegt. Die Beibehaltung von Eintrittsbedingungen ist wohl weiterhin zu garantieren, um der Erzeugung primärer Methadonsucht vorzubeugen und so die Verhältnismässigkeit der Behandlung zu gewährleisten (Mindestalter, Mindestdauer der Heroinsucht, Abstinenzmisserfolge). Eine Frage ist aber, ob der Indikationsarzt neben den festgelegten Minimalkriterien auch in seiner subjektiven Einschätzung der Persönlichkeit des Fixers ein weiteres Kriterium geltend machen soll, um diesem den richtigen Weg zur Palliativmassnahme Methadon oder zur Heilung zu weisen. Zwei Gründe bewegen mich, dieses Beurteilungskriterium eher, wenn auch nicht ganz, geringzuschätzen: Erstens hängt der Verlauf der Heroinsucht in hohem Masse von unwägbaren Glücks- und Unglücksfaktoren ab, wie beispielsweise den unabsehbaren zukünftigen Lebensumständen im Beruf und Beziehungsbereich, die den Verlauf mindestens so determinieren wie alles Vergangene und Gegenwärtige in der Persönlichkeit des Patienten. Zweitens ist die Behandlung der Sucht im Unterschied zu vielen technisch-manipulativen – etwa chirurgischen – Verfahren eine relativ ungezielte Behandlungsform. Die Suchtkrankheit kann in Ermangelung einfacher Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge im Bereiche des Psychischen nicht, oder nur beschränkt, gezielt behandelt werden. Es bleibt uns lediglich, deren Verläufe durch mehr oder weniger gezielte Interventionen zu bessern. Die Eindeutigkeit der Indikation im Hinblick auf einen «richtigen» Heilungsverlauf steht daher auf eher schwachen Füssen. Dringender, als die Indikationsfrage übergebührlich zu einer ausgeklügelten Wissenschaft zu kultivieren, ist es daher, der Realisierung der Therapie vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken und einen soliden Rahmen zu geben.
4. Betreuung – kein psychotherapeutischer Übereifer
Kaum jemand bezweifelt, dass die Methadonabgabe allein nicht genügt, sondern dass diese durch eine begleitende Betreuung ergänzt werden muss. Ebenso ungünstig wie ein betreuerisches Desengagement kann sich aber ein Überengagement auswirken. Es ist unangebracht, den Methadonpatienten zum Freiwild psychotherapeutischen Übereifers zu machen. Betreuung oder Behandlung heisst nicht, den ehemals Heroinabhängigen, im Schraubstock Methadon eingezwängt, durch psychotherapeutische Methoden zu bearbeiten und zur Normalität zu formen. Nur allzu leicht nimmt nämlich dabei beim Therapeuten und beim Patienten die Einstellung überhand, Heilung und Normalisierung dürfen nun nicht mehr länger auf sich warten lassen. Primär ist die Betreuung eine empathische und stützende Begleitung des Methadonpatienten in seinen Nöten, Ängsten und Problemen in einer ausserordentlichen Lebenslage. Es geht darum, dem Patienten bei der Neugestaltung seines Lebens behilflich zu sein. Die Hauptthemen der betreuerischen Auseinandersetzung betreffen im Anfangsstadium gewöhnlich die Umstellung von der Lebensweise eines in der Drogenszene und in der Subkultur beheimateten Fixers auf den Lebensstil eines disziplinierten Methadonpatienten und in späteren Phasen die Diskrepanz zwischen dieser normalisierten und sozialisierten Lebensweise einerseits und der Einengung des Aktionsradius durch die auf unabsehbare Zeit bestehende Abhängigkeit vom Methadon und der Behandlungsstelle andererseits. Daher kann die Betreuung von der Abgabestelle auch nicht an Dritte delegiert werden. Das Hauptanliegen der Betreuung muss es vor allem auch sein, dass zwischen der Abgabestelle und dem Patienten ein möglichst harmonisches Verhältnis entsteht. Das ist auch der Grund, weshalb es unbedingt ratsam ist, die Urinkontrollen auf unerlaubte Suchtstoffe kontinuierlich und konstant während der ganzen Behandlung durchzuführen und nicht überfallsartig als detektivisches Instrument zu handhaben. Wir können die Behandlung harmonischer gestalten, wenn wir bezüglich des «Dreinfixens» und der damit verbundenen Urinkontrolle die Beziehung zum Methadonpatienten auf einem gesunden Misstrauensverhältnis statt auf einem überfordernden Vertrauensverhältnis aufbauen.
Die betreuerische Bewältigung aller mit den Ängsten, Schamgefühlen und Verunsicherungen sowie den lebenspraktischen Belangen verbundenen Probleme nimmt mitunter allein schon eine gute Stunde pro Woche in Anspruch. Zusätzliche psychotherapeutische Bemühungen sind, nach Massgabe der Behandlungssituation und der Fähigkeiten der Betreuer, eine wertvolle sekundäre Möglichkeit.
5. Merke gut: vier Faustregeln
Weil lange Ausführungen den Zweck der Klärung oft verfehlen, will ich meine appellativen Anliegen noch einmal in vier Faustregeln für die Praxis zusammenfassend und in Stichworten formulieren:
1.Das Methadon nicht mitgeben (mit Ausnahme an den von den Gesundheitsdirektionen bewilligten Feiertagen, aufgelöst in zur Injektion nicht geeignetem Orangensaft). Vier Wochen Ferien pro Jahr oder dringende Abwesenheiten sind nur statthaft, wenn am Aufenthaltsort eine kontrollierte Methadonabgabe organisiert werden kann.
2.Sich auf eine langfristige Behandlung im Sinne einer Palliativmassnahme ohne Heilungsanpruch einstellen. (Heilung als Ausnahme kommt vor.)
3.Zwei Urinkontrollen pro Woche auf Heroin, Amphetamin, Kokain, Barbiturate regelmässig während der ganzen Behandlungsdauer.
4.Empathische und stützende Betreuung, aber kein psychotherapeutischer Übereifer.
Ich halte diese Faustregeln fest, weil ich glaube, dass deren Einhaltung dazu beiträgt, aus den Methadonbehandlungen einen konstruktiven Beitrag zur Linderung des Drogenproblems zu machen.
Die Begrenzung, die ich mit dem Titel angekündigt und in Form dieser Faustregeln für die Methadonbehandlungen abgesteckt habe, mag beim einen oder andern Leser das Gefühl der Beengnis hervorrufen. Ich will aber das Gegenteil erreichen: Im grenzenlosen Raum der Sucht sind Grenzziehungen und Strukturgebung für den Süchtigen und den Suchttherapeuten eine Orientierungshilfe, die ermöglicht, in einem konsistenten Behandlungsmodell eine therapeutische Identität zu finden und durch eine allfällige Grenzüberschreitung in Richtung anderer Behandlungsmodelle oder Lebensformen die Selbstbestimmung und Freiheit für die Bewältigung von Suchttendenzen wahrzunehmen. Im Bereiche der Methadonbehandlung sind Abgrenzungen unerlässlich, soll diese nicht, gleichsam als Fortsetzung der Sucht und des Drogenhandels mit therapeutischen Mitteln, den Heroinabhängigen um ein weiteres Glied in der Kette seiner Enttäuschungen bereichern.