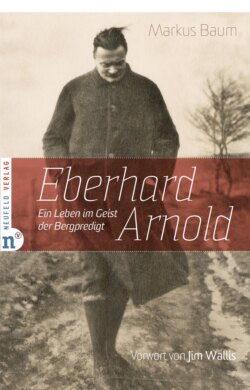Читать книгу Eberhard Arnold - Markus Baum - Страница 11
Einfluss der Eltern
ОглавлениеWer von den Eltern größeren Einfluss auf den Jungen hatte, ist schwer zu entscheiden – jedenfalls war die Qualität der Beziehung sehr unterschiedlich. Der Vater lebte in erster Linie seiner Wissenschaft. Das war zu dieser Zeit vor allem die Geschichte der gallischen Kirche unter Caesarius von Arelate und später dann die Geschichte der Salzburger Protestanten und ihrer Vertreibung unter Erzbischof Firmian im 18. Jahrhundert. Carl Franklin Arnold pflegte sich in sein Studierzimmer zurückzuziehen und verließ es meist nur zu den Mahlzeiten. Wenn er Gesellschaft hatte, dann vor allem mit anderen Dozenten oder älteren Studenten, mit denen er leidenschaftlich disputieren konnte. Morgens las er der versammelten Familie die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine vor. Abends beglückte er die Kinder, die zum Teil noch nicht einmal zur Schule gingen, mit dem „Zauberlehrling“ und anderen Versdichtungen des von ihm hochgeschätzten Geheimrats von Goethe. Selbst mit dem „Götz von Berlichingen“. Weder die Losungen noch Goethe scheinen auf die Kinderschar einen besonders nachhaltigen Eindruck gemacht zu haben – die Kleinen waren vermutlich schlicht überfordert. Erst recht mutete der Vater später den Heranwachsenden hochgeistige Diskussionen zu – über die Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts, über den deutschen Idealismus Fichtes, Schellings und Schleiermachers, über die geistige Größe Carlyles und Macauleys. Carl Franklin Arnolds Begeisterung für die deutschen Nationalphilosophen entsprach sein scharfes Urteil über die Gegenwart des ausgehenden 19. Jahrhunderts: „Unsere Zeit ist im Sinne einer höheren Geistigkeit überaus langweilig, unsere Politik seit Bismarcks Abgang überaus töricht, ja grundverkehrt.“ Höchst selten, dass sich der Vater einmal gelöst und fröhlich gab (er konnte durchaus fröhlich sein, erlaubte es sich aber meist nur bei Familienfesten. Erstaunlicherweise ließ er den Kindern die Beschäftigung mit den wildromantischen Abenteuerromanen von Karl May unbeanstandet durchgehen (Eberhard Arnold brachte es zu einer gewissen Meisterschaft darin, Karl-May-Bände in den Sonntagsgottesdienst zu schmuggeln). Für unbekümmertes, kindliches Herumalbern hatte er kein Verständnis. „Interesselosigkeit“ attestierte er seinen Sprösslingen, wenn er sie einmal bei nichtigem Gerede erwischte.
Die Mutter war praktischer veranlagt. Sie hatte hohe Achtung vor der Bildung ihres Mannes, stellte aber gelegentlich die Nützlichkeit der endlosen Forscherei in Frage oder hätte jedenfalls gerne mehr von ihrem Gatten gehabt („Du hättest Mönch werden sollen“). Elisabeth Arnold geb. Voigt war umtriebig und ständig aktiv (ihr zweiter Sohn eiferte ihr darin nach), außerdem gesellig und gastfrei. Carl Franklin Arnold gewährte ihr – nicht ganz freiwillig – das uneingeschränkte Regiment über den Haushalt. Das erforderte einiges an Organisation – bei insgesamt neun Personen: den Eltern, fünf Kindern und zwei Dienstmädchen. Sie hielt ihre Kinder zu Gründlichkeit und Sorgfalt an. Entspannung gönnte sie sich allenfalls spätabends bei der Lektüre von Zeitungen und Journalen, die damals natürlich noch nicht mit Fotos, sondern mit Stichen und Gravuren illustriert waren. Im Umgang mit Menschen war sie sehr direkt, konnte manchmal sogar hart wirken, war aber im Gegenteil herzlich und zugänglich. Offensichtlich hatte sie auch eine ironische Ader (ganz im Gegensatz zu ihrem Mann). Sie war hochgewachsen, blond und blauäugig. Eberhard Arnold hat ihren eigentümlich zwingenden Blick beschrieben, vermutlich ohne zu ahnen, dass viele Menschen an ihm etwas ganz ähnliches bemerkten. Elisabeth Arnold war bei aller Strenge stets mit ihren Kindern solidarisch und ließ es nie auf einen Bruch ankommen. Carl Franklin Arnold dagegen suchte schon früh die intellektuelle Auseinandersetzung und war bereit, sie um seiner Auffassung von der Wahrheit willen recht weit zu treiben. Jedenfalls durchliefen Eberhard Arnold und seine Geschwister eine anstrengende, aber unterm Strich erfolgreiche Persönlichkeitsschule.
Eine Frage wurde im Haushalt der Arnolds nicht offiziell behandelt, und das war die Sache mit den Standesunterschieden. Bis zu seinem zwölften Lebensjahr hatte Eberhard Arnold recht wenig Berührung mit Leuten aus der „einfachen Bevölkerung“. In der Schule begegnete er fast ausschließlich Jungen aus ebenfalls standesbewussten bürgerlichen Familien. Erstaunt und erregt entdeckte er daher, dass manche Leute viel unkomplizierter und einfacher lebten als er und trotzdem fröhlich und herzlich und echt sein konnten. Er schleppte einen jugendlichen Landstreicher ins vornehme Patrizierhaus seiner Eltern. Er tauschte bei einem Urlaubsaufenthalt in den Bergen seinen Hut gegen die schmuddelige Mütze eines alternden Weltenbummlers und fing sich damit außer den Vorwürfen seiner Eltern auch noch Läuse ein. Er war mit den ausweichenden Auskünften der Eltern nicht immer zufrieden und widersprach gelegentlich: warum sollte jemand, der arm ist, deshalb auch zwangsweise schlecht oder lasterhaft sein? Umgekehrt musste er am Breslauer Johannesgymnasium feststellen, dass Reichtum und ein geachtetes Elternhaus noch lange keine Garantie für Anstand und ein vorbildliches Leben sind. Ein stehlender Fabrikantensohn, flegelnde und boshafte Offiziers- und Beamtenkinder: Im Weltbild des Heranwachsenden kam einiges ins Wanken.