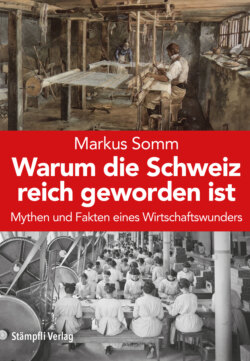Читать книгу Warum die Schweiz reich geworden ist - Markus Somm - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
King Cotton – König Baumwolle
ОглавлениеUrsprünglich stammte die Baumwolle aus Indien. Vermutlich war die Pflanze vor Jahrtausenden in verschiedenen Regionen domestiziert worden, in Indien sehr früh, aber unabhängig davon ebenso im südlichen Afrika und in Amerika. Heute bestimmen vier Sorten den weltweiten Anbau. Die Pflanze, ein hoher Strauch, wächst nicht überall, sondern nur in warmen Zonen. Zudem ist sie giftig. Aber ihre Früchte, diese surreal wirkenden, weissen Büschel aus feinen Haaren, erwiesen sich als sehr geeignet, um daraus Garn zu spinnen und schliesslich Textilien zu fertigen. Da sich Stoffe aus Baumwolle in jedem Klima leichter und bequemer tragen liessen als solche aus Leinen oder Wolle, war es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Baumwolle durchsetzte: Am Ende – nach der industriellen Revolution – hingen ganze Volkswirtschaften von ihr ab. «King Cotton» nannte man sie im Süden der USA. «König Baumwolle» herrschte über die ganze Welt.
Bis die Baumwolle diesen Status errang, vergingen allerdings Jahrhunderte. Nur langsam, wenn auch stetig breitete sie sich aus. Wohl war sie schon in der Antike in Europa aufgetaucht, doch blieb sie damals eine Luxusfaser, die sich nur die Reichsten leisteten, bald ging sie im Westen vergessen. Erst im späten Mittelalter kam sie in Europa von neuem auf, zuerst in Italien, vermittelt von den Arabern, die sie aus Indien einführten oder sie zunehmend selber in Syrien und Ägypten, in Spanien und Sizilien anpflanzten.
Die Italiener lernten schnell. Sie übernahmen von den Arabern nicht nur einen neuen, überlegenen Rohstoff, sondern kopierten Muster, Techniken, Stoffe und Maschinen. In der Folge dehnte sich bereits im 12. Jahrhundert in der Poebene eine gewaltige Textilindustrie aus, wo Tausende von Spinnerinnen und Webern die Baumwolle (und Wolle) verarbeiteten und ganz Europa damit belieferten. Mailand stieg zu deren Zentrum auf.25
Von Italien aus drang die Baumwolle in die übrigen europäischen Länder vor; die Konkurrenten lernten genauso schnell, wie man sie in Stoffe verwandelte, ob in Flandern, Süddeutschland oder auch in der Schweiz. Oft reicherten sie ihre einheimischen Stoffe an, indem sie sie mit Baumwolle verwoben. Es kamen Mischgewebe aus Baumwolle, Leinen und Wolle auf den Markt, die je nachdem anders hiessen: so etwa Barchent oder Schürlitz, Zwilch oder Drillich, Damast und Bombasin. Die Geschichte der Textilindustrie hat Hunderte von merkwürdigen Begriffen hinterlassen.
Aus klimatischen Gründen setzte sich jedoch der Anbau von Baumwolle allein im Süden Europas fest, und auch hier bloss in beschränktem Ausmass. Mazedonien, Griechenland, Malta, Zypern, Süditalien blieben die einzigen Gebiete, wo sie kultiviert wurde, ansonsten vertraute man auf den Import. Ende des 14. Jahrhunderts hatte sich Venedig das faktische Einfuhrmonopol für die begehrte Baumwolle aus der Levante gesichert. Es bestand bis ins 17. Jahrhundert und machte die ohnehin reichen Venezianer noch reicher.
Europas Liebesverhältnis zur Baumwolle entspann sich: Man lernte die Faser schätzen, man trug Baumwolle aus Eitelkeit oder praktischem Verstand, umso mehr als auch ihre Verarbeitung laufend perfektioniert und verbilligt wurde, was Kleider aus Baumwolle schliesslich für jedermann erschwinglich machte. Dazu leistete die oft gleichzeitig aufkommende Verlagsindustrie einen entscheidenden Beitrag – nicht von ungefähr, denn was für Zürich galt, liess sich in vielen alten Gewerberegionen feststellen. Da die Baumwolle ein neuer Rohstoff war, kümmerten sich die Zünfte zunächst kaum darum, und es entstand ein «unzünftiges» Gewerbe, ein Gewerbe ohne Regulierung durch die Zünfte, das sich eben gerade deshalb stürmisch zu entfalten vermochte. Wo die Zünfte das bemerkten und es mit allerlei Interventionen zu bändigen oder zurückzudrängen suchten, zerstörten sie es häufig, wie ausgerechnet in Italien, dessen einst so mächtige Baumwollindustrie im 17. Jahrhundert unterging. Gewiss, dafür gab es verschiedene Gründe, aber unsinnige Regulierungen und der Eifer der Zünfte trugen dazu bei.26
Wenn man den Durchbruch der Baumwolle in Europa Revue passieren lässt, wird leicht erklärlich, warum die Locarner in Zürich eine so enorme Bedeutung erhalten sollten. Italien war für Jahrhunderte der Ursprungsort fast jeder Innovation gewesen. Es stand der Welt (und deren Ideen und Möglichkeiten) wie kein anderes Land offen. Italien hatte eine leistungsfähige Textilindustrie herangezogen, von der die Schweizer nur lernen konnten. Indem die Locarner die Beziehungen zu diesem Land dermassen intensivierten und den Zürchern so einen viel grösseren Markt eröffneten, regten sie das Wachstum des heimischen Gewerbes an. Es muss sich wie ein unwirklicher Entwicklungsschub angefühlt haben: Bisher kaum beachtete Tüchler in Horgen, vergessene Weber in Stäfa, unterschätzte Unternehmerinnen in Zürich produzierten auf einmal für den Weltmarkt – ohne dass sie sich dafür besonders vorgewagt hätten. Das Risiko trugen die unbeliebten Zuzüger aus Locarno.
«Der Beitrag der protestantischen Flüchtlinge zum gewerblichen Aufschwung», hält Ulrich Pfister fest, «bestand wie anderswo um diese Zeit erst in zweiter Linie in der Einführung neuer Technologien, sondern vorab in der verstärkten ‹Kommerzialisierung bäuerlicher Technologien›.»27 Weil dieses Risiko, das die Locarner einzugehen hatten, beträchtlich war, schlossen sie sich zu Handelsgesellschaften zusammen. Jeder Teilhaber schoss etwas Kapital ein, und man stand gemeinsam für Gewinn und Verlust gerade. So wurde das Risiko aufgeteilt. Diese moderne, an die Aktiengesellschaft erinnernde Betriebsform war in Italien längst gebräuchlich – und den Locarnern deshalb vertraut, wogegen sie den Zürchern bisher untersagt gewesen war. Man misstraute diesen abstrakten Konstrukten, wo kein einzelner Eigentümer auftrat, sondern ein Kollektiv von Kompagnons. Auch hier wurde den Zuwanderern nun erlaubt, was den Einheimischen verhasst war, im Wissen, dass sonst die Locarner in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten wären. Man musste die eigenen Regeln aufweichen – um härtere Folgen zu vermeiden.
Als Heinrich Bullinger seine Zürcher zur Solidarität mit den Glaubensbrüdern im Süden überredete, hätte wohl keiner daran gedacht, dass diese 147 Zuwanderer so vieles durcheinanderbringen würden. Alle Locarner, so musste es den Zürchern bald vorkommen, waren inzwischen Händler geworden, ganz gleich, was sie vorher getan hatten. Und sie lagen nicht falsch. Im Sommer 1557 wurde eine zweite Enquete vorgenommen – nachdem sich erneut ein Zürcher über die Locarner aufgeregt und eine Klage gegen sie eingereicht hatte.28 Ausführlich listeten die Beamten auf, wie die Immigranten ihren Lebensunterhalt bestritten: Lodovico Ronco, Gianantonio Rosalino, Guarnerio Castiglione und Andrea Cevio hatten in Zürich und Winterthur Leder, Zwilch (ein Stoff) und Tierfette eingekauft, exportierten sie nach Mailand und brachten Reis zurück. Kurz darauf gründeten sie eine «Compagnie», um einen Warentransport nach Venedig und Mailand zu finanzieren, wo sie wiederum «Spezereien, Tuch, Barett, Schamlott, Seide und anderen Kram» erwarben. Zurück in Zürich, stiessen sie diese Luxusartikel en gros ab, ohne einen eigenen Laden zu besitzen. Ein Barett war ein Hut aus Samt, wogegen Schamlott als besonders mondän galt: Es handelte sich um einen Stoff, der aus Kamelhaar hergestellt wurde, ein Tier, das selbst in Italien nicht bekannt war. Das Tuch kam aus dem Orient.
Auch Giacomo Zareto, der Seckler, der genauso unfreiwillig seinen Beruf aufgegeben hatte, war im Handel untergekommen, «er reist viel ins Welschland [womit Italien gemeint war] und führt Unschlitt hin [Tierfette], um Barette und Seifen nach Zürich zurückzuführen». Die Gebrüder Verzasca verschoben Zwilch nach Mailand und verkauften Seifen und Reis in Zurzach, wo zu jener Zeit regelmässig eine Messe stattfand. Bartolomeo Orelli, der Gerber, exportierte ebenfalls Zwilch nach Mailand und importierte Reis. Selbst Aloisio Orelli genügte der eigene Laden nicht mehr, auch er versuchte sich im Import-Export: Nach Mailand schickte er Zwilch und Tierfette, zurück nach Zürich lieferte er Reis und «den Kram, den er im eigenen Geschäft» an den Mann oder die Frau zu bringen hoffte.
Über Filippo Orell, den Grempler, hiess es im Bericht: «Ist viel im Welschland, hat bisher Zwilch und Leder nach Mailand ausgeführt und dafür Reis eingetauscht.» Auch Andrea Cevio hatte sich in der lombardischen Hauptstadt mit Waren eingedeckt, namentlich: «Seide, Samt, Schürlitz [Barchent], Barett, Schlappen, Federn und anderen Kram», im Winter kaufte er überdies «Würste, Kerzen und Käse aus Piacenza» ein.
Für den weiteren Verlauf der schweizerischen Wirtschaftsgeschichte stellten sich aber nicht diese Kerzen, Würste oder Seifen als folgenreich heraus, die die Locarner aus Italien zurückbrachten, sondern die beiden textilen Rohstoffe Baumwolle und Seide. Denn über kurz oder lang beschränkten sich die Locarner nicht auf den Handel. Bald nahm sich der eine oder andere die Produktion vor. Sie riefen Betriebe ins Leben, um in Zürich Baumwolle oder Seide zu Stoffen zu verarbeiten. Es war der Beginn einer neuen Ära.