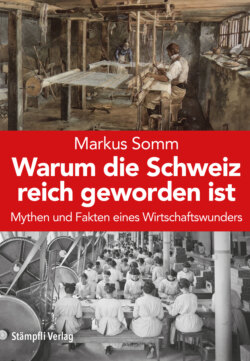Читать книгу Warum die Schweiz reich geworden ist - Markus Somm - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Glück und Elend des Verlagssystems
ОглавлениеDas Verlagssystem war modern, weil es den Verleger in die Lage versetzte, sehr viel mehr produzieren zu lassen als je zuvor – ob es sich nun um Musikdosen handelte, Strümpfe, Taschen oder eben um Textilien. Der Ausstoss war enorm – besonders im Vergleich zum alten Gewerbe, wo der einzelne Handwerker alles selber machte und sich oft tagelang mit einem einzigen Produkt beschäftigte. Im Verlag dagegen fertigten Tausende von Heimarbeitern rastlos Waren in Mengen, wie das vorher, ob auf dem Bauernhof oder in der Handwerksbude, nicht vorstellbar gewesen war. Die zahllosen Arbeiter, die daran beteiligt waren, bildeten gleichsam ein menschliches Fliessband.
Darin zeigte sich Stärke und Schwäche des Verlagssystems zugleich. Der Faktor Mensch. Denn die Produktivität liess sich nicht unbegrenzt steigern. Noch gab es kaum Maschinen, noch stand die Handarbeit im Vordergrund, und nur wenige Innovationen – wie etwa der Einsatz des Spinnrades anstatt der Spindel – beschleunigten die Produktion. Keine Frage, je erfahrener und tüchtiger die Heimarbeiter waren, desto mehr lieferten sie, und desto schneller stellten sie ihre Ware fertig – ab einem gewissen Punkt war es jedoch nicht mehr möglich, noch mehr von ihnen zu erwarten.10
Hinzu trat ein zweiter kritischer Punkt: das numerische Verhältnis zwischen Spinnern und Webern. Um einen einzigen Weber mit ausreichend Garn zu versorgen, brauchte es in der Regel fünf Spinner. Es handelte sich hier um einen regelrechten Flaschenhals, eine Verengung, wodurch die Produktion in der frühen Textilindustrie empfindlich behindert wurde. Gab es zu wenig Spinner oder genauer Spinnerinnen (denn meistens übernahmen Frauen diese Aufgabe), und wurde deshalb zu wenig Garn ausgeliefert, sah sich der Weber gezwungen, untätig herumzusitzen. Aus lauter Verzweiflung reiste der eine oder andere dann selber in der Gegend herum, um das nötige Garn aufzutreiben.
Auf jeden Fall liess sich dieses Problem nicht leicht aus der Welt schaffen. Erst die Maschine bot Abhilfe – dann allerdings auf eine revolutionäre Art und Weise, die alles erschütterte. Solange diese Engpässe jedoch bestanden, stiess die Verlagsindustrie immer wieder an natürliche oder besser gesagt menschliche Grenzen. Wenn der Verleger die Produktionsmenge etwa ausdehnen wollte, weil sich die Nachfrage nach seinen Stoffen erhöht hatte, dann blieb ihm nichts anderes übrig, als mehr Leute einzustellen. Aus diesem Grund wuchs das Verlagssystem zusehends in die Breite, will heissen, Schritt für Schritt erfasste es ein Dorf nach dem andern, dann das ganze Tal, daraufhin die Region, bis schliesslich auch da das Angebot an Arbeitskräften ausgeschöpft war und man sich gezwungen sah, in die weitere Nachbarschaft auszuweichen.
In der Ostschweiz lässt sich dies gut nachvollziehen, der Prozess setzte schon im 15. Jahrhundert ein: Auf der Suche nach Arbeitskräften wandten sich die St. Galler Verleger zuerst in die nächste Umgebung ihrer Stadt. Nachdem dort niemand mehr zu finden war, drangen sie ins Rheintal vor, in den Thurgau, ins Fürstenland und ins Toggenburg, des Weiteren nach Appenzell Ausserrhoden und Glarus, ja selbst nach Graubünden. Doch irgendwann reichte auch hier das Reservoir nicht mehr aus, und man stellte Heimarbeiter im nahen Ausland an, in Vorarlberg vor allem, aber auch im Allgäu und in Oberschwaben, so dass die Ostschweizer Verlagsindustrie zu einer internationalen Arbeitsorganisation heranwuchs, die Zehntausenden von Menschen in der gesamten Bodenseeregion ein Auskommen bot.
«Wir haben es», urteilt Menzel, «bei den St. Galler Verlegern also mit einer Frühform multinationaler Unternehmer zu tun, die ihre Rohstoffe, Baumwolle und Farbstoffe, aus dem Nahen Osten, Brasilien und den Antillen bezogen, ihre Produkte in den Nachbarkantonen, in Österreich, Bayern, Baden und Württemberg herstellen liessen, um sie dann in Frankreich und dem übrigen europäischen Ausland abzusetzen.»11
Dass es nicht ganz anspruchslos war, ein solch gewaltiges, dezentrales Unternehmen zu überschauen und zu betreiben, liegt auf der Hand. Zwar blieb der Verleger stets die zentrale Figur, um die sich alles drehte, doch je mehr Heimarbeiter er unter Vertrag nahm, desto weniger sah er sich in der Lage, sie alle zu besuchen. Bald kamen deshalb Mittelsmänner oder eine Art Agent auf, die sich zwischen Verleger und Produzenten schoben, teils als Angestellte des Verlegers, teils als Selbstständige. Man nannte sie Fergger oder Trager, später auch Spediteure. Ihr Auftrag bestand darin, den vielen Heimarbeitern den Rohstoff ins Dorf zu bringen, um nach einer gewissen Zeit das verarbeitete Produkt einzusammeln. Handelte es sich dabei um das versponnene Garn, also ein Zwischenprodukt, leitete es der Fergger an die Weber weiter, wo er den vollendeten Stoff zwei, drei Wochen später wieder einzog. Gleichzeitig prüfte er dessen Qualität, zeigte und trug den Heimarbeitern neue Muster auf, bezahlte ihren Lohn und lieferte die Ware anschliessend in die Stadt, wo sie der Verleger an sich nahm, weiterveredelte, um sie dann in alle Welt zu exportieren.
Manchmal gelang es den Ferggern, ja selbst Heimarbeitern oder eigenständigen Webern, sich ebenfalls zu Unternehmern und Fabrikanten aufzuschwingen, was die Verleger in der Stadt natürlich gar nicht gerne sahen und mit allen Mitteln zu hintertreiben suchten. Aber dezentral hiess dezentral: Es fiel etwa den St. Gallern schwer, ihre Zwischenhändler und Agenten in Ausserrhoden unter Kontrolle zu halten, zumal das Appenzellerland politisch von der Stadt unabhängig war, ja sich als einer der dreizehn Orte der Eidgenossenschaft eindeutig mächtiger fühlte, wogegen St. Gallen bloss ein zugewandter, also geduldeter Ort darstellte. Die reformierte Stadt war zwar eine unabhängige Stadtrepublik, aber sie besass keinerlei Territorium.
So entstanden in Appenzell Ausserrhoden bald eigenständige Unternehmen – die den St. Gallern das Leben schwer machten. Ähnliches trug sich in Arbon, Hauptwil oder Rorschach zu, ebenfalls Territorien, wo die St. Galler politisch nichts zu sagen hatten, entweder weil sie wie Rorschach dem Fürstabt von St. Gallen gehörten oder wie die beiden anderen Orte im Thurgau lagen, in einer Gemeinen Herrschaft der Eidgenossen. Politische Zerstückelung, ein Zustand, der die ganze damalige Schweiz kennzeichnete, bedeutete oft auch mehr Freiheit, obschon sie niemand bewusst hätte gewähren wollen.
Einen ungleich härteren Durchgriff besassen dagegen die Stadtzürcher Verleger. Ihre Stadt beherrschte ohnehin den ganzen Kanton. Wer dort auf dem Land, ob in Stäfa oder Wädenswil, einen eigenen Verlag in Konkurrenz zu einem in der Stadt aufziehen wollte, den traf die Staatsgewalt unerbittlich. Zwar bedienten sich die Stadtzürcher Verleger noch so gerne der Heimarbeiter auf dem Land, aber dass sich dort auch eigenständige Unternehmen herausbilden sollten, das war keineswegs erwünscht. Mit Vorschriften und diversen Schikanen wurde jede unternehmerische Initiative erstickt – jedenfalls war dies das Ziel. In der Realität erwies sich dies als leichter gesagt als getan. Elend der Regulierung. Die Tatsache, dass die Zürcher ihre Gesetze unablässig verschärften, zeigt, wie schwierig es war, den Unternehmern auf dem Land das Geschäft zu verderben.
Dass die Verleger in der Stadt – ob in Zürich, St. Gallen oder in Basel – sich bemühten, ihre privilegierte Stellung zu bewahren, ist verständlich, und doch entbehrt es nicht der Ironie. Man könnte das Verhalten der Verleger auch als verlogen bezeichnen. Denn sie selbst waren nur aufgekommen, weil sie sich den Gesetzen der Stadt entzogen hatten. In ihrem Fall den Gesetzen der Zünfte.