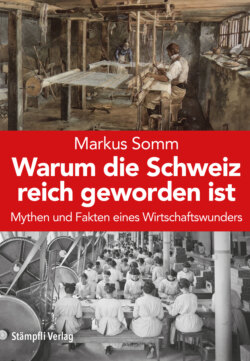Читать книгу Warum die Schweiz reich geworden ist - Markus Somm - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Inhalt Einleitung
ОглавлениеIm September 2020 überklebten ein paar junge linke Aktivisten das Schild des Escher-Wyss-Platzes in Zürich mit dem Namen von Rosa Parks, einer amerikanischen Bürgerrechtlerin. Sie wollten damit gegen eine angebliche Verstrickung von Alfred Escher in die Sklaverei protestieren.1 Escher (1819–1882), ein berühmter Staatsmann und Unternehmer des 19. Jahrhunderts, stand in der Kritik, weil zwei seiner Onkel mit Sklaven eine Kaffeeplantage auf Kuba betrieben hatten. Insgesamt besassen sie rund neunzig Sklaven. Als einer der Onkel 1845 starb, beerbte ihn Eschers Vater. Er verkaufte die Plantage und strich das Geld ein. Gut möglich, dass irgendetwas davon schliesslich bei Alfred landete, als er Jahre später das Erbe seines Vaters antrat.2 Ob der Vater beim Verkauf der Plantage überhaupt einen Gewinn realisiert hatte, ist offen, zumal er seinen Brüdern einst das Geld für den Kauf des Betriebs vorgestreckt hatte. Wenn, dann war es unter dem Strich vermutlich ein kleiner Betrag, bestimmt nicht so gross, dass damit der Gotthardtunnel hätte finanziert werden können, wie ein deutscher und ein niederländischer Historiker vor kurzem behauptet haben.3 Alfred Escher hatte seinerzeit den Bau der Eisenbahn durch den Gotthard initiiert. Wusste er von den Sklaven? Sicher, denn er hatte, so weiss man heute, seinem Vater beim Verkauf der Plantage geholfen. Das war alles. Darüber hinaus, so Joseph Jung, der beste Kenner seiner Biografie, war er nicht involviert gewesen: «Dieser war nun aber nie in seinem Leben auf Kuba, noch hat er je Sklaven gehalten.»4
Offensichtlich unterlagen die Jungsozialisten aber einem Irrtum: Der Platz in Zürichs Westen heisst Escher-Wyss-Platz, weil sich hier früher der Standort der Firma Escher Wyss befand. Alfred Escher hatte nie etwas mit dem Unternehmen zu tun. Der Gründer dieser einstigen Zürcher Weltfirma, Hans Caspar Escher (1775–1859), war zwar mit ihm verwandt, aber so weit aussen, dass man Escher Wyss beim besten Willen nicht vorhalten konnte, mit kubanischen Sklaven Geld verdient zu haben. Der letzte gemeinsame Vorfahr war ein Urururur-Grossvater von Alfred Escher gewesen. Er hatte von 1626 bis 1710 gelebt.
Dieser Protest am falschen Objekt ist vielleicht symptomatisch für den Stand der Debatte: Warum ist die Schweiz so reich geworden? Symptomatisch, weil manche Leute Alfred Escher nicht mehr von Escher Wyss unterscheiden können. Symptomatisch aber vor allem, weil immer neue, wildere Theorien aufkommen, wenn es darum geht, die Karriere der Schweiz zu erklären.
Tatsächlich wirkt diese Karriere auf den ersten Blick sonderbar. Das kleine Land mitten in den Alpen verfügt über keine nennenswerten Rohstoffe, es liegt fernab von den Meeren, Berge und Täler herrschen vor, von Zivilisation, so möchte man meinen, war lange nichts vorhanden. Mit rechten Dingen konnte das doch nicht zu- und hergegangen sein.
Jahrelang hatte es geheissen, das Bankgeheimnis habe den Reichtum der Schweiz begründet. Oder man führte ihn auf die Tatsache zurück, dass das Land im 20. Jahrhundert von keinem Weltkrieg verwüstet worden war, was die Schweizer, schlau und eigensüchtig, wie sie waren, mit allerlei schmutzigen Geschäften zu verhindern wussten – besonders während der Gewaltherrschaft der Nazis in Deutschland. Die Unterstellung wurde nie belegt, doch blieb sie haften. Zu eingängig, da moralisch aufgeladen, schien diese Erzählung, die begreiflich machte, was so schwer zu begreifen war.
Neuerdings ist die Sklaverei in den Vordergrund gerückt. Historiker, aber auch Politiker gehen davon aus, dass die Schweiz – obschon ohne Kolonien – eben doch aus dem Kolonialismus und dessen grauenhaftester Institution, der Sklaverei, Nutzen gezogen hat. Wenn auch selten der ganze Wohlstand des Landes damit erklärt wird, so doch ein wesentlicher Teil davon, zumal die gleichen Leute den Kapitalismus des Westens insgesamt mit diesem Unrecht in Zusammenhang bringen. Wohl erscheint diese These so plausibel, weil sie vom schlechten Gewissen lebt, das die Europäer und Nordamerikaner gelegentlich befällt, wenn sie sich die bedrückenden Verhältnisse in der Dritten Welt vor Augen halten: Warum sind wir so reich – und diese ist so arm?
Den meisten dieser Theorien ist eines gemeinsam: Sie unterschätzen das Land. Zum einen, was die ungeheure Wirtschaftskraft der Schweiz anbelangt, zum andern verkennen sie, wie lange schon die Schweiz darüber verfügt. Ein Bankgeheimnis allein genügt nicht, um eine der leistungsfähigsten Exportindustrien der Welt hervorzurufen – die hier war, bevor man überhaupt von Schweizer Banken gesprochen hatte. Der Reichtum der Schweiz war schon in ausserordentliche Höhen gestiegen – Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, als Europa in eine dreissigjährige Periode der Selbstzerstörung abglitt. Und die Sklaven in Amerika lieferten Rohstoffe nach Europa, zu einem Zeitpunkt, da die Schweiz längst industrialisiert war. Die Sklavenarbeit stellte nicht die blutige Voraussetzung ihres Aufstiegs dar.
Tatsächlich beginnt die Geschichte der reichen Schweiz viel früher, als den meisten heute bewusst ist, und die Ursachen ihres erstaunlichen Aufstiegs sind andere als jene, von denen man gemeinhin so hört. Bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts wiesen einzelne Gegenden der Schweiz einen so hohen wirtschaftlichen Entwicklungsstand auf, wie ihn in Europa nur wenige andere Regionen erreichten. Es gab hier zahllose Produktionsstätten und Handelshäuser, und schweizerischen Unternehmern und Kaufleuten begegnete man auf den wichtigen Marktplätzen des Kontinents, es wurden Rohstoffe aus aller Welt eingeführt, verarbeitet, veredelt und in rauen Mengen nach Europa und Übersee verkauft. Export war König. Wenn es ein Land gab, das zu den frühen Pionieren des Kapitalismus und der Globalisierung zählte, dann die Schweiz, der Aussenseiter und Sonderling unter den Nationen.
Es ist diese sehr weit zurückreichende Tradition des wirtschaftlichen Erfolgs, die zu einem massgeblichen Teil erklärt, warum es diesem Land schon so lange so gut geht. Je nachdem, welche Statistik man heranzieht, gehört die Schweiz nach wie vor zu den fünf reichsten Ländern der Erde, gemäss Internationalem Währungsfonds lag sie im Jahr 2021 mit einem Bruttoinlandprodukt pro Kopf von rund 95 000 $ auf Rang 2, gemäss Weltbank auf Rang 4, während die UNO sie auf Rang 3 verortete.5 Noch sind vergleichbare Zahlen für das 18. Jahrhundert nicht greifbar, auch wenn die Wissenschaftler sich darum bemühen, diese historischen Daten zutage zu fördern, aber mit Sicherheit ergäbe sich ein ähnliches Bild: Die Schweiz hätte sich schon zu jener Epoche in den vorderen Rängen wiedergefunden. Es trifft nicht zu, dass sie bis noch vor wenigen Jahrzehnten ein Armenhaus gewesen ist.
Das wirkt heute umso bemerkenswerter, als die Schweiz im 18. Jahrhundert politisch gesehen das vielleicht rückständigste Staatswesen des Kontinents darstellte: Was als alte Eidgenossenschaft in die Geschichte eingegangen ist, war eine einmal fröhliche, dann zerstrittene, immer chaotische, oft handlungsunfähige Ansammlung von dreizehn souveränen Orten, den Vorläufern der heutigen Kantone – jeder für sich ein eigener Mikrostaat. Hinzu kamen ein paar Verbündete, die «zugewandten Orte», sowie viele gemeinsam verwaltete Untertanengebiete; im grossen Ganzen entsprachen die Aussengrenzen dieser alten Eidgenossenschaft jenen der aktuellen Schweiz. Das war jedenfalls kein moderner Staat, sondern ein Relikt aus dem Mittelalter, das man in Europa belächelte oder für überholt hielt. Wie lange noch hatte es Bestand? Zumal es sich auch militärisch und aussenpolitisch um einen Zwerg handelte, der stets unter der berechtigten Paranoia litt, bald von den Riesen in der Nachbarschaft überwältigt zu werden. Wenn je ein Kleinstaat seit Jahrhunderten überlebt hatte, dann die Schweiz – aber für immer? Als gegen Ende des 18. Jahrhunderts das unglückliche und viel umfangreichere Polen von den drei Grossmächten Preussen, Russland und Österreich kaltblütig aufgeteilt wurde, gab es in der Schweiz viele Melancholiker, die sich fragten, ob dies nicht auch der Eidgenossenschaft widerfahren könnte.
Anarchie, Ohnmacht, Streitsucht: All dies hat der damaligen Schweiz wohl nicht sonderlich gut getan, aber sie auch nicht allzu stark behindert. Ich möchte in diesem Buch die «Karriere eines Landes» schildern. Dabei erzähle ich die Geschichten von Unternehmern, die reüssierten oder scheiterten, ich folge Kaufleuten auf ihren verschlungenen Wegen auf den Weltmärkten oder ihrem Höllenritt in den Abgrund, ich berichte von Werkspionen aus bester Familie, die in Italien Geschäftsgeheimnisse stahlen, und sich trotzdem für gute Protestanten hielten, last, but not least beschreibe ich einen Triumph: Seit der Reformation kamen Tausende von Flüchtlingen und Einwanderern in der Schweiz an. Zuerst freundlich empfangen, dann abgelehnt, oft schikaniert, verzweifelten die einen, während die anderen sich doch durchsetzten und ganze Industrien ins Leben riefen, die sonst wohl nie in der Schweiz entstanden wären. Wenn sie starben, wurden sie als Bürger in ihrer neuen Heimat begraben, angesehen und betrauert. In dieser Hinsicht war das Land eine Krisengewinnlerin, aber eine, die sich dafür nicht zu rechtfertigen hatte. Inmitten von Kriegen und Verfolgungen seit gut fünfhundert Jahren blieb vielleicht kein anderes Land in Europa trotzdem vernünftig und friedlich. Man zahlte dafür allerdings einen Preis: den Preis einer unheroischen Existenz – und erhielt dafür ein gutes Leben. Die meisten Einwohner der Schweiz zogen das Letztere wahrscheinlich vor.
Wann fing diese Karriere an? Streng genommen vor etwa 135 bis 25 Millionen Jahren, dann wurden die Alpen aufgefaltet, ein Gebirge, ohne das die Geschichte der Schweiz – auch ihre Wirtschaftsgeschichte – kaum zu verstehen ist. Ein solcher Ansatz wäre sicher allzu exzentrisch. Stattdessen möchte ich mich auf eine etwas spätere Periode konzentrieren: auf die Jahre zwischen 1500 und 1830. Ich komme darauf, weil ich so eine Vorgeschichte, ein Heldenepos, eine Tragödie und ein Happy Ending zugleich erzählen kann.
Wenn man davon ausgeht, dass die industrielle Revolution das zentrale Ereignis jeder Wirtschaftsgeschichte darstellt, dann gibt es nur ein Vorher und ein Danach.
In den Jahren um 1780 waren in England ein paar phänomenale und entscheidende Innovationen gemacht worden: Spinnmaschinen, mechanische Webstühle und Dampfmaschinen steigerten über Nacht die Produktivität der englischen Industrie. Weil niemand so billig so viel zu produzieren vermochte, stürzten die Preise für viele Güter in den Keller, insbesondere Textilien, und England eroberte die Welt – nicht mit Truppen, sondern mit Maschinengarn. Wer mitzog, konnte viel Geld verdienen, wer zu spät kam, den bestrafte der Markt. Das Maschinenzeitalter brach an.
Davon war auch die Schweiz stark betroffen, ja vielleicht kein anderes Land so stark wie sie. Hier stand eine der grössten vorindustriellen Textilbranchen Europas. Unruhe in den Alpen. Man hatte viel zu verlieren. Vor der industriellen Revolution war die Schweiz schon reich gewesen – nachher war sie noch reicher, in den Jahren dazwischen war sie in die Armut versunken. Wie war das möglich? Wie überstand ein Land, das wirtschaftlich schon höchst entwickelt war, die industrielle Revolution, von der es zunächst ruiniert zu werden drohte, aus der es danach aber Nutzen zog wie wenige sonst?
England war vorangegangen und hatte alle seine Konkurrenten aus dem Feld geschlagen. Kaum hatten sich die Europäer auf dem Kontinent von diesem Schock erholt, setzte allerdings eine Aufholjagd ein, an deren vorderster Spitze sich die Schweiz bewegte. Ausgerechnet während der napoleonischen Zeit, da schier endlose Kriege nahezu ganz Europa verwüsteten, nachdem Revolution und Fremdherrschaft auch die Schweiz zerlegt hatten, wurden im Land die ersten Maschinen aufgestellt, es schossen mechanische Spinnereien in die Höhe, es wurde eine der ersten Maschinenfabriken des Kontinents gegründet. Die Firma hiess Escher Wyss. Das Jahr war 1805.
1830 hatte sich die Schweiz zu einem modernen Industrieland verwandelt. Ein früher Vorreiter der Industrialisierung. Und das englische Parlament, etwas beunruhigt, schickte 1835 einen Experten ins Land, der herausfinden sollte, warum die Schweizer Unternehmer den Engländern jetzt auf sämtlichen Weltmärkten so wirkungsvoll Konkurrenz machten.
Ich breche meine Erzählung deshalb um 1830 ab. Eine erste Etappe war erreicht, die entscheidende wohl. Was nachher folgte, baute darauf auf, innert weniger Jahrzehnte entstanden die meisten jener Firmen, die wir heute noch kennen. Sulzer, BBC, Nestlé, die Basler Chemie, schliesslich Banken und Versicherungen. 1848 wurde der moderne Bundesstaat ins Leben gerufen. Zu jenem Zeitpunkt zählte die Schweizer Textil- und Maschinenindustrie bereits seit Jahren zu den modernsten der Welt.
Um dieses Buch zu schreiben, begab ich mich nicht ins Archiv und betrieb keine eigene Forschungsarbeit. Ich stütze mich weitgehend auf Sekundärliteratur. Diese allerdings ist unerschöpflich. Was Reformation, industrielle Revolution, Sklaverei und napoleonische Zeit anbelangt sowieso, aber auch was mein engeres Erkenntnisinteresse betrifft: Zur schweizerischen Wirtschaftsgeschichte liegen zahllose, ausgezeichnete Werke vor – wenn auch vielleicht die meisten ihren Fokus auf eine Zeit richten, die nach meinem Untersuchungszeitraum liegt. Ich nenne bloss die wichtigsten: Eine nach wie vor souveräne Übersicht bietet Jean-François Bergier in seiner «Wirtschaftsgeschichte der Schweiz»6, die er schon in den 1980er Jahren publiziert hat. Unverzichtbar, um den frühen Durchbruch der schweizerischen Textilindustrie zu erfassen, ist Walter Bodmers Abhandlung zum Thema: «Die Entwicklung der schweizerischen Textilwirtschaft im Rahmen der übrigen Industrien und Wirtschaftszweige» aus dem Jahr 1960, ferner Peter Dudziks «Innovation und Investition» (1987) sowie Ulrich Pfisters Standardwerk zur zürcherischen Protoindustrie, «Die Zürcher Fabriques», das 1992 erschienen ist.
Zwar gilt Leo Weisz als ein Aussenseiter unter den Historikern, mehr Wirtschaftsjournalist als Wissenschaftler, trotzdem oder vielleicht gerade deshalb zeichnete ihn ein scharfer Blick für Zusammenhänge aus, die andere übersahen, speziell ausgeprägt war sein Gespür für vergessene Anekdoten. Seine vielen Bücher sind eine Fundgrube. Mehr als das hinterliess natürlich Hans Conrad Peyer, einer der grossen Wirtschaftshistoriker unseres Landes, ich profitierte besonders von seiner «Verfassungsgeschichte der alten Schweiz» sowie von seiner rigoros quellenbasierten Studie: «Von Handel und Bank im alten Zürich». Das Gleiche gilt für Rudolf Brauns «Das ausgehende Ancien Régime in der Schweiz» und Ulrich Menzels «Auswege aus der Abhängigkeit». Von keinem Autor habe ich vielleicht mehr über den schweizerischen Sonderweg gelernt. Glänzend ist schliesslich Joseph Jungs «Das Laboratorium des Fortschritts. Die Schweiz im 19. Jahrhundert», worin er sich vorwiegend um die Zeit nach 1830 kümmert. Wir steuern gewissermassen die Vorgeschichte bei.
Zum Schluss noch drei Hinweise auf die internationale Literatur, die ich konsultiert habe: Die amerikanische Ökonomin Deirdre McCloskey legte unlängst eine Trilogie zur Geschichte des westlichen Kapitalismus vor, «The Bourgeois Era», die wenig Fragen offenlässt. Ebenso umfassend ist die Arbeit von Pim de Zwart und Jan Luiten van Zanden, zwei niederländischen Autoren: «The Origins of Globalization. World Trade in the Making of the Global Economy, 1500–1800». Last, but not least schrieb Thomas McCraw mit «Prophet of Innovation» eine brillante Biografie über Joseph Schumpeter, den vielleicht anregendsten Theoretiker, wenn es darum geht, ein Phänomen zu erklären, das auch dieses Buch über weite Strecken prägt: den Unternehmer, den schöpferischen Zerstörer. Ohne solche eigenwilligen, oft unbeliebten, immer interessanten Menschen hätte auch die Schweiz nie jene Karriere zustande gebracht, die ich jetzt erzähle.
Nachdem die Jungsozialisten den Escher-Wyss-Platz umgetauft hatten, schlugen die Jungfreisinnigen, also junge rechte Aktivisten, zurück. Sie nahmen sich ihrerseits die Strassenschilder linker Prominenz vor. In der Spiegelgasse überklebten sie eine Gedenktafel, die daran erinnerte, dass Lenin, der russische Revolutionär, hier einmal gelebt hatte: «Alfred-Escher-Strasse» hiess es nun.
Im Gegensatz zu Escher hatte Lenin tatsächlich die Sklaverei in Russland wieder eingeführt. Kaum an der Macht, liess er Konzentrationslager einrichten, wo politische Gegner, Adlige, Popen, oder einfach vorlaute Vertreter der «Bourgeoisie» versklavt wurden. Die meisten überlebten nicht.
Markus Somm
im September 2021
Vgl. Rey, Claudia, Politische Debatten werden über Strassenschilder ausgetragen: Zürcher Jungpolitiker überkleben Lenin-Gedenktafel mit Alfred-Escher-Schild, in: NZZ, 4. Dezember 2020, https://www.nzz.ch/zuerich/zuerich-jungfreisinnige-und-jusos-ueberkleben-strassenschilder-ld.1590 366, abgerufen am 6. Juli 2021.
Heinrich Escher, der Vater, starb 1853 in Zürich.
Beckert, Sven, Brandon, Pepijn, Mit Blut und Schweiss, in: NZZ am Sonntag, 28. Juni 2020: «Die Schweizer Familie Escher besass im 19. Jahrhundert eine Kaffeeplantage auf Kuba, auf der Sklaven schuften mussten. Dies bescherte den Eschers einen erheblichen Teil ihres Vermögens. Alfred Escher erbte das Geld und verwendete es für den Bau der Gotthardbahn.» Das ist eine groteske Annahme: Insgesamt kostete die Gotthardbahn am Ende rund 230 Millionen Franken, heute entspräche das einem Betrag von 12,6 Milliarden Franken. So viel dürfte die Kaffeeplantage in Kuba nicht abgeworfen haben. – Die Finanzierung des Tunnelbaus war übrigens hochkomplex. Es beteiligten sich das Deutsche Reich, das Königreich Italien, die Eidgenossenschaft, diverse Kantone und Gemeinden sowie ein internationales Finanzkonsortium, das unter der Führung der Berliner Disconto-Gesellschaft stand, sowie die beiden Kölner Institute A. Schaafhausen'scher Bankverein und Salomon Oppenheim junior und Compagnie. Das Konsortium umfasste auch zahlreiche renommierte Schweizer Firmen, darunter die Schweizerische Kreditanstalt oder verschiedene Bahngesellschaften.
Jung, Joseph, Aufgewärmte «teuflische Angriffe», in: Tages-Anzeiger, 10. Juli 2017, https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/aufgewaermte-teuflische-angriffe/story/26467 853, abgerufen am 13. Juli 2021.
International Monetary Fund, GDP per capita, current prices U.S. dollars per capita (2021), https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD, abgerufen am 13. Juli 2021; The World Bank, GDP per capita, current US $ (2020), https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?most_recent_value_desc=true, abgerufen am 13. Juli 2021; UNECE, Gross domestic product (GDP) per capita (2019), https://w3.unece.org/PXWeb/en/Country Ranking?IndicatorCode=12, abgerufen am 13. Juli 2021.
Für alle folgenden Titel finden sich die präzisen bibliografischen Angaben im Literaturverzeichnis.