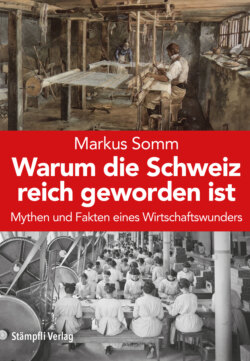Читать книгу Warum die Schweiz reich geworden ist - Markus Somm - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Wirtschaftswunderland
ОглавлениеIm Mai 1744 erfuhr Hans Conrad Gossweiler, dass die Seidenernte in Italien dieses Jahr besonders gut ausfallen würde. Deshalb wartete er mit seinen Bestellungen zu. Sicher würde der Preis für die Rohseide weiter fallen, dachte sich der Zürcher Seidenfabrikant, so dass es ungeschickt gewesen wäre, jetzt schon einzukaufen. Da auf dem Seidenmarkt aber nie etwas «sicher» war, liess Gossweiler seinen Lieferanten in Italien keine Ruhe. Fast jede Woche schrieb er ihnen einen Brief. Er erkundigte sich nach dem Preis, fragte nach der Ernte, wollte alles wissen über die Politik. Zu Recht, wie sich schon im Juni herausstellte, als man ihm mitteilte, dass die Ernte doch nicht so üppig werden würde. Allgemein rechnete man jetzt damit, dass die Preise so hoch liegen würden wie vor einem Jahr, also ziemlich hoch, zumal die Nachfrage inzwischen deutlich angezogen hatte. Den meisten Fabrikanten mangelte es an Rohstoffen, die Lager gähnten vor Leere. Ausserdem herrschte Krieg in Europa. Der österreichische Erbfolgekrieg (1740–1748) ergriff immer mehr Länder, bis so gut wie alle grossen Mächte daran beteiligt waren. Das musste den Preis für die Seide beeinflussen, keine Frage, bloss wusste niemand, in welche Richtung. Was sollte Gossweiler tun? Kaufen oder warten? Viel stand auf dem Spiel. Denn Seide war teuer, als Rohstoff genauso wie als Endprodukt, und wer schon zu teuer einkaufte, ging unter. Gossweiler behielt die Nerven. Im August schliesslich hatte sich die Lage wieder geändert, denn offenbar hatten die Seidenraupen Italiens doch viel mehr Seide abgesondert als erwartet, der Preis sank mit einem Ruck, und Gossweiler kaufte endlich ein. Er bestellte in Bergamo und Verona.
In der Regel fuhr er nicht selbst nach Italien, um seine Seide zu holen, sondern er setzte auf Spediteure, die er gut kannte, wie etwa die Firma Paravicini in Chiavenna oder Huber in Walenstadt. Sie erledigten den Transport. Sie packten die Seide in Bergamo und Verona auf Kutschen, verluden sie aufs Schiff, wo immer ein Fluss oder ein See sich als Transportweg anbot, und nutzten diesen einzigen wirklich bequemen Verkehrsweg so lange als möglich, bis es in die Berge ging, wo man nur mehr mit Maultieren vorwärtskam. Rund zwei Wochen später traf die Ware in Zürich ein. Hier gab sie Gossweiler sogleich an seine zahlreichen Arbeiter weiter, die allerdings nicht in Zürich tätig wurden, sondern in Männedorf und Stäfa. Es waren Bauern, die nebenbei in ihren Kellern Seide spannen und woben. Heimarbeiter nannte man sie: Männer, Frauen, oft Kinder, die gegen einen geringen Lohn die rohe Seide in weiches, kostspieliges Tuch verwandelten. Kaum hatten sie ihre Arbeit verrichtet, tauchte ein Mitarbeiter von Gossweiler auf, sammelte die fertige Ware ein und spedierte sie per Schiff nach Zürich zurück. Von hier aus verschickte sie Gossweiler in alle Welt: nach Frankreich, nach Spanien, nach Holland, nach Frankfurt und Leipzig, ja selbst nach Russland und Nordamerika. Gossweiler, der sich wohl zu Recht als den besten Seidenspinner von Zürich bezeichnete, betrieb ein hochrentables Unternehmen. Dabei erwarb er sich ein Vermögen und Respekt, sein Geschäft war kapitalistisch und globalisiert, als es diese Begriffe noch gar nicht gab.
Hans Conrad Gossweiler lebte von 1694 bis 1760 in Zürich. Er war ein typischer Kaufmann und Fabrikant dieser Stadt, wie es damals im 18. Jahrhundert viele gab, ja Zürich war dank ihnen zu einer der reichsten Städte Europas aufgestiegen – was man zwar nicht gerade zur Schau stellte, aber im Stillen sehr wohl genoss. Wie Gossweiler produzierten die Zürcher Fabrikanten Seidenstoffe, zunehmend auch solche aus Baumwolle, sie importierten aus Italien, aus dem Nahen Osten oder aus der Karibik ihre Rohstoffe, liessen sie auf dem Land von Heimarbeitern veredeln und lieferten ihre Waren in alle Herren Länder.
Es hatte sich ein Wirtschaftswunder zugetragen, das auch die Zeitgenossen verblüffte. Es war eine kapitalistische Zitadelle entstanden in einem Europa, wo die meisten Menschen noch als Bauern ihr Leben fristeten – mehr schlecht als recht, nur knapp sich über dem Subsistenzniveau durchbringend, was sie erwirtschafteten, brauchten sie sogleich auf. Jede Missernte, jeder Krieg stürzte sie in Not, es drohte der Hungerstod. Im Kanton Zürich kam das ebenfalls vor, doch immer seltener. Bald schien es undenkbar.
1723 war in Paris ein «Lexikon des Handels» erschienen, wo alle wichtigen Länder und Städte der damaligen Weltwirtschaft behandelt wurden. Der Autor hiess Jacques Savary des Brûlons. Unter dem Stichwort «Zurich» hatte er geschrieben: «Die Zürcher haben aus ihrem Staat ein veritables Peru gemacht, obwohl sie über keinerlei Gold- oder Silberminen verfügen»1, womit Savary sehr viel Reichtum andeutete, denn Peru galt dank seiner Minen als ein Land von unermesslichen Schätzen. Es gehörte zu jener Zeit den Spaniern. «Doch im Gegensatz zu den harten Spaniern, die aus Peru so viel Gold und Silber herausgezogen haben, was sie auf Kosten des Blutes der armen Indianer taten, die sie in den Minen zur Arbeit zwangen, haben die Herren von Zürich ihren Staat und ihre Untertanen allein mit ihren Fabriken reich gemacht.»2 Savary musste es wissen. Er war hauptberuflich Generalinspektor des französischen Zolls und hatte die vielen Waren aus Zürich zu kontrollieren, die in Frankreich auftauchten.
Zürich stand nicht allein, ganz im Gegenteil, seit gut einem Jahrhundert hatte sich in vielen Regionen der damaligen Schweiz – der sogenannten alten Eidgenossenschaft – immer mehr Industrie ausgebreitet. Ob in Basel oder Genf, ob in St. Gallen und der gesamten Ostschweiz, in Glarus, im Aargau: Überall war die Industrie gewachsen, bis sie, im Ausland lange kaum beachtet, im 18. Jahrhundert europäische Dimensionen angenommen hatte. Diese Schweiz des Ancien Régimes, wie man sie später auch bezeichnen sollte, ein merkwürdiges Relikt aus dem Mittelalter, erwies sich zugleich als eines der modernsten Länder, was seine Wirtschaft anbelangte.
Um 1780 war es zum wichtigsten Zentrum der europäischen Textilindustrie aufgestiegen. In diesem Jahr betrug der schweizerische Export 3 Millionen £, im Jahr 1800 5 Millionen £, was in beiden Fällen etwa zwei Prozent des gesamten Welthandels entsprach.
Wenn wir uns vor Augen halten, dass die Weltbevölkerung sich zu jener Zeit auf etwa eine Milliarde Menschen belief und die Eidgenossenschaft bloss 1,7 Millionen Einwohner davon beherbergte, wird deutlich, als wie überproportional wir diesen schweizerischen Anteil am Welthandel einzuschätzen haben: 1,7 Millionen sind 0,17 Prozent im Verhältnis zu einer Milliarde, die Schweizer lieferten also mit zwei Prozent rund zwölf Mal mehr Waren, als ihre Bevölkerungszahl hätte annehmen lassen. Was für eine erstaunliche Exportleistung – besonders für ein Land, das in den Augen der meisten Europäer noch kurz zuvor nur eines zu exportieren gewusst hatte: die brutalsten und teuersten Söldner der Weltgeschichte. Doch im 18. Jahrhundert sah alles anders aus. Aus einer Nation der Söldner war ein Land der Fabrikanten, Kaufleute und Arbeiter geworden.
Der Umfang dieser frühen Industrie war gewaltig. Die Behörden des Kantons Zürich hatten im Jahr 1787 alle Arbeitskräfte zählen lassen, die in der Baumwollindustrie untergekommen waren. Es handelte sich um den führenden Sektor. Man ermittelte 34 000 Spinner und nahezu 6500 Weber, insgesamt arbeiteten wohl 50 000 Menschen in der Produktion von Baumwollstoffen, was einem Drittel aller Arbeitskräfte im Kanton entsprach. Angesichts der Tatsache, dass ausserdem 4000 Leute in der Seidenherstellung ihr Geld verdienten, kann man ermessen, wie ausgeprägt sich der Kanton Zürich schon industrialisiert hatte. Alles in allem betrug dessen Bevölkerung 1792 rund 175 000 Einwohner.
Ähnlich sah es in den übrigen Industrieregionen aus. So wurden im Aargau etwa zur gleichen Zeit rund 30 000 bis 40 000 Leute registriert, die in der Baumwoll- und in der Leinenweberei tätig waren, was ebenfalls einem Drittel der Erwerbsbevölkerung gleichkam; der heutige Kanton gehörte damals zu weiten Teilen zu Bern.
Auch Basel zählte zu diesen produktiven, modernen Gebieten, allein im Kanton, der damals sowohl Basel-Stadt als auch Baselland umfasste, standen über 2300 Webstühle, auf denen das allerseits begehrte, exquisite Seidenband hergestellt wurde. Längst hatte sich diese Luxusbranche ebenso ins Elsass, in das Badische und in das Fricktal ausgedehnt.
Seidenbänder stiessen zu jener Zeit auf eine stabile Nachfrage, besonders der Adel verbrauchte sie in rauen Mengen, um sich standesgemäss zu schmücken oder aufzuputzen, wie man das nannte. Ob am Hut oder am Kleid, an den Strümpfen oder am Hemd: Nie durfte ein Seidenband fehlen. Paris, die neue Hauptstadt der Mode, liebte Basel. Basel liebte Paris.
Dass ausgerechnet das protestantische Basel sich an diesem Luxusprodukt bereicherte, entbehrte nicht der Ironie, denn die Politiker und Pfarrer der Stadt taten alles, um den eigenen Bürgern mit strikten Sittenmandaten das Seidenband zu verleiden; nur sehr eingeschränkt war dessen Einsatz erlaubt. Man exportierte nach Frankreich, was man selbst nicht benutzen durfte. Nicht alle hielten sich daran.
«Die alten Sittengesetze Basels», hiess es in einem Lexikon des 19. Jahrhunderts, «waren von merkwürdiger Strenge. So mussten sonntags alle in schwarzen Anzügen zur Kirche gehen, Frauen und Mädchen durften sich das Haar nicht von Männern ordnen lassen, nach zehn Uhr abends wurden keine Wagen in die Stadt gelassen, und niemand durfte einen Bedienten hinten auf seinem Wagen haben. Mit der Frömmigkeit ging aber der ‹Handelsgeist› Hand in Hand, und Basel ist deshalb auch ‹Wucherstadt› genannt worden. Fünf Prozent galt als mindester ‹christlicher Zins›, und wer seine Kapitalien zu geringerem Zinsfuss auslieh, wurde als staatsgefährlich verfolgt.»3
Nirgendwo aber war die Wirtschaft wohl stürmischer gewachsen als im Glarnerland, in einem von der Natur ungnädig behandelten, faktisch aus wenig mehr als einem einzigen Tal bestehenden Minikanton: 1794 belief sich die Glarner Bevölkerung auf rund 22 000 Einwohner. Davon waren sage und schreibe zwei Drittel in der Industrie tätig, bloss ein Drittel kümmerte sich noch um die traditionelle Landwirtschaft. Damit gehörte Glarus im 18. Jahrhundert zu den am meisten industrialisierten Regionen der Welt.
Vorangegangen war ein aussergewöhnlicher, ja überstürzter Strukturwandel: Seit undenklichen Zeiten hatten sich die Glarner der Viehzucht, der Alpwirtschaft und den Solddiensten für fremde Staaten gewidmet, doch Anfang des 18. Jahrhunderts war zuerst die Baumwollspinnerei, dann der Zeugdruck aufgekommen, also das Bedrucken von Textilien, wofür die Glarner Unternehmer schliesslich weltberühmt werden sollten. Wie so oft hatte die Industrialisierung gleichzeitig eine markante Zunahme der Bevölkerung bewirkt: Im 14. Jahrhundert dürften bloss 4000 Menschen im Glarnerland gelebt haben. 1700 war ihre Zahl auf 10 000 angestiegen, um sich bis 1794 mehr als zu verdoppeln. Mit anderen Worten, in knapp hundert Jahren war der Kanton so stark gewachsen wie in den vorhergehenden dreihundert Jahren zusammen.
«Diese Bevölkerung», stellte Johann Gottfried Ebel, ein deutscher Besucher, 1797 fest, «steht in keinem Verhältnis mit den nutzbaren Grundstücken des Landes, und man kann daher mit Recht sagen, dass der Kanton Glarus für seine Bewohner zu klein ist.»4 Ebel stammte aus Preussen; von der Ausbildung her ein Arzt, bereiste er in den 1790er Jahren wiederholt die Schweiz und verfasste Reiseberichte, die dem ausländischen, besonders dem deutschen Touristen das Alpenland näherbringen sollten. Ebel fuhr fort: «Mit der Einführung neuer Erwerbszweige [der Textilindustrie] wurden die Ehen häufiger und fruchtbarer, die Güter der Familien zerfielen in kleinere Teile und deren Zerstückelung erreichte bei steigender Menschenvermehrung den höchsten Grad.»5
Wenn man bedenkt, dass zu jener Zeit die Linthebene, jenes weite Gebiet zwischen Walen- und Zürichsee, das den Zugang zum Glarnerland beherrscht, noch nicht entsumpft und melioriert war, wird deutlich, als wie aussergewöhnlich die Frühindustrialisierung in diesem abgeschnittenen Tal mitten im Gebirge zu beurteilen ist. Der Sumpf erschwerte den Verkehr von Personen und den Transport von Gütern, der Sumpf begünstigte auch die Malaria, die regelmässig ausbrach und die Menschen heimsuchte. In der Tat: Das Glarnerland war ein verwunschener Ort. Ein Krachen, von dem man zuletzt erwartet hätte, dass er sich je zu einem so bedeutenden Standort der Textilindustrie heranbilden würde. Ein Wunder, ein Zufall? Weder das eine noch das andere.
Verwunschen, abgeschnitten, vom Schicksal bestraft: Das Gleiche lässt sich von einem zweiten Minikanton in den Voralpen sagen, dessen Entwicklung nicht weniger verblüffend verlaufen war: Appenzell Ausserrhoden hatte sich im 18. Jahrhundert ebenfalls zu einem Schwerpunkt der Textilindustrie verwandelt. Von den 35 000 Menschen, die seinerzeit dort lebten, arbeiteten 11 000 für den Export von Stoffen, nur eine Minderheit fand noch in der Landwirtschaft ihr Auskommen. Wenn Appenzell Ausserrhoden auch das eindrücklichste Beispiel der Industrialisierung in der Ostschweiz darstellte, so war es doch keine Ausnahme: Ob Toggenburg, Fürstenland, Thurgau oder das Rheintal: Überallhin hatte sich die Textilindustrie ausgedehnt, in konzentrischen Kreisen war sie jedes Jahr gewachsen, und in der Mitte lag die Stadt St. Gallen, wo die Unternehmer residierten, die dieses Geschäft – Import, Produktion und Export – im Wesentlichen dirigierten. Hatten die St. Galler zuerst jahrhundertelang die Leinenindustrie des gesamten Bodenseeraumes dominiert, waren sie zu Anfang des 18. Jahrhunderts auf die Baumwolle umgestiegen, dann erfanden sie die Stickerei, die sie bis zum Ersten Weltkrieg überaus reich machen sollte. Allein im stockkatholischen Appenzell Innerrhoden rührte sich wenig. Hier gab es kaum Industrie.
Last, but not least hatte sich in der Schweiz, insbesondere in Genf und Neuenburg, eine weitere Industrie etabliert, die das Land bis auf weiteres ebenso prägen sollte: die Uhrenindustrie, deren Produkte in ganz Europa auf beachtlichen Absatz stiessen. 10 000 Uhrmacher gingen in der Westschweiz dieser Tätigkeit nach – die kaum jemand sonst beherrschte.
Die Schweiz, ein Industriestaat avant la lettre. Für die spätere Geschichte des Landes sollte sich dieser sehr frühe Start als ausserordentlich folgenreich herausstellen. Gewiss, das war keine Industrie, wie wir uns das heute vorstellen. Noch fehlten weitgehend die Maschinen, es überwog Handarbeit, ebenso trug sich der grösste Teil der Produktion in der Heimindustrie zu: Tausende von Heimarbeitern, kleine Bauern und Bäuerinnen im Nebenberuf, stellten die Textilien auf ihren Höfen her, selbst die meisten Uhrmacher tüftelten, schliffen und schraubten zuhause; Fabriken, wie wir sie kennen, kamen selten vor.
Es hatte eine «Industrialisierung vor der Industrialisierung» stattgefunden, wie die Wirtschaftshistoriker diesen Wandel heute in Worte fassen. Die Menschen bewegten sich zwischen agrarischem Gestern und industriellem Morgen, im rasenden Stillstand sozusagen, was sich im Fall der Schweiz allerdings als entscheidender Vorzug erweisen sollte. Die Schweiz galt als ein Pionier dieser sogenannten Protoindustrie, deshalb wuchs sie auch zum Pionier der darauffolgenden industriellen Revolution heran.
Zwar sahen sich lange nicht alle Kantone in der damaligen alten Eidgenossenschaft von dieser Entwicklung betroffen. In manchen war die Zeit stehen geblieben, und man lebte dort, als wäre das Mittelalter nie vergangen. Wo die Industrie sich aber festgesetzt hatte, und das waren eben doch viele Regionen, brach eine neue Ära an. Alles wurde anders, vieles modern, den meisten ging es besser, lange bevor die Französische Revolution von 1789 ganz Europa aus den Angeln heben sollte.
Den meisten Zeitgenossen war dies bekannt, zumal sie wie etwa der oberste französische Zollinspektor Jacques Savary mit den Folgen dieses Wirtschaftswunders zu tun hatten. Später geriet dieser vorzeitige Durchbruch in Vergessenheit, wie der deutsche Soziologe Ulrich Menzel feststellte: «Der Blick der Wirtschaftshistoriker, die sich mit den Anfängen der Industrialisierung beschäftigen, richtet sich in erster Linie auf England»6, und wenn auf den Kontinent, dann allenfalls auf Frankreich: «Dabei wird vielfach übersehen, dass zumindest in dem Leitsektor der frühen Industrialisierung, der Textilindustrie, die Schweiz im dritten Viertel des 18. Jahrhunderts das führende Land in Europa war und zwischen 1750 und 1780 eine erste Hochkonjunktur erlebte.»7 Mit Blick auf die Konkurrenz kommt Menzel zum Schluss: «Die schweizerische Baumwollindustrie ist älter als die englische und die Seidenindustrie älter als diejenige Lyons.»8
Wie war das möglich? Auf den ersten Blick gab es vielleicht kein Land in Europa, dem man einen solchen wirtschaftlichen Aufstieg weniger zugetraut hätte als der Schweiz. War es nicht ein Land mitten im Gebirge, wo es zu allem Elend nicht einmal Gold oder Silber oder Eisenerz gab wie in so vielen Bergregionen der Welt? Hätten die Schweizer wenigstens ein paar Rohstoffe aus ihren Felsen brechen können, wären sie wohl der Natur in einer besseren Position gegenübergestanden, stattdessen fanden sie nur Schutt, fettes Gras, Moos und Flechten. Sie bissen buchstäblich auf Granit.
Sie lebten überdies in einer Eidgenossenschaft der Isolation, ohne Meeranschluss, ohne Seehäfen, zwar mit Flüssen versehen, die sich allerdings nur teilweise mit Schiffen befahren liessen. Wer exportieren wollte, war stets auf die Gutmütigkeit seiner Nachbarn angewiesen. Zwei Drittel des Landes lagen in den Alpen oder im Jura, in unfruchtbarem und unwegsamem Gebiet. Das eine hintertrieb eine produktive Landwirtschaft, das andere erschwerte den Transport von Waren und machte ihn vor allen Dingen kostspielig, unzuverlässig und langsam. Wie konnte es sein, dass sich ausgerechnet diese Schweiz zum Standort einer leistungsfähigen Exportindustrie entwickelt hatte?
Vielleicht ist kein Thema in der schweizerischen Geschichte von mehr Belang, und womöglich ist keines unbekannter – was so verblüffend wirkt wie die Tatsache selbst. Bevor ich mich jedoch damit beschäftige, möchte ich diese Industrie des 18. Jahrhunderts beschreiben. Wenigen dürfte die sogenannte Heim- oder Hausindustrie vertraut sein. Sie war ein Wunder, sie war ein Elend – auch in der Schweiz setzte der Kapitalismus mit Licht und Schatten ein.