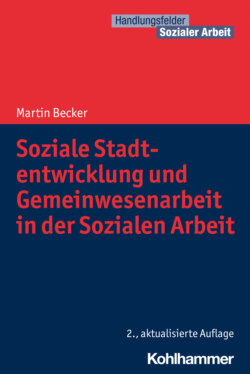Читать книгу Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit in der Sozialen Arbeit - Martin Becker - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gemeinwesenarbeit
Оглавление»Gemeinwesenarbeit« wurde in der Vergangenheit sehr unterschiedlich verstanden und definiert (zur Übersicht vgl. Galuske 2007: 99 ff.). Wie im ersten Abschnitt zu den geschichtlichen Hintergründen bereits beschrieben ( Kap. 1.1) hat sich im deutschsprachigen Raum »Gemeinwesenarbeit« als Fachbegriff Sozialer Arbeit im Laufe von mehr als 150 Jahren entwickelt. In den Niederlanden setzte sich der Begriff »Opbouwwerk« durch, im englischsprachigen Raum wird dagegen von »Communitywork« mit den Differenzierungen in »Community Organization« und »Community Development« gesprochen, während es im französischen Sprachgebrauch keine genaue Entsprechung zum Begriff »Gemeinwesenarbeit« gibt und sich daher die Umschreibung »travaille social sur le commun« (Becker 2015: 93) anbietet.
Mit dem Begriff »Gemeinwesenarbeit« war in seiner historischen Entwicklung zunächst eine Methode, dann ein Arbeitsfeld und schließlich ein Arbeitsprinzip verbunden. Kennzeichnend für GWA ist dabei, dass der Fokus nicht auf einem Individuum oder einer Kleingruppe liegt,
»sondern in einem großflächigeren sozialen Netzwerk [Hervorhebung in Kursivschrift im Original], das territorial (Stadtteil, Nachbarschaft, Gemeinde, Wohnblock, Straßenzug), kategorial (bestimmte ethnisch, geschlechtsspezifisch, altersbedingt abgrenzbare Bevölkerungsgruppen), und/oder funktional (d. h. im Hinblick auf bestimmte inhaltlich bestimmbare Problemlagen wie Wohnen, Bildung etc.) abgrenzbar sind [ist].« (Galuske 2007: 101)
Wie aus der dargestellten historischen Entwicklung durchgängig erkennbar, bezieht sich GWA meist auf eine territoriale Einheit (Stadtteil, Stadtviertel oder kleinere Gemeinde). In den Anfangszeiten der Settlementbewegung waren Armen- oder sogenannte »Elendsviertel« die Einsatzgebiete der GWA. Pionierinnen der Sozialen Arbeit wie Alice Salomon oder Marie Baum haben schon früh die Notwendigkeit des Einbezugs des sozialen und räumlichen Umfelds hilfebedürftiger Menschen für die Bearbeitung und Bewältigung sozialer Probleme erkannt und gefordert.
In den Großwohnsiedlungen der Nachkriegszeit wurde, als diese, auf dem Planungsmodell Le Corbusiers (1957) basierenden Trabantenstädte im Laufe der 1980er Jahre sowohl baulich renovierungsbedürftig als auch infrastrukturell vernachlässigt waren und sich zunehmend sozial entmischt bzw. homogenisiert hatten, GWA für die sogenannten »sozialen Brennpunkte« oder »benachteiligten Wohngebiete« eingesetzt. Im Rahmen der sozialen Stadtentwicklungsprogramme wie »Soziale Stadt« (2008) werden »Gebiete mit besonderem Erneuerungs- bzw. Entwicklungsbedarf« ausgewiesen und administrativ festgelegt.
In den 1970er Jahren führten in Deutschland Forderungen nach Einmischung Sozialer Arbeit und Beteiligung von BürgerInnen an der Stadtplanung dazu, dass mehr Beteiligungsrechte im Baugesetzbuch aufgenommen wurden (Becker 2008: 444). Die Relevanz einer territorialen Perspektive Sozialer Arbeit für die Beurteilung und (präventive und korrektive) Bearbeitung sozialer Probleme, ergibt sich grundsätzlich aus der empirisch beobachtbaren Tatsache, dass sich globale, nationale und regionale Entwicklungen je nach gesellschaftlicher Bewältigungsstrategie mehr oder weniger auf lokaler Ebene in Form räumlicher Konzentrationen abbilden können. Gesellschaftliche Polarisierungs- und Spaltungsprozesse können zu räumlichen Konzentrationserscheinungen führen, die sich in wahrnehmbaren »Verlierer-« und »Gewinnerräumen« abzeichnen (Becker 2008). Erkenntnisse über Wirkungen räumlich-baulicher Strukturen auf Nutzungsqualitäten von territorial bestimmbaren Räumen und die Zusammensetzung der Bevölkerung in solchen Räumen, belegen die Bedeutung räumlich-baulicher Gestaltung von Siedlungsräumen (Farwick 2004). Nahräumliche Infrastruktur ist insbesondere für entfernungssensible Menschen, z. B. mit körperlichen oder finanziellen Mobilitätseinschränkungen, mitentscheidend für deren ökonomische, kulturelle und soziale Teilhabechance am gesellschaftlichen Leben. Gelegenheiten für soziale Kontakte beeinflussen die Bewältigungsmöglichkeiten von Menschen in schwierigen Lebenslagen. Die genannten Wirkungen und Effekte der »sozialwirksamen Raumstruktur« und »negativer Ortseffekte« werden in der Fachwelt nicht widerspruchslos geteilt, sondern mit Verweis auf unklare Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge in Frage gestellt (Ziegler 2011). Für die Untersuchung der komplexen Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen und deren möglichen Auswirkungen in territorial bestimmbaren Räumen auf lokaler Ebene scheinen eindimensionale Ursache-Wirkungs-Vermutungen weder als Beleg noch als Gegenbeweis für (negative) »Ortseffekte« geeignet.
In Bezug auf die territoriale Perspektive von GWA wird auch Kritik an der »(Re)Territorialisierung des Sozialen« (Kessl/Otto 2007) geübt, d. h. an dem Versuch die Lösung sozialer Probleme in Gebieten mit benachteiligter Bevölkerung zu verorten, obwohl dort die geringsten Ressourcen zur Lösung vorhanden sind. Damit wird nicht nur die Annahme kritisiert, soziale Probleme ließen sich an ihren Erscheinungsbildern und Auswirkungen kurieren, sondern es wird auch eine Governance-Strategie angeprangert, die den ohnehin belasteten und benachteiligten Menschen die Lösung von Problemen, die sie nicht verursacht haben, aufbürdet und ihren Lebensraum obendrein auch noch als Problemgebiet stigmatisiert. Allerdings erweckt die Kritik an der »(Re)Territorialisierung des Sozialen« den Eindruck, eine territoriale Perspektive an sich sei das Problem und nicht die Fokussierung auf Problemgebiete bei gleichzeitiger Ausblendung der (Mit-)Verantwortung von (Stadt-)Gebieten mit guter Ausstattung an räumlichen und sozialen Ressourcen. Deshalb ist eine gesamtstädtische Betrachtung sozialer und räumlicher Aspekte im Rahmen einer integrierten (disziplin- und ressortübergreifenden) Stadt- und Quartierentwicklung angeraten, die die gesamte Stadt mit all ihren (Stadt-)Teilen und Quartieren und nicht nur die sogenannten Problemgebiete in den Blick nimmt und bearbeitet (entwickelt).
Nach den o. g. einschlägigen Definitionen sind »Gemeinwesen« (Stövesand u. a. 2013: 16) bzw. »soziale Netzwerke« (Galuske 2007: 101) neben territorial-geografischen Merkmalen auch nach funktionalen und/oder kategorialen Kriterien abgrenzbar. Von funktionaler Ausrichtung wird gesprochen, wenn Aufgaben wie die Verbesserung der Verkehrs- (Straßenführung, -lärm, ÖPNV-Angebot etc.), Versorgungs- (Einkaufsmöglichkeiten, Gesundheitsdienstleistungen etc.) oder sozialen Infrastruktur Arbeitsmöglichkeiten oder die Wohnsituation der Bevölkerung (Bausanierung, Miethöhen etc.) im Vordergrund stehen. Kategoriale Zugehörigkeit wird in der Fachliteratur verstanden als Arbeit mit Menschen unterschiedlicher personenbezogener Merkmale, wie z. B. Geschlecht, Ethnie, Alter etc.
Dieses Verständnis von GWA und deren Differenzierung nach territorialer, funktionaler und kategorialer Ausrichtung widerspricht gewissermaßen den o. g. Merkmalen des »Arbeitsprinzips GWA« nach Oelschlägel, wonach sich GWA ganzheitlich und themenübergreifend »… um alle Probleme des Stadtteils [kümmert] und (…) sich nicht auf einen Punkt [konzentriert] …« (2013: 191). Auch nach den Prinzipien stadtteilbezogener bzw. sozialraumbezogener Arbeit nach Hinte sind »Aktivitäten … immer zielgruppen- und bereichsübergreifend angelegt« (2007: 9). Dementsprechend wäre strenggenommen eine (kategoriale) Ausrichtung auf eine bestimmte »Zielgruppe« oder eine Konzentration auf einen bestimmten funktionalen Zusammenhang wie z. B. »Wohnen« mit den o. g. Prinzipien ganzheitlicher, themen- und Zielgruppen übergreifender Arbeit von GWA unvereinbar. Dieser Widerspruch wird auch im Handbuch GWA nicht aufgelöst, wenn beispielsweise nach der Aufzählung der als »Handlungsebenen« bezeichneten Differenzierung in territoriale, funktionale und kategoriale GWA festgestellt wird, GWA arbeite »… jedoch häufig eher zielgruppenübergreifend, themenbezogen und fallunspezifisch« (Stövesand u. a. 2013: 22). Wenn GWA, wie im Handbuch, als ein ganzheitliches, themen- und zielgruppenübergreifendes Konzept verstanden werden soll, kann dieses Konzept weder auf einen Gebietsbezug verzichten noch sich ausschließlich auf eine Funktion oder Kategorie von Menschen als AdressatInnen beschränken. Auflösen ließe sich dieser Widerspruch, wenn klar getrennt würde zwischen einem Konzept für GWA und GWA als Arbeitsfeld. Während ein Konzept für GWA auf Basis theoretisch und empirisch fundiertem Erklärungswissen die Gesamtheit programmatischer Aussagen, Handlungsprinzipien und Arbeitsweisen bereitstellen muss, kann GWA als Arbeitsfeld Schwerpunkte je nach situativer Gegebenheit und Interessen der Bevölkerung territoriale, funktionale und kategoriale Schwerpunkte setzen, die jedoch grundsätzlich veränderbar sein und stets reflektiert und angepasst werden müssten.
Neben der territorialen, funktionalen und kategorialen Ausrichtung von GWA gelten die unterschiedlichen politischen Zielrichtungen, auch »Ansätze« genannt, sowie deren entsprechender Methodeneinsatz ebenfalls als charakteristische Merkmale von GWA. In Theorie und Praxis variierten die Zielsetzungen und der Einsatz von Methoden stark nach der jeweiligen politischen Ausrichtung zwischen Ansätzen konservativer Systemerhaltung (wohlfahrtsstaatliche/integrative GWA), evolutionärer (katalytische/aktivierende GWA) oder revolutionärer Systemveränderung (aggressive GWA) (Galuske 2007: 101–106). Stövesand u. a. problematisieren ebenfalls die Wirkungen der beiden politisch gegensätzlichen (sozialrevolutionäre und konfliktorientierte vs. systemerhaltend-harmonisierende) Ansätze der GWA in der Vergangenheit. Während marxistisch ausgerichtete Theorieansätze in der Praxis auf konfrontative, skandalisierende Techniken setzten, seien die subjektiven Bedürfnisse und Probleme der betroffenen Menschen tendenziell missachtet oder vernachlässigt worden. Auf Seiten der konservativen und heute eher pragmatisch-manageriellen Ansätze würden die benachteiligenden gesellschaftlichen Strukturen und Prozesse ignoriert und wirkten in ihren Interventionsformen und Techniken ausschließlich kollektiv-kooperativ und konsensorientiert (Stövesand 2013: 19 f.). In beiden Beschreibungen wird der Eindruck vermittelt, der Einsatz von Methoden und Techniken wäre ausschließlich von der politischen Haltung der Professionellen abhängig und nicht auch eine Frage der sozialen Konfliktlage, d. h. der Kooperationsbereitschaft der beteiligten AkteurInnen einerseits und des Willens zur Veränderung dieser andererseits, sowie der Entscheidung von Professionellen bezüglich der Parteilichkeit für bestimmte Bevölkerungsteile oder Themen.
Einen breiten Konsens in der Fachwelt scheint es bezüglich der für GWA konstituierenden Merkmale zu geben. Die Festschreibung gesellschaftlich konstatierter Missstände und sozialer Konflikte als Ausgangspunkt von GWA scheint insofern ergänzungsbedürftig, als damit nicht ausschließlich reaktive Arbeit im Sinne der Skandalisierung und Bearbeitung offenkundiger und latenter Konflikte und Missstände, sondern auch prospektive Arbeit zur Vermeidung von Missständen zu verstehen wäre. Dass Probleme stets im Kontext lokaler, regionaler oder gesamtgesellschaftlicher Rahmenbedingungen und Ursachen gesehen werden, gehört ebenso zum »State of the Art« der Profession Soziale Arbeit wie die Kooperation und Koordination lokaler AkteurInnen, die trägerübergreifende Vernetzung von Diensten und Einrichtungen sowie die Beteiligung und Aktivitätsunterstützung der Bevölkerung und die Methodenintegration. Weniger Konsens gab und gibt es in der Scientific Community bezüglich der Verwendung und Einordnung der Begrifflichkeiten rund um Gemeinwesenarbeit und Sozialraumorientierung. Neben immer noch bestehenden akademischen Uneinigkeiten zur Unterscheidung von Konzept und Methode (Geißler/Hege 2007; Galuske 2007; von Spiegel 2008; Kreft/Müller 2010; Heiner 2010) in der Sozialen Arbeit gibt es Beschreibungen von GWA als Arbeitsprinzip, Arbeitsfeld, Methode oder Konzept, die mit anderen Begriffen wie Fach- oder Handlungskonzept Sozialraumorientierung, Sozialraumarbeit oder Quartiermanagement/-arbeit um die ›Lufthoheit‹ über den Schreibtischen und Lehrsälen sowie um die Dominanz in den einschlägigen Publikationsdiskursen zu konkurrieren scheinen.
Stövesand u. a. (2013) haben in ihrem Handbuch den Versuch unternommen, die unterschiedlichen Verständnisse und Zielrichtungen der GWA unter Berücksichtigung der historischen Entwicklung und der Rezeption in der Fachliteratur zu systematisieren, und schlagen vor, GWA als grundlegendes übergreifendes Konzept Sozialer Arbeit zu verstehen. Gemeinwesenarbeit wird demnach als eigenes Konzept Sozialer Arbeit deklariert, das von einer generellen Grundorientierung auf Individuen ausgehend »die Entwicklung gemeinsamer Handlungsfähigkeit und kollektives Empowerment bezüglich der Gestaltung bzw. Veränderung von infrastrukturellen, politischen und sozialen Lebensbedingungen fördert« (ebd.: 16).
Mit Verweis auf die von Geißler und Hege (2007) entwickelte Unterscheidung von Konzepten, Methoden und Techniken bezeichnen Stövesand u. a. (2013) die von Boulet, Kraus und Oelschlägel (1980) als »Arbeitsprinzip« beschriebene GWA als übergreifendes »Konzept«. GWA wird nach Stövesand u. a. nicht nur als »vielfältiges Konzept« sondern gleichzeitig auch als »Handlungsfeld« bezeichnet, »insofern es Einrichtungen und Projekte gibt, die explizit Konzepte der GWA anwenden« (2013: 21). In der Verwendung des Plurals »Konzepte der GWA« wird eine weitere Unschärfe des Konzeptbegriffs der HerausgeberInnen des Handbuch GWA deutlich, die einerseits GWA als eigenständiges Konzept Sozialer Arbeit bezeichnen und gleichzeitig einräumen, dass es mehrere Konzepte der GWA gibt und GWA ebenfalls als Handlungsfeld zu verstehen sei.
Im »Handbuch Gemeinwesenarbeit« lautet die Definition von GWA folgendermaßen:
»Gemeinwesenarbeit richtet sich ganzheitlich auf die Lebenszusammenhänge von Menschen. Ziel ist die Verbesserung von materiellen (z. B. Wohnraum, Existenzsicherung), infrastrukturellen (z. B. Verkehrsanbindung, Einkaufsmöglichkeiten, Grünflächen) und immateriellen (z. B. Qualität sozialer Beziehungen, Partizipation, Kultur) Bedingungen unter maßgeblicher Einbeziehung der Betroffenen.
GWA integriert die Bearbeitung individueller und struktureller Aspekte in sozialräumlicher Perspektive. Sie fördert Handlungsfähigkeit und Selbstorganisation im Sinne von kollektivem Empowerment sowie den Aufbau von Netzwerken und Kooperationsstrukturen. GWA ist somit immer sowohl Bildungsarbeit als auch sozial- bzw. lokalpolitisch ausgerichtet.« (Stövesand u. a. 2013: 21)