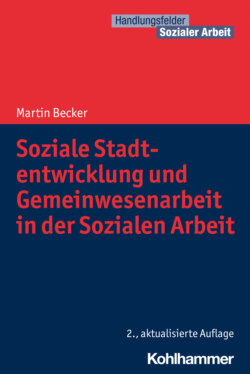Читать книгу Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit in der Sozialen Arbeit - Martin Becker - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеMit der vorliegenden zweiten aktualisierten Auflage des ersten Band der Reihe »Handlungsfelder Sozialer Arbeit« liegt eine Publikation vor, die den Versuch wagt, das umfangreiche Handlungsfeld derjenigen Arbeits- und Tätigkeitsbereiche innerhalb der Sozialen Arbeit zusammenfassend darzustellen, die sich durch spezifische Gebiets- und Sozialraumorientierung auszeichnen. Dabei besteht die Herausforderung u. a. darin, sowohl der Breite des Handlungsfeldes gerecht zu werden als auch genügend vertiefte Einblicke in bestimmte Tätigkeitsbereiche zu ermöglichen.
Obwohl oder vielleicht gerade weil »Gemeinwesenarbeit« als ein, gelegentlich als »Methode« bezeichnetes, vergleichsweise frühes Arbeitsfeld Sozialer Arbeit identifiziert werden kann ( Kap. 1), hat es bis heute starke konzeptionelle und begriffliche Ausdifferenzierungen erfahren. Mit »Community Organizing«, »Stadt (teil)- oder Quartierentwicklung«, »Quartiermanagement«, »Gemeinwesen-« oder »Solidar-Ökonomie« sind nur einige Begriffe genannt, hinter denen sich mehr oder wenig klar beschriebene Konzepte und Aufgabenfelder verbergen. Die Gemeinsamkeiten liegen dabei in erster Linie auf der Verbindung sozialer und räumlicher Bezüge, die sich aus einer Perspektive ergeben, die aus der Mikroebene von Individuen, auf die Mesoebene der Lebens- und Aktionsräume von Gruppierungen, Milieus und Szenen in Stadtteilen und Quartieren sowie auf die Makroebene von Stadtgesellschaften, Regionen und Staaten heraus zoomt. Der AdressatInnenkreis geht dabei über die klassische Klientel Sozialer Arbeit hinaus und bezieht potenziell alle Menschen in einem sozial- und räumlich strukturierten Lebens- und Aktionsumfeld ein. Unter der Formel »Gemeinwesenarbeit als Arbeitsprinzip« oder der Bezeichnung »Sozialraumorientierung« (Becker 2020b) haben sich Konzepte entwickelt, die mittlerweile in vielen klassischen Arbeitsfeldern Sozialer Arbeit Einzug gehalten haben und mit Beteiligung und Aktivierung Betroffener, Beachtung und Nutzung von Ressourcen des sozialen Nahraums sowie institutioneller und individueller Vernetzung versuchen, ihrer jeweiligen Aufgabenstellung gerechter zu werden. So setzt die Ausrichtung der »gemeindenahen Psychiatrie« auf die Potentiale von Angehörigen, Nachbarschaft und sozialem Umfeld von Menschen mit psychischen Belastungen. Dies gilt auch für die Altenhilfe, wo ambulante vor stationären Hilfen und nahräumliche Versorgung bevorzugt werden. In der Jugendhilfe wird mit »Mobiler Jugendarbeit« und Straßensozialarbeit versucht, sozialräumliche Akzente zu setzen oder gar Finanzbudgets auf »Sozialräume« zu beziehen. Zur Integration von MigrantInnen wird versucht, über MultiplikatorInnen »Netzwerke der Integration vor Ort« zu schaffen. Die soziale, verkehrliche und ökonomische Infrastruktur am Lebens- und Wohnort wird für Menschen immer wichtiger, auch wenn sie bislang keine AdressatInnen Sozialer Arbeit sind. Interdisziplinäre Kooperation, institutionelle Vernetzung und gemeinsame Ressourcennutzung scheinen sich, wo bislang praktiziert, zu bewähren. Innerhalb integrierter Quartierskonzepte arbeiten im Idealfall SozialarbeiterInnen, Verwaltungsfachkräfte, ArchitektInnen und Angehörige anderer Professionen beim Aufbau von Strukturen und Prozessen zusammen, um allen Generationen, Gesunden wie Kranken, Einheimischen und Zugereisten ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben in ihrem sozialen und räumlichen Umfeld zu ermöglichen. Fachkräfte und Bevölkerung werden, durch einschlägige Europa-, Bundes- und Länderprogramme, die die soziale Stadtentwicklung befördern sollen, darin unterstützt, die ganzheitliche Entwicklung von Städten, Stadtteilen und Quartieren in den Blick nehmen.
Es ändern sich folglich Berufsbilder und Aufgaben. Sozialraumorientierung, in Ergänzung der individuellen Fallorientierung, Kooperation, Koordination, Moderation, Vernetzung, Gewinnung und Fortbildung von engagierten BürgerInnen, Netzwerkarbeit im sozialräumlichen Kontext und integrierte Sozialraumanalysen setzen eigene Kompetenzen, Ressourcen und Steuerungsprinzipien voraus.
Dieser Band konzentriert sich auf jenes Handlungsfeld Sozialer Arbeit, in dem integrative Konzepte sozialer Stadt- und Quartierentwicklung zur Anwendung kommen, in dem danach gefragt wird, wie eine Stadt und ihre Quartiere so gestaltet werden können, dass sie den Interessen ihrer älter und bunter werdenden Bevölkerung gerecht werden und für eine vielfältige Bevölkerung, von Jung und Alt, Einheimischen und Zugereisten, Armen und Reichen, Kindern und Erwachsenen attraktiv, wirtschaftlich leistungsfähig und ökologisch nachhaltig sind.
Handlungsfeldorientierung im Sinne des dieser Publikationsreihe zugrunde liegenden »Freiburger Modells« bedeutet, die aktuellen Bedingungen und Entwicklungen in bestimmten Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit in den Blick zu nehmen und die daraus abzuleitenden Aktionen und Interventionen, mit denen die Soziale Arbeit fachlich arbeitet, in Bezug zu setzen zu den jeweils passenden und notwendigen Handlungskonzepten und Methoden. Handlungskonzepte, Methoden und Techniken werden in diesem Band also auf die handlungsfeldspezifischen Charakteristika von Aufgabenstellungen, Rechtsgrundlagen, Governance, Trägerlandschaften und Situationen von Stadt- und Quartierentwicklung bezogen.
Die Handlungsfeldorientierung dieser Reihe und damit dieses ersten Bandes ist auch vor dem Hintergrund der Kompetenzorientierung als Erfordernis des Bologna-Prozesses zu sehen. Auf der Grundlage des dreidimensionalen Kompetenzbegriffs, wie er im Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) definiert wird, spielen sowohl theoriebegründete Handlungskonzepte als auch die Methoden der Sozialen Arbeit eine wichtige Rolle beim integrierenden Modell der Handlungsfeldorientierung. Die Kombination von Wissensbeständen aus Bezugswissenschaften und Erkenntnissen der Wissenschaft Soziale Arbeit (Erklärungswissen), mit Kenntnissen und Fähigkeiten der Entwicklung und Anwendung von Methoden (Handlungswissen und Analyse-/Synthese-/Kritikfähigkeit), bildet auf der Grundlage von Wertorientierungen und Haltungen die Basis der Ausbildung spezifischer Handlungskompetenzen Sozialer Arbeit.
Das Handlungsfeld der sozialen Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit erfordert spezifische Kenntnisse sowie ein differenziertes Verständnis sozialer Probleme. Dafür braucht es eine Verständigung über gesellschaftliche Strukturen und Prozesse, die problematische Lebenslagen produzieren können. Grundlage dafür sind Fähigkeiten, gesellschaftliche Rahmenbedingungen wie demografische, ökonomische, politische und ökologische Strukturen und Prozesse analysieren und kritisch interpretieren zu können. Im Einzelnen geht es darum, die wesentlichen demografischen Trends (wie Migration, natürliches Wachstum, Alterung), ökonomischen Entwicklungen (wie Globalisierung, Tertiarisierung, Polarisierung von Regionen, Stadtgesellschaften, Arbeitsmarkt und interkommunaler Wettbewerb), politischen Veränderungen (wie z. B. »unternehmerische Stadtpolitik«, Populismus und Radikalisierung) und deren gesellschaftliche Auswirkungen zu kennen und diese vor dem Hintergrund von Gesellschaftstheorien erklären sowie Interventionen im Rahmen staatlicher Sozial-/Wohlfahrtsregime konzipieren und bewerten zu können. Darüber hinaus gilt es, die politischen, rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen für effektive Interventionen Sozialer Arbeit analysieren und, auf lokale Gegebenheiten übertragen, nutzen zu können. Das Wissen um individuelle Lebenslagen, aber auch sozialpsychologische und gruppensoziologische Erkenntnisse über menschliche Lebensformen und Milieus sind hilfreich, um Beteiligungs- und Aktivierungsprozesse in Gemeinwesen planen, initiieren und durchführen zu können, die den betroffenen Menschen, unter Einbezug ihrer Interessen und Fähigkeiten, mehr Handlungsoptionen eröffnen und ihre Selbstwirksamkeitserfahrungen erweitern. Sich als Fachkräfte weniger als »ProblemlöserIn«, sondern eher als »UnterstützerIn« von Potentialen und Interessen, die teilweise bereits vorhanden, aber noch nicht zur Geltung gekommen sind, zu verstehen, wäre dabei Teil der professionellen Haltung. Der Aufbau einer professionsbezogenen Identität wird durch eine Verständigung über die Geschichte und die Entwicklungsphasen des Handlungsfeldes ermöglicht. Dabei wird zur Reflexion des beruflichen Selbstverständnisses und der Wertvorstellungen, an denen sich das berufliche Engagement orientiert, herausgefordert. Die eigene Rolle als Gemeinwesen-/QuartierarbeiterIn bzw. QuartiermanagerIn oder sozialraumorientierte SozialarbeiterIn in anderen Handlungsfeldern definieren und gegenüber KollegInnen der eigenen und anderer Berufsgruppen/Professionen sowie AdressatInnen verständlich darzustellen, gehört zu den professionellen Kompetenzen. Dies impliziert, die für soziale Stadt-/Quartierentwicklung und Gemeinwesenarbeit wesentlichen Konzepte (wie z. B. Sozialraum-, Lebenswelt-, Ressourcen-, Managementorientierung) und Methoden (wie z. B. Empowerment, Netzwerkarbeit, Bürgerbeteiligung, Streetwork, Projektarbeit, Sozialstrukturanalyse, Sozialraumanalyse etc.) kennen und diese situations- und personengerecht entsprechend anwenden zu können. Dazu ist die Fähigkeit erforderlich, für das Handlungsfeld wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse recherchieren, analysieren, interpretieren und anwenden zu können. Neben Sozialstruktur- und Sozialraumanalysen sind weitere Methoden und Instrumente der Aktionsforschung (wie z. B. die aktivierende Befragung) zu kennen und konzipieren, durchführen und auswerten zu können.
Der überwiegende Teil der Interventionen im Handlungsfeld der sozialen Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit wird in Kooperation mit Institutionen, Verbänden und Vereinigungen organisiert. Für die Bearbeitung sozialer Probleme sind in diesem Kontext unterschiedliche institutionelle und disziplinäre Perspektiven relevant. Zur Akquise und Durchführung von Projekten ist der institutionellen Vernetzung besondere Bedeutung beizumessen. Fachkräfte Sozialer Arbeit können Kommunikations- und Arbeitsformen in Gemeinwesen konzipieren, die lokale Akteure und Bevölkerung miteinander verbinden, um die Belange des Quartiers auf den Ebenen Quartier-Kommune-Region zu positionieren. Sie können Projekte initiieren und durchführen, auswerten und öffentlichkeitswirksam darstellen. Sie können interdisziplinär, mit Angehörigen anderer Professionen, »auf gleicher Augenhöhe« zusammenarbeiten und dabei mit unterschiedlichen Hierarchiestrukturen umgehen.
Sowohl für die verschiedenen Beteiligungs- und Aktivierungsformen als auch für die Präsentation von Projekten und deren Ergebnisse werden grundlegende medienpädagogische Handlungs-, Ausdrucks- und Kommunikationskompetenzen für den Interaktionsprozess mit Einzelnen und Gruppen gebraucht. Fachkräfte sind in der Lage, Zusammenhänge übersichtlich und anschaulich zu visualisieren und dabei auch ein größeres Publikum einzubeziehen. Sie kennen Moderationstechniken für Großgruppen und Beteiligungsformen, die unterschiedliche Bildungsstände und Erfahrungen von BürgerInnen mit Beteiligungsformen berücksichtigen, und sind in der Lage, diese situations- und personenadäquat zu konzipieren und einzusetzen.
Den o. g. Kompetenzerfordernissen an Fachkräfte Sozialer Arbeit im Handlungsfeld sozialer Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit entsprechend ist dieser Band aufgebaut. Geschichte und Entwicklung des Handlungsfeldes sind Bestandteil des ersten Kapitels. Dort werden die Entwicklungen von den Wurzeln der sozialarbeiterischen Pionierarbeit der Settlementbewegung und Gemeinwesenarbeit bis zur heutigen Ausdifferenzierung des Handlungsfeldes der sozialen Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit mit ihren kritischen Phasen und unterschiedlichen Richtungen beschrieben. Mit der Darstellung der historischen Stadtentwicklung, ihren Epochen bis hin zu den Stadtplanungsphasen des 20. Jhs. werden bereits im zweiten Kapitel die ersten Erklärungsmodelle für heutige Muster der Stadtentwicklung geliefert. Damit ist der Boden bereitet für Kapitel 3, für tiefergehende theoretische Grundlagen von Stadtentwicklung, Urbanität und Raumbegriffen, mit denen sich die Besonderheiten urbanen Lebens erklären und verstehen lassen. Die Frage, welche gesellschaftlichen Veränderungen wesentlichen Einfluss auf heutige Städte und die darin lebende Bevölkerung ausüben und welche Konsequenzen sich daraus für Städte und ihre Quartiere ergeben, wird im vierten Kapitel beantwortet. Kapitel 5 steht dann ganz im Zeichen der Menschen in ihrem sozialen und räumlichen Umfeld und bearbeitet die Themen der Lebensstile, Lebensformen, Bevölkerungsalterung, Migration sowie soziale Ungleichheit und deren sozialräumliche Konsequenzen. Auf der Basis der bis dahin grundgelegten Kenntnisse geht Kapitel 6 auf aktuelle Leitbilder der Stadtpolitik und Stadtentwicklung ein. Finanzierungsmodelle für soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit werden vorgestellt und deren Auswirkungen diskutiert. Mit den »Empfehlungen für eine nachhaltige Stadt- und Quartierentwicklung« sowie »Kommunalpolitische Wahlprüfsteine« werden Tools für die praktische Anwendung vor Ort zur Verfügung gestellt. Die Anwendungs- und Praxisorientierung wird im siebten Kapitel mit wichtigen Grundlagen zu Praxisforschung und Bürgerbeteiligung sowie Anleitungen zum methodischen Handeln fortgeführt. Hilfreiche Empfehlungen und praktische Arbeitshilfen sind in den jeweiligen Kapiteln integriert. Alle Kapitel bauen inhaltlich aufeinander auf und folgen damit dem Inhalt und Ablauf einer Sozialraumanalyse ( Kap. 7.1). Ein Ausblick auf weitere anstehende Herausforderungen des Handlungsfeldes der sozialen Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit steht am Ende des Bandes und rundet die Beschreibung dieses Handlungsfeldes ab.
Um darauf hinzuweisen, dass mit und durch Sprache und Schrift in dieser Publikation grundsätzlich alle Menschen, unabhängig von Geschlecht und anderen Merkmalen, be- und geachtet werden, wird die symbolische Darstellung der Genderschreibweise mit großem »I« verwendet. Es sei dabei erwähnt, dass dieser Symbolverwendung weder eine bestimmte Ideologie zugrunde liegt noch aus dieser Schreibweise ein Fetisch gemacht werden sollte, wie Erich Fromm schon 1974 schrieb (2005: 14). Die selbstbewusste Variante der Soziologin Martina Löw wird damit nicht übernommen, die da lautet »Ich wähle im folgenden je nach Kontext entweder die weibliche oder die männliche Form als Verallgemeinerung« (Löw 2001: 16).