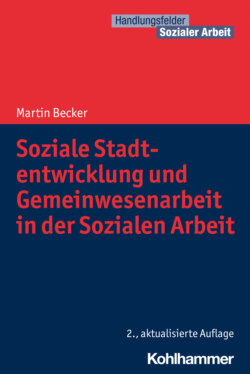Читать книгу Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit in der Sozialen Arbeit - Martin Becker - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Historische Entwicklung und Gegenstand der Gemeinwesenarbeit 1.1 Historische Entwicklung der Gemeinwesenarbeit
ОглавлениеGemeinwesenarbeit (GWA) als Soziale Arbeit in und mit Gemeinwesen1 hat ihre Wurzeln in der Phase der Industrialisierung und des Städtewachstums in den entwickelten Industrieländern im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert. Industriearbeitsplätze in den Städten und in zunehmendem Maße auch Dienstleistungsarbeiten erzeugten einen Zug von Menschen aus agrarwirtschaftlich geprägten ländlichen Gebieten in die zunehmend industrialisierten Städte. Dort konnten die Menschen nicht mehr auf die für ländliches Leben typischen familiären, verwandtschaftlichen und nachbarschaftlichen Hilfsnetze zur Sicherung der Lebensrisiken wie Missernten, Krankheit, Morbidität etc. zurückgreifen (Becker 2020a, 2016a, 2008).
Den »neuen Arbeitern« in den Städten standen die traditionalen bürgerlichen Formen sozialer Sicherung, wie Zünfte, Gilden, Stiftungen und Spitäler, wegen fehlender Zugehörigkeit nicht zur Verfügung. Daher wuchsen in den Städten mit jeder Struktur- und Konjunkturkrise Armuts- und Elendspopulationen, deren Hilfe- und Unterstützungsbedarf erst nach und nach durch zunehmend professionelle Hilfen von Wohlfahrtsverbänden der Kirchen oder der Arbeiterbewegung aufgebaut und geleistet wurde. Neben Übernachtungsmöglichkeiten, Kleiderspenden und Suppenküchen sollten auch soziale Kontakte unter der Bevölkerung in den Armutsvierteln sowie Gelegenheiten zu geselliger und kultureller Betätigung ein menschenwürdiges Leben ermöglichen (Müller 2009).
So entstanden in großen Städten nicht nur Europas und den USA soziale Initiativen von Menschen, die in die Elendsviertel zogen und dort versuchten, die Situation der Menschen mit diesen gemeinsam zu verändern und zu verbessern. In Großbritannien und den USA bekannt als »Settlementbewegung« aus Hochschul- und Kirchenkreisen (z. B. »Toynbee Hall/London«; »Hull House/Chicago«), in Deutschland bekannt als »Nachbarschaftshäuser« (z. B. »Volksheim« Hamburg oder »Soziale Arbeitsgemeinschaft« Berlin).
Nach den Recherchen von Oelschlägel (2013) über die Vorläufer der Gemeinwesenarbeit wurde 1884 in London mit »Toynbee Hall« das erste Settlement gegründet. Jane Addams und ihre Mitarbeiterinnen bezogen 1889 Hull House in Chicago. Walter Claasen gründete 1901 mit dem Volksheim Hamburg das erste Settlement in Deutschland. Im Berliner Osten gründete der Theologe Friedrich Siegmund-Schultze mit seiner Familie und Freunden 1911 die Soziale Arbeitsgemeinschaft (SAG) Berlin-Ost (Oelschlägel 2013; Müller 2009). Aus diesen Anfängen hat sich »Community-Work« mit seinen Richtungen »Community-Organization« und »Community-Development« in den USA, das »Opbouwwerk« in den Niederlanden sowie die »Gemeinwesenarbeit« in Deutschland entwickelt.
Oelschlägel erinnert daran, dass im ersten Drittel des 20. Jhs. seitens der damals sogenannten »kommunalen Fürsorge« und der »Freien Wohlfahrtspflege« bereits inhaltliche und organisatorische Grundsätze einer »stadtteilbezogenen sozialpraktischen Arbeit« gefordert und praktiziert wurden (Buck 1982; Oelschlägel 2013). Pionierinnen der Sozialen Arbeit wie Alice Salomon oder Marie Baum erkannten schon früh die Bedeutung des Einbezugs des sozialen und räumlichen Umfeldes von Wohnquartieren, Nachbarschaften und kommunaler Politik in Ergänzung zur Einzelfall- und Familienhilfe (vgl. Alice Salomon in Thole/Galuske/Gängler 1998: 132 f.; Marie Baum in Eggemann/Hering 1999: 216). Neben staatlicher Fürsorge und freien Wohlfahrtsverbänden hatte auch die Arbeiterbewegung, insbesondere die Kommunistische Partei Deutschlands mit ihrer Stadtteilarbeit in den zwanziger und dreißiger Jahren Gemeinwesenarbeit in Deutschland praktiziert (Müller 1971: 238). Während sich in Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus die Gemeinwesenarbeit – wie andere Formen fortschrittlicher Sozialer Arbeit auch – nicht weiterentwickeln konnte, erlebte sie in den 1970er Jahren einen vorwiegend politisch motivierten Aufschwung, der in den 1980er Jahren wieder nachließ (Odierna 2004; Oelschlägel 1989/2013).
Zunächst dauerte es etliche Jahre, bis im Nachkriegsdeutschland Gemeinwesenarbeit als Begriff und methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit durch Rezeption der zwischenzeitlichen Entwicklungen in USA, Groß-Britannien und den Niederlanden wieder Fuß fassen konnte. Erste Publikationen in den 1950er Jahren (Kraus 1951; Lattke 1955) und Tagungen (Mayer-Kulenkampff 1962; Friedländer 1962) beschäftigten sich mit der Thematik und dem Ziel, Gemeinwesenarbeit in Deutschland wieder für die Soziale Arbeit bekannt und nutzbar zu machen (Vogel/Oel 1966). Das Spektrum der inhaltlichen Beschreibungen und Zielsetzungen von Gemeinwesenarbeit bewegte sich zwischen eher systemkonformen Lesarten, wonach Gemeinwesenarbeit die Aufgabe habe, latente Defizite bekannt zu machen und dafür Hilfsquellen des Gemeinwesens zu erschließen, und systemkritischem Verständnis der Aufdeckung von und Kritik an gesellschaftlichen Widersprüchen und Konflikten (Oelschlägel 2013). Oelschlägel benennt drei Gründe für den Anstieg praktischer Gemeinwesenarbeit in den 1950er und 1960er Jahren:
• Erstens konnten die Träger sozialer Dienste den steigenden Hilfebedarf mit den gegebenen materiellen und methodischen Maßnahmen nicht mehr decken, sodass eine methodische Weiterentwicklung erforderlich wurde.
• Zweitens kamen Staat und Kommunen durch die wachsende Kritikfähigkeit der Bürgerschaft und die Konkurrenz zwischen kapitalistischem System in der BRD und sozialistischem Regime in der DDR zunehmend unter Legitimationsdruck, der eine Orientierung am Gemeinwohl und Gemeinwesen nahelegte.
• Drittens forderten die professionellen SozialarbeiterInnen neue Strategien, um der zunehmenden Diskrepanz zwischen erhöhter Leistungsnachfrage und offensichtlichen Leistungsdefiziten sozialer Dienste zu entgehen (Oelschlägel 2013).
Nichtstaatliche Organisationen und Initiativen engagierten sich in Obdachlosensiedlungen, um dort »Hilfe zur Selbsthilfe« zu leisten. Später forcierten insbesondere christliche Kirchengemeinden in Neubaugebieten der 1960er Jahre den Ausbau einer diakonisch verstandenen Gemeinde-/Gemeinwesenarbeit, indem z. B. Gemeindehäuser errichtet wurden, die für die gesamte Bevölkerung des Gemeindegebietes oder Stadtteils offen sein sollten.2 Bereits Ende der 1960er Jahre wurde in der bundeszentralen Fort- und Weiterbildungsstätte der evangelischen Kirche, dem Burckhardthaus Gelnhausen, das erste Weiterbildungsprogramm zu Gemeindeaufbau und -wesenarbeit mit Pfarrer Manfred Dehnen als erstem Dozenten gestartet, das in langer Tradition bis in das 21. Jh. fortgeführt wurde (Müller 2009: 218 ff.).
Die ersten Erfahrungen mit GWA in Neubaugebieten (frühe Beispiele waren Stuttgart-Freiberg, Wolfsburg und Baunatal bei Kassel), insbesondere mit dem Großsiedlungsbau der Trabantenstädte (z. B. »Osdorfer Born« in Hamburg; »Märkisches Viertel« in Berlin; »Neu-Perlach« in München; »Landwasser« in Freiburg), offenbarten die Mängel der bis dahin gewöhnlich top-down angelegten Stadtplanung ohne Bürgerbeteiligung (Hubbertz 1984; Gronemeyer/Bahr 1977). GWA sollte dazu beitragen, dass bei Planungen die Bevölkerung in die Gestaltung ihres Lebensumfeldes einbezogen und nicht über ihre Köpfe hinweg geplant und entschieden wird. Damit verbunden war die Forderung an professionelle Soziale Arbeit, sich in Stadt-(Teil-)Planung einzumischen und das Feld nicht alleine den »Bauplanern« zu überlassen (Wendt 1989).
In diesem Entwicklungsstadium der GWA wurde deren gesellschaftspolitische Bedeutung offensichtlich und entsprechend kontrovers diskutiert. Während Gemeinwesenarbeit einerseits obrigkeitsstaatliches (hier kommunales) Handeln durch Information der Bevölkerung legitimieren und die Menschen von der Notwendigkeit und Richtigkeit planerischer Entscheidungen, wie z. B. Sanierungs- und Neubaumaßnahmen, überzeugen sollte, wurde von anderer Seite die gesellschaftskritische Rolle der GWA und die Aufgabe der Demokratisierung der Gesellschaft reklamiert (Müller, W. 1972: 85).
Ziel der GWA war damals die Organisation der Menschen im Stadtteil. Die Wege zur Zielerreichung variierten allerdings zwischen der Selbstorganisation der Betroffenen, bei der GWA die Aufgabe zukommt, Möglichkeiten der Selbstorganisation zu initiieren und zu unterstützen, und der von anderen damaligen Akteuren intendierten Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse durch Engagement für die »Arbeiterklasse« und in deren Organisationen (Oelschlägel 2013).
Die Diskussionen über GWA und innerhalb der professionellen GWA spiegelten sich in den Fachpublikationen, womit sich zunehmend eine eigenständige deutsche GWA-Rezeption entwickelte. Die GWA-Klassiker von Murray Ross (1968) und Joe Boer (1970) wurden von C. W. Müller (1971) und dem Arbeitskreis kritische Sozialarbeit (AKS 1974) für ihre »systemerhaltende« Haltung kritisiert. Die Schriften von Saul Alinsky (1973; 1974) wurden neben anderen damals wesentlichen Ansätzen in dem Reader zur Theorie und Strategie von GWA der Victor-Gollancz-Stiftung3 (1974) rezipiert.
Ende der 1960er Jahre organisierten sich GemeinwesenarbeiterInnen anlässlich der Tagung des Verbandes Deutscher Nachbarschaftsheime (ab 1971 »Verband für sozial-kulturelle Arbeit e. V.«) und gründeten innerhalb des Verbandes, aber in Koordination mit Berufsverbänden (»Moderne Sozialarbeit«) und Gewerkschaften (ÖTV und GEW) die Sektion Gemeinwesenarbeit. Das »Forum Märkisches Viertel« in Berlin war zum vorläufigen Informations- und Koordinationszentrum geworden, und mit einem eigenen Rundbrief wurden Anschriften interessierter GemeinwesenarbeiterInnen, Kurzcharakteristiken neuer Projekte der GWA und Hinweise auf Fachliteratur und Tagungen in Fachkreisen publik gemacht. Diese Sektion GWA hatte Bestand bis 1979 (Oelschlägel 2013).
Bereits zu Beginn der 1970er Jahre wurden empirische Untersuchungen zu den Wirkungen der GWA durchgeführt, die u. a. den damals hohen politischen Anspruch in der Praxis als nicht einlösbar beurteilte, sondern die GWA im Spannungsfeld zwischen Behördenzielen und Bevölkerungsinteressen verortet sah (Victor-Gollancz-Stiftung 1972; Mesle 1978). Schon damals wurde als Erkenntnis aus den Untersuchungen die Notwendigkeit der Verbindung zwischen GWA und Stadtplanung/-entwicklung als kommunalpolitische Aufgabe erkannt (Müller 2009: 223 ff.). Soziale Arbeit in und mit Gemeinwesen war in Deutschland als »Gemeinwesenarbeit (GWA)« also zuerst eine weitere Methode neben Einzelfallhilfe und sozialer Gruppenarbeit (1950er Jahre), danach eine revolutionäre Vision (1960/70er Jahre) und durchlief seit den 1980er Jahren weitere Entwicklungen.
Zunächst führte die unter dem Begriff »Ölkrise« bekannte Wirtschaftskrise Mitte der 1970er Jahre zur Beendigung der Reformzeit im Bildungs- und Sozialwesen. »Radikalenerlass« und Berufsverbote, als Reaktion auf die Gewaltakte der »Rote Armee Fraktion« (RAF), bremsten darüber hinaus die Aktivitäten konfliktorientierter GemeinwesenarbeiterInnen und führten zu einer Ernüchterung bezüglich der Bedeutung von Gemeinwesenarbeit in Deutschland. Als Zeichen dieser Ernüchterung wurde im Herbst 1975 im Rahmen einer Tagung über konfliktorientierte GWA in Berlin eine symbolische Todesanzeige auf die Gemeinwesenarbeit mit folgendem Wortlaut veröffentlicht:
»Nach einem kurzen, aber arbeitsreichen Leben verstarb unser liebstes und eigenwilligstes Kind GWA an Allzuständigkeitswahn, Eigenbrötelei und Profilneurose, methodischer Schwäche und theoretischer Schwindsucht, finanzieller Auszehrung und politischer Disziplinierung. Wir, die trauernden Hinterbliebenen, fragen uns verzweifelt, ob dieser frühe Tod nicht hätte verhindert werden können?« (Müller 2009: 229)
Dass Mitte der 1970er Jahre, trotz erfolgreicher Arbeit, sowohl die Victor-Gollancz-Stiftung aufgelöst als auch das Burckhardthaus Gelnhausen organisatorisch umstrukturiert wurde, scheint kein Zufall, sondern Folge der Zerreißproben zwischen meist ehrenamtlichen Vorständen, mehr oder weniger traditioneller Wohlfahrtsorganisationen und deren professionellen, vorwiegend progressiven MitarbeiterInnen gewesen zu sein. Mit der Phase des politischen Aufbruchs, durch »Studentenbewegung« und »außerparlamentarische Opposition«, zu mehr Demokratie und Beteiligung der BürgerInnen an der sie betreffenden Politik, wuchsen in der Folgezeit neue soziale Bewegungen (Frauen-, Friedens-, Öko-, Bürgerinitiativen etc.) heran, die das Bewusstsein für die Gestaltung der Lebensbedingungen und einen lokalen Bezug unter dem Slogan »global denken – lokal handeln« schärften.
Erfahrungen und Kenntnisse aus der Gemeinwesenarbeit wurden vor allem von Oelschlägel Anfang der 1980er Jahre zu einem Handlungsfeld übergreifenden Konzept »Gemeinwesenarbeit als Arbeitsprinzip« der Sozialen Arbeit formuliert (vgl. Boulet/Krauss/Oelschlägel 1980). Dabei konnte sich Oelschlägel auf ältere Quellen von Steinmeyer (1969) beziehen, der schon Ende der 1960er Jahre ein, über den Methodenbegriff hinausgehendes, Verständnis von GWA vorschlug (Oelschlägel 2013). Auch auf den Tagungen der Victor-Gollancz-Stiftung wurde GWA bereits in den 1970er Jahren als Form einer stadtteilbezogenen, kooperativen und methodenintegrativen Sozialarbeit beschrieben (Graf 1976). »Gemeinwesenarbeit als Arbeitsprinzip« war demnach zu verstehen als eine Grundorientierung, Sichtweise und Haltung professionellen sozialen Handelns, die eine grundsätzliche Herangehensweise an soziale Probleme im Rahmen professioneller Sozialer Arbeit impliziert. Mit dem »Arbeitsprinzip Gemeinwesenarbeit« verbundene Merkmale:
• »Das Arbeitsprinzip GWA erkennt, erklärt und bearbeitet, soweit das möglich ist, die sozialen Probleme in ihrer historischen und gesellschaftlichen Dimension. Zu diesem Zweck werden Theorien integriert, die aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen stammen. Damit ist das Arbeitsprinzip GWA auch Werkzeug für die theoretische Klärung praktischer Zusammenhänge.
• Das Arbeitsprinzip GWA gibt aufgrund dieser Erkenntnisse die Aufsplitterung in methodische Bereiche auf und integriert Methoden der Sozialarbeit (Casework, Gruppenarbeit usw.), der Sozialforschung (z. B. Handlungsforschung) und des politischen Handelns (Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerversammlungen etc.) in Strategien professionellen Handelns in sozialen Feldern.
• Mit ihren Analysen, Theorien und Strategien bezieht sich GWA auf ein »Gemeinwesen«, d. h. den Ort, wo die Menschen samt ihrer Probleme aufzufinden sind. Es geht um die Lebensverhältnisse und Lebenszusammenhänge der Menschen, wie diese sie selbst sehen (Lebensweltorientierung). GWA hat eine hohe Problemlösungskompetenz aufgrund ihrer lebensweltlichen Nähe zum Quartier. Als sozialräumliche Strategie, die sich auf die Lebenswelt der Menschen einlässt, kann sie genau die Probleme aufgreifen, die für die Menschen wichtig sind, und sie dort lösen helfen, wo sie von den Menschen bewältigt werden müssen. Dabei kümmert sich GWA prinzipiell um alle Probleme des Stadtteils und konzentriert sich nicht, wie oft Bürgerinitiativen, auf einen Punkt. Damit schafft sie Kontinuität, auch wenn es in dem einen oder anderen Fall Misserfolge gibt.
• Das Arbeitsprinzip GWA sieht seinen zentralen Aspekt in der Aktivierung der Menschen in ihrer Lebenswelt. Es will sie zu Subjekten auch politisch aktiven Lernens und Handelns machen, will selbst zu einer »Handlungsstrategie für den sozialen Konflikt« werden. Das bedeutet allerdings, dass GWA die scheinbare Neutralität vieler GWA-Konzepte aufgibt und parteilich wird.« (Oelschlägel 2013: 191)
Gesellschaftliche Entwicklungen im vierten Quartal des 20. Jhs., wie ökologische Krisen, Massenarbeitslosigkeit, neue Armut, Jugendproteste, Veränderungen der Parteienlandschaft, Entstehung alternativer oder hedonistischer Milieus, stärkere Individualisierung u. ä. (Beck 1986), haben in den Sozialwissenschaften zu einer Ausdifferenzierung und Suche nach neuen Gesellschaftsbeschreibungen geführt (Pongs 1999). Mit der Orientierung an Alltag und Lebenswelt bzw. der subjektiven Lebensqualität aus Sicht der Menschen in ihrer jeweiligen Lebenssituation ist Lebensweltorientierung (Thiersch 2009) in den 1980er Jahren zu einem zentralen Handlungskonzept der Sozialen Arbeit, so auch der GWA geworden.
In Gesellschaften und Quartieren mit großer Wertepluralität/-vielfalt machen unterschiedliche Werte möglicherweise unsicher und ängstlich. Deshalb wird Kontakt und Konfrontation tendenziell eher vermieden, wodurch Unverständnis, Missverständnis und Misstrauen eher noch anwachsen (Sennett 1983; Hinte/Lüttringhaus/Oelschlägel 2007: 99 ff.). Wenn Wertehomogenität und Wertekonsens angesichts unterschiedlicher, pluraler Lebensentwürfe und Lebensstile nicht (mehr) herstellbar sind, gehört gerade die Aushandlung von Regeln, etwa im Sinne der von Norbert Elias (1976) beschriebenen Zivilisierungsprozesse des Ausbalancierens von Machtpotentialen, mittels Diskussionen über Strittiges, Alltägliches, Einigendes, zum gesellschaftlichen Auftrag Sozialer Arbeit in Gemeinwesen, in denen Bevölkerung unterschiedlicher Herkunft, sozialer Lage und Lebensstile auf vergleichsweise engem Raum zusammenleben (müssen).
Während Oelschlägel und andere begrifflich an »Gemeinwesenarbeit« festhielten, verwendeten Hinte u. a. den Begriff »Stadtteilarbeit« und »stadtteilbezogene Soziale Arbeit« (Hinte/Metzger-Pregizer/Springer 1982) und entwickelten ein »Fachkonzept«, das zur Anwendung in einigen Handlungsfeldern Sozialer Arbeit, wie z. B. der »Jugendhilfe« (Hinte/Treeß 2007) der »Offenen Jugendarbeit« (Deinet 2005) oder der »Hilfe zur Erziehung« (Peters/Koch 2004) weiter schriftlich ausgearbeitet wurde.
Im Laufe der 1990er Jahre erfuhr der Terminus »Stadtteilorientierung« eine Umformulierung in »Sozialraumorientierung« verbunden mit zunehmender Verbreitung und Potential zu einem integrativen Handlungskonzept, mit Wirkungen über die Soziale Arbeit hinaus auch in andere Disziplinen (s. u., Literatur zu Sozialraumorientierung). Die Tatsache, …
»… dass zunehmend räumliche Einflüsse in das Blickfeld der kommunalpolitischen Akteure gerieten, dass sozialräumliche Strategien zunehmend anerkannt wurden und dass integriertes, ressortübergreifendes Denken in den Verwaltungen an Bedeutung gewinnen konnte …« (Hinte/Lüttringhaus/Oelschlägel 2007: 99)
…, kann als Ursache für die Entwicklung verschiedener politischer Fach-Programme, wie »soziale Stadtentwicklung«, »lokale und solidarische Ökonomie«, »Gesundheitsförderung«, »Bürgerschaftliches Engagement«, »Gemeindenahe Psychiatrie« etc., angesehen werden, die auf dem »Handlungskonzept Sozialraumorientierung« aufbauen. Die Prinzipien stadtteilbezogener bzw. sozialraumbezogener Arbeit nach Hinte u. a. (2007: 9) sind:
• Der Wille bzw. die Interessen der leistungsberechtigten Menschen als Ausgangspunkt jeglicher Arbeit und nicht Wünsche oder Bedarfe
• Vorrang aktivierender Arbeit vor betreuender Tätigkeit
• Personale und sozialräumliche Ressourcen spielen bei der Gestaltung von Arrangements eine entscheidende Rolle
• Aktivitäten sind immer zielgruppen- und bereichsübergreifend angelegt
• Vernetzung und Integration verschiedener sozialen Dienste sind Grundlage einer nachhaltig wirksamen Sozialen Arbeit (Hinte in: Hinte/Lüttringhaus/Oelschlägel 2007: 9).
In den 1990er Jahren erlebte die von Saul Alinsky bereits Mitte des 20. Jhs. in den USA entwickelte und praktizierte Mobilisierung von Bevölkerung für ihre eigenen Anliegen unter dem Namen »Community Organizing« (CO) eine Renaissance in Europa, insbesondere in Deutschland. Morlock u. a. veröffentlichten 1991 einen Vergleich zwischen GWA und CO. Nach der Jahrtausendwende hatte sich CO in Deutschland weiterverbreitet, wofür auch die Gründung der Plattform »Forum Community Organizing« (FOCO 1997) als Beleg gelten darf (vgl. Szynka 2006; Penta 2007). Mehr über diese und andere Formen von sozialraumorientierter Arbeit findet sich an anderer Stelle dieses Buches sowie in der angegebenen einschlägigen Literatur (vgl. Stövesand u. a. 2013).
Zwischenzeitlich wird Gemeinwesenarbeit nicht nur in Stadtteilen und Quartieren eingesetzt, die zu »Problemgebieten« geworden sind, sondern bereits in neu aufzubauenden Stadtteilen zur Förderung des sozialen Lebens und zur Vermeidung von Problemkonstellationen implementiert (Maier/Sommerfeld, 2005)4. Gegen Ende der 1990er Jahre hat sich in der Fachwelt der Begriff »Stadtteil- oder Quartiermanagement« entwickelt und im Laufe der 2000er Jahre verbreitet. Dabei geht es um die Beantwortung der Fragen, wer und wie für die Entwicklung von Stadtteilen bzw. Quartieren verantwortlich sein soll und kann (Alisch 1998). Grimm, Hinte und Litges (2004) legten mit ihrer Publikation »Quartiermanagement. Eine kommunale Strategie für benachteiligte Wohngebiete« einen Vorschlag zur Systematisierung der sehr inkonsistent verwendeten Begrifflichkeiten von »Stadtteil-/Quartiermanagement«, »Gemeinwesen-/Stadtteilarbeit« vor. Hintergrund für die Management-Orientierung waren u. a. Stadtentwicklungsprogramme wie das Bund-Länder-Programm »Soziale Stadt« (2019) und der Trend zu neueren Steuerungsmodellen der öffentlichen Verwaltung (Becker 2020a). In deren Rahmen spielen sowohl die verwaltungsinterne Koordination der Kommunalpolitik als auch die »Akzentverschiebung kommunaler Leitbilder« (Hinte/Lüttringhaus/Oelschlägel 2007: 179) von der Kunden- zur Bürgerorientierung eine Rolle (Becker 2016b).
Die Implementation von Quartiermanagement unter Einsatz von Fachkräften Sozialer Arbeit ist zwischenzeitlich auch im Rahmen von Projekten der Wohnungswirtschaft feststellbar. Neben den klassischen Aufgaben des Beschwerdemanagements und der Wohnberatung stehen dabei auch allgemeine Sozialberatung, Konfliktmoderation sowie Anregungen zu und Organisation von gemeinsamen Aktivitäten der BewohnerInnen bis hin zur Initiierung von sozialen Netzwerken gegenseitiger Hilfe bei der Betreuung von Kindern, alten Menschen oder Menschen mit Behinderungen auf der Liste der Tätigkeitsbeschreibung von GemeinwesenarbeiterInnen im Dienste von kommunalen Wohnungsgesellschaften oder Wohnungsgenossenschaften.5
Im Folgenden werden wesentliche Grundlagen Sozialer Arbeit im Handlungsfeld sozialer Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit dargestellt.