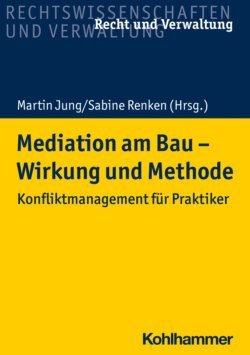Читать книгу Mediation am Bau - Wirkung und Methode - Martin Jung - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8.Das Verfahren in der Mediation
Оглавление58Mediation ist ein strukturiertes Verfahren. Das heißt, eine Mediation folgt bestimmten Regeln, die sich bewährt haben, um den Prozess der Konfliktbearbeitung und -bewältigung behutsam und bewusst in Gang zu bringen, anzuleiten und zu ordnen.
59Das Verfahren durchläuft 5 Phasen,27 die hier im Einzelnen genauer beschrieben werden. Ein erfahrener Mediator kann diesen Weg im Verlauf des Prozesses auch einmal verlassen oder kurz abschweifen, aber im Prinzip folgt er dieser Struktur. Es hat sich auch erwiesen, dass es sinnvoll sein kann, einen Schritt in eine vermeintlich abgeschlossene Phase zurück zu gehen, wenn sich herausstellt, dass diese Phase noch nicht beendet war. Oft zeigt sich dann, dass der Prozess noch unvollständig gewesen ist und daher wichtige Elemente auf dem Weg zur Einigung fehlen.
60a) Phase 1 – Eröffnung. Die Eröffnungsphase dient der Vorbereitung des Verfahrens, der Aufklärung der Parteien, der Klärung organisatorischer und verfahrensrelevanter Fragen sowie der Festlegung gemeinsamer Regeln für dieses.
61aa) Strukturieren des Verfahrens. Gerade in bauwirtschaftlichen Streitigkeiten macht es Sinn, den Konflikt vor Beginn des eigentlichen Verfahrens stärker zu strukturieren.
62Baustreitigkeiten zeichnen sich oft dadurch aus, dass es um viele verschiedene Sachverhalte, Mängel und Probleme geht, welche die Angelegenheit auf den ersten Blick undurchschaubar machen. Wirtschaftsmediatoren lassen sich vor den eigentlichen Verhandlungen von den Parteien oder deren anwaltlichen Vertretern eine schriftliche Zusammenfassung des Sachverhaltes bzw. der jeweiligen Ansprüche geben, um eingrenzen zu können, welche Art von Konflikt vorliegt, wer davon direkt und indirekt betroffen ist, und was die jeweiligen Ziele der Parteien sein könnten. Es ist hilfreich, wenn der Streitstoff dem Mediator bereits bekannt ist, damit er eine Struktur und ein Verfahrensdesign schaffen kann, innerhalb derer sich die Gespräche bewegen.
63Es ist sinnvoll, ein Vorgespräch nur mit den beteiligten Rechtsanwälten zu führen, weil dieses ohne die möglicherweise vorhandenen Animositäten zwischen den Parteien sachorientierter geführt werden kann und dem Mediator ermöglicht, die anliegenden Themen zu sortieren und entsprechend der Sachlage zu gewichten.
64Diese Informationen sind auch in Hinblick auf die Notwendigkeit der Einbeziehung Dritter, z. B. Sachverständige und Experten wie etwa Statiker oder Steuerberater wichtig. Eventuell müssen Sachfragen geklärt werden wie der Wert eines Grundstückes oder die Prognose eines Schadensverlaufs. Dazu muss der Mediator mit den Parteien besprechen, ob und wie externe Experten einbezogen werden können oder müssen. Diese Frage kann auch noch in späteren Phasen der Mediation auftauchen, aber eine möglichst genaue Beschreibung des Konfliktes am Anfang erleichtert dem Mediator die Einstimmung auf das Verfahren und dessen Vorbereitung. Damit kann auch sichergestellt werden, dass der Teilnehmerkreis vollständig ist und etwa alle wichtigen Entscheidungsträger an der Mediation teilnehmen.
65Dabei können auch zukunftsorientierte Fragen und Aspekte eine Rolle spielen, zum Beispiel welche (wirtschaftlichen) Konsequenzen es hat, wenn der Konflikt nicht rasch gelöst wird. Möglicherweise gibt dies einen Hinweis darauf, wie Eskalation und Ausweitung von Konflikten bis auf weiteres vermieden werden können.
66bb) Aufklärung der Parteien. Wenn die Parteien dies verlangen, muss der Mediator die Parteien „über seinen fachlichen Hintergrund, seine Ausbildung und seine Erfahrung auf dem Gebiet der Mediation informieren“.28
67Der Mediator erklärt den Medianden den Ablauf des Verfahrens29 und stellt sicher, dass alle Beteiligten wissen, was sie erwartet und sich den Umständen entsprechend „wohl fühlen“, d. h. dass das setting wie etwa die Räumlichkeiten und die Sitzordnung für alle passt.
Das gemeinsame Gespräch über Verhaltensregeln, z. B. über die Art und Weise der Kommunikation (sich gegenseitig ausreden lassen, keine Beleidigungen, aufmerksam zuhören) schafft eine erste Grundlage für eine gelungene Einleitung des Prozesses.
68Das Interventionsrecht des Mediators, der die Verantwortung für den Ablauf des Verfahrens trägt und eingreift, wenn es erforderlich ist, sollte ebenfalls besprochen werden. In der Eröffnungsphase muss der Mediator die Erlaubnis für seine Gestaltungsfunktion einholen. So kann er die Parteien etwa fragen, ob bestimmte Interventionen wie z. B. Pausen oder Brainstorming-Techniken für sie akzeptabel sind.
69cc) Klärung organisatorischer und verfahrensrelevanter Fragen. Alle Beteiligten legen gemeinsam die Termine und den Ort für die Verhandlungen fest. Je nach Streitstoff sollte auch besprochen werden, ob Einzel- oder Vorgespräche mit einzelnen Parteien oder deren Vertretern stattfinden sollen, und unter welchen Umständen zwischen den einzelnen Terminen Telefongespräche mit dem Mediator stattfinden dürfen oder sollen – denn auch damit müssen die Parteien einverstanden sein, sonst setzt sich der Mediator leicht dem Vorwurf der Parteilichkeit aus. Es gibt auch die Möglichkeit eines shuttle-Verfahrens, in welchem überhaupt keine gemeinsamen Gespräche stattfinden, sondern der Mediator abwechselnd mit den Parteien spricht.30
70dd) Mediationsvereinbarung. Viele Mediatoren veranlassen die Parteien, eine Vereinbarung über Sinn und Ziel der Mediation zu treffen. Das ist ein guter Weg, um den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, und zu klären, worum es den Parteien geht. Im Gegensatz zum Mediationsvertrag31 ist dies kein rechtlich bindender Vertrag, sondern dient zur Klärung der mit den Prinzipien der Mediation vereinbaren Erwartungen der Parteien an das Verfahren.
71Die Frage dazu kann etwa lauten: „Was wollen Sie hier in der Mediation gemeinsam erreichen?“ Die Antwort auf diese Frage kann natürlich nicht das Ziel vorwegnehmen, aber immerhin dazu führen, dass die Parteien eine erste Annäherung erreichen, etwa: „Wir wollen die Mängel- und Honorarfragen für alle verbindlich klären oder wir wollen herausfinden, ob und wie wir in Zukunft weiter zusammenarbeiten können“.
72Wenn alle Beteiligten mit den vereinbarten Regeln und dem geplanten Ablauf der Mediation einverstanden sind, können die Mediationsverhandlungen beginnen.
73b) Phase 2 – Themensammlung. In der zweiten Phase der Mediation bekommen die Parteien zunächst den Raum, den sie brauchen, um den Konflikt aus ihrer jeweiligen Sicht zu schildern. Dabei hat jede Partei so viel Zeit wie nötig, um ihre Position darzulegen. Der Mediator sollte auf in etwa gleiche Redezeiten achten. Er fragt nach, wenn es Verständnisfragen gibt, fasst die Sachverhalte zusammen und formuliert die Darstellung um, damit die eine Seite genau versteht, um was es der jeweils anderen geht. Dabei muss er darauf achten, ergebnisoffen zu formulieren und nicht die Positionen der Parteien einfach wiederzugeben oder potenzielle Lösungen vorwegzunehmen, also so neutral wie möglich aufzulisten, was die Streitpunkte sind.
74Der Mediator sammelt die Themen, die den Parteien wichtig sind, in Bausachen etwa: Honorar- und Mängelfragen, verspätete Leistungen, Planungsdefizite oder Behinderungen, stellt sie im Austausch mit den Parteien optisch auf einem Flipchart oder Whiteboard dar und ordnet sie gleichzeitig nach Rang und Reihenfolge für die darauf folgende Diskussion. Er sollte durch aktives Zuhören und Nachfragen sicherstellen, dass wirklich alle relevanten Themen auf den Tisch kommen, weil die Bearbeitung aller Probleme für eine nachhaltige Regelung des Konfliktes wichtig ist. Ganz entscheidend ist in dieser Phase der Mediation auch das Sammeln aller für den Konflikt relevanten Informationen.
Das Erarbeiten einer gemeinsamen Themenliste, die Zusammenstellung der dazu notwendigen Fakten und eine Verständigung über die Reihenfolge in der Diskussion helfen den Parteien, eine Zusammenarbeit zu beginnen, und sei es auf der Ebene des Verfahrensdesigns.
75Ganz entscheidend in dieser Phase ist, dass die Kommunikation zwischen den Streitenden über den Mediator läuft, weil so sichergestellt ist, dass die Positionen in Themen umgewandelt werden können, und sich damit nicht mehr so diametral gegenüberstehen, sondern eine Arbeitsgrundlage bilden. Das heißt, die Gesprächsführung durch den Mediator sollte die Parteien daran hindern, sich wiederum gegenseitig Vorwürfe zu machen, sondern vielmehr darauf zielen, die strittigen Punkte neutral und sachlich herauszuarbeiten, und damit eine Gesprächsgrundlage zu schaffen mit der sich arbeiten lässt. Dabei muss der Mediator den Parteien auch Raum und Zeit für ihren Ärger einräumen, damit sie sich gehört fühlen.
76Es ist optimal, wenn die Parteien während der durch den Mediator gesteuerten Themensammlung schon durch das Zuhören und Mitarbeiten begreifen, welche unterschiedlichen Sichtweisen auf die Dinge bestehen – und dass eine bewertungsneutrale Darstellung der Anfang eines strukturierten Lösungsprozesses sein kann.
77In der baurechtlichen Streitigkeit können die Anwälte in dieser Phase dazu beitragen, dass keine Themen liegen gelassen werden und eine vollständige „Problemliste“ entsteht, die in der Folge abgearbeitet werden kann. Unter Umständen kann der Mediator in dieser Themenliste Probleme entdecken, die nicht so streitbehaftet oder gravierend sind und die Parteien bitten, diese bis zur nächsten Sitzung ohne Mithilfe des Mediators – zumindest unter dem Vorbehalt einer vollständigen Einigung – zu lösen. Wenn das gelingt, ist dies eine gute Voraussetzung für die weitere Zusammenarbeit der Beteiligten in der Mediation.
78c) Phase 3 – Herausarbeiten der Interessen. Die dritte Phase der Mediation hat besondere Bedeutung für die Klärung des Konfliktes. Sie ist vermutlich die Interessanteste und vor allem für den Mediator eine Herausforderung.32 Hier gilt es die Hintergründe, den Konflikt hinter dem Konflikt, herauszufinden, das heißt die Interessen und Bedürfnisse der Medianden auszuleuchten. Es geht jetzt um das, was sich unter der Oberfläche befindet und bisher nicht sichtbar geworden ist. In dieser Phase muss der Mediator nachfragen, erneut klären und auch schrittweise die direkte Kommunikation zwischen den Parteien wieder herstellen. Jetzt kann es notwendig sein, Einzelgespräche zu führen, wenn und weil es den Medianden schwer fällt, in Gegenwart der anderen Partei über ihre Bedürfnisse und Wünsche zu sprechen.
79Das Denken in Positionen fällt den Parteien leichter, weil sie es gewohnt sind und sie ihre jeweilige Position im Zweifel seit der Entstehung des Konfliktes als ihre (subjektive) Realität sehen. Sie glauben, einen bestimmten Anspruch zu haben bzw. diesen ganz sicher abwehren zu können. Deshalb ist es nötig, die dahinter liegenden Interessen zu identifizieren. Das trägt dazu bei, die Bedürfnisse – z. B. nach Anerkennung ihrer Leistung oder einem auskömmlichen Auftrag – auf einem anderen als dem vorgestellten und eingefahrenen Weg zu befriedigen.
80Die Auseinandersetzung mit den Interessen anstelle der Positionen kann also die bisherige Strategie der Bedürfnisbefriedigung, dem Bestehen auf einer Position, erweitern und verändern.
Beispiel: Ein Architekt will unbedingt, dass seine bisher erbrachten Planungs- und Bauüberwachungsleistungen an einem Bauwerk in Teilen abgenommen werden, der Bauherr ist strikt dagegen. In der Mediation stellt sich heraus, dass der Architekt sich demnächst zur Ruhe setzen und sein Büro an einen Nachfolger übergeben will – daher möchte er seine Haftung zeitlich so weit wie möglich eingrenzen.
81Tatsächlich stellt sich meistens erst in der dritten Phase der Mediation heraus, worum es den Beteiligten wirklich geht, und dann eröffnen sich auf einmal ganz neue Wege des Verständnisses und der Möglichkeiten für eine Lösung. Um dieses Verständnis herzustellen, muss der Mediator die Konfliktbeteiligten dazu bringen, ihre jeweiligen Bedürfnisse und Interessen zu erkennen und zu artikulieren, aber auch, die Interessen der anderen Partei wahrzunehmen und anzuerkennen. Dies geschieht, indem offene, vertiefende Fragen nach den Motiven und Beweggründen der Parteien gestellt werden. Dabei muss der Mediator neugierig, aber respektvoll bleiben und allen Beteiligten genug Zeit und Raum für ihre Öffnung hin zur Erkenntnis und zum Verständnis geben. Dieses gegenseitige Verständnis erzeugt er am besten dadurch, dass er die Aussagen der jeweiligen Partei immer wieder sensibel zusammenfasst und nachvollziehbar für den anderen umformuliert.
82Das ist deshalb so wichtig, weil die Konfliktparteien die Meinung des oder der anderen ja vermutlich schon mehrfach gehört, aber nur unvollständig verstanden haben. Durch das geschickte Zusammenfassen und Umformulieren bringt der Mediator den Parteien die gegenseitigen Standpunkte näher und regt sie so zum Perspektivenwechsel an. Dabei muss es auch Platz für Emotionen geben, die freiwerden, wenn die Konfliktbeteiligten darüber sprechen, was sie eigentlich bewegt. Der Mediator hat aber streng auf die Trennung zwischen der Sach- und der Gefühlsebene33 zu achten. Wenn die Beziehungsebene gestört ist, und das kommt im Konflikt häufig zum Ausdruck, führt dies leicht dazu, dass eine Partei Vorschläge oder Stellungnahmen auf der Sachebene gar nicht mehr wahrnimmt, sondern sofort blockiert.
83So kann es zwischen den Parteien Missverständnisse geben, zum Beispiel wenn ein Auftraggeber sich „über den Tisch gezogen“ fühlt, weil er nicht wusste, wie der Auftragnehmer den Auftrag kalkuliert hat. Wenn dies aufgeklärt wird und das Interesse des Auftragnehmers – die für ihn auskömmliche Kalkulation – klar wird, ist oft zu spüren, wie entscheidend es ist, dass die Parteien verstehen, was für den anderen wichtig ist. Meistens entspannt sich die Atmosphäre danach deutlich, und man kann weiter daran arbeiten, wie eine Lösung dem Interesse (auch) des anderen gerecht wird. Im besten Fall findet in dieser Phase eine Annäherung der Konfliktbeteiligten statt, die bei der danach stattfindenden Lösungsphase dann sehr hilfreich ist.
84Die Technik des aktiven Zuhörens und des Zusammenfassens, auch „Loopen“ oder „Paraphrasieren“ genannt, ist einer der Wege, welche der Mediator beschreiten kann, um nicht nur diese Phase optimal zu gestalten – wir werden später noch einmal darauf zurückkommen.34
85d) Phase 4 – Lösungsfindung. Auf der Basis des gefundenen Verständnisses für das, was den Beteiligten wichtig ist kann nun die vierte Phase der Mediation beginnen: die Suche nach Optionen für die Lösung. Die Phase der kreativen Ideensuche ist noch nicht die Lösung selbst, aber ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin.
86Jetzt kann der Mediator verschiedene Kreativitätstechniken zu Hilfe nehmen, um die Parteien dazu anzuregen, über mögliche Lösungen für ihren Konflikt nachzudenken. Dabei kommt es zunächst einmal gar nicht darauf an, ob die so gefundenen Ideen umsetzbar sind oder nicht, sondern nur darauf, einen kreativen Prozess mit einer anschließenden Bestandsaufnahme in Gang zu bringen.
87Eine gängige Methode in diesem Zusammenhang ist das Brainstorming. Dazu kann der Mediator einen Zeitrahmen vorgeben, innerhalb dessen die Parteien möglichst viele Beiträge, Lösungsvorschläge und Ideen äußern, welche dann vom Mediator auf ein Flipchart geschrieben werden. Die Spielregeln sind: jeder lässt seinen Gedanken freien Lauf. Es gibt keine Kritik und keine Wertung oder Beurteilung der Ideen. Kreative Lösungsansätze können sich auch aus scheinbar unsinnigen Vorschlägen ergeben und phantasievolle Ideen können das Lösungsfeld vergrößern. Die Ideen können jeweils aufgegriffen und weiterentwickelt werden.
88Oft fällt es den Teilnehmern einer Mediation eher schwer, sich auf solche Techniken einzulassen, weil ihnen spielerisches Denken nicht zu einer Konfliktsituation zu passen scheint. Es bleibt der Einfühlsamkeit des Mediators überlassen, wie er seine Medianden dazu motiviert, oder ob er eher mit anderen Methoden versucht, Optionen für die Lösung zu sammeln. So kann man auch Fragen oder das zu lösende Problem an einer Tafel visualisieren und die Parteien dazu auffordern, ihre Ideen dazu auf Karten zu schreiben, welche dann anonymisiert besprochen werden. Diese Technik eignet sich gut für eine größere Anzahl von Teilnehmern. Es gibt aber noch eine Vielzahl von anderen Spielarten für diese Phase der Lösungsfindung.35
89An dieser Stelle des Verfahrens ist auch von den Parteien Kreativität gefragt. Rein distributives Verhandeln dreht sich um die Verteilung vorhandener Mittel und Ressourcen, ist eigentlich ein Streit um das jeweils größte Stück vom Kuchen und damit ein Nullsummenspiel, d. h. was der eine bekommt, kann der andere nicht haben. Im Gegensatz dazu ist das Prinzip integrativen Verhandelns eine Möglichkeit, den Kuchen zu vergrößern, also zusätzliche Verhandlungsmasse einzubringen und damit den Verhandlungsspielraum zu erweitern.36
Beispiel: In einer Baustreitigkeit wird dem Auftragnehmer als Kompensation für umfangreiche Nachbesserungsarbeiten, zu denen dieser sich nicht verpflichtet fühlt, die Zusammenarbeit in einem weiteren Projekt angeboten.
90Viele sogenannte win-win-Lösungen liegen außerhalb des von den Parteien zunächst vorausgesetzten Verhandlungsspielraums. Es gilt also, herauszufinden, wie der Kuchen vergrößert werden kann. Daher ist in dieser Phase das zunächst wert- und bewertungsfreie Sammeln von auch eher abgelegenen Ideen so wichtig – es kann helfen, kreative Lösungsansätze zu entwickeln, die vorher noch keiner gesehen hat.
91Im nächsten Schritt innerhalb dieser Phase werden die Vorschläge sortiert und es wird bewertet, welche Lösungen interessengerecht und damit einigungsfähig sind, und auch realisiert werden könnten. Wenn in dieser Phase neue Konfliktthemen auftauchen oder sich herausstellt, dass jemandes Interessen noch nicht ausreichend berücksichtigt wurden, empfiehlt es sich, einen Schritt zurück zu gehen und auf die Inhalte von Phase 2 oder Phase 3 zurückzukommen. Meist stellt man dann fest, woran es noch fehlt, damit ein Konsens erreicht werden kann.
92Die gefundene Lösung muss auch immer mit den in Phase 2 und 3 gefundenen Ergebnissen abgeglichen werden, das heißt, der Mediator muss darauf achten, dass wirklich alle Themenkomplexe für die Einigung abgehandelt wurden, und dass dabei die herausgearbeiteten Interessen der Parteien angemessen Berücksichtigung finden. Nur wenn das der Fall ist, kann das Ergebnis nachhaltig sein und die Vereinbarung „halten“. Dazu ist es erforderlich, dass der Mediator sich in allen Phasen der Lösungsbewertung und Einigung immer wieder das Einverständnis aller am Konflikt Beteiligten abholt. Fragen wie: „Sind Sie einverstanden damit oder fehlt Ihnen noch etwas?“ und ein genaues Hineinfühlen in die Reaktion der Medianden sind jetzt wichtig. Der Mediator muss sichergehen, dass die gefundene Lösung alle Parteien gleichermaßen zufrieden stellt.
93e) Phase 5 – Einigung und Abschlussvereinbarung. In der fünften und Abschlussphase der Mediation wird die gefundene Einigung dokumentiert und, soweit notwendig, rechtlich umgesetzt. Das Ergebnis sollte schriftlich festgehalten werden. Das heißt, die Abschlussvereinbarung wird aufgesetzt. Diese wird entweder vom Mediator als Entwurf gemeinsam mit den Parteien formuliert und gegebenenfalls von deren Anwälten überprüft, oder direkt von den Anwälten entworfen. Die Parteien entscheiden selbst über den Inhalt. Die wesentlichen Eckpunkte der Vereinbarung müssen dokumentiert, zwischen allen abgestimmt und das Dokument am Ende von allen Beteiligten unterzeichnet werden.
94Die Vereinbarung enthält Angaben zu den Konfliktbeteiligten und zum Ergebnis, ggf. auch zum Ablauf der Mediation. Soweit Fragen offen geblieben sind, sollte das auch in der Vereinbarung enthalten sein. Unter Umständen können Nachfolgetreffen vereinbart werden, wenn und soweit die Umsetzung der Vereinbarung gemeinsam überprüft werden sollte.
Beispiel: Die Parteien haben vereinbart, während eines großen Bauvorhabens regelmäßig Qualitätskontrollen und Lagebesprechungen durchzuführen, um weitere Konflikte zu vermeiden und wollen diese gemeinsam mit dem Mediator abhalten.
95Je nach Vertragsinhalt kann es auch nötig sein, tatsächliche oder rechtliche Überprüfungen durchzuführen oder eine Vereinbarung notariell beurkunden zu lassen, wenn ein gesetzlicher Formzwang besteht wie etwa bei der Übertragung eines Grundstückes.
96Nach dem Mediationsgesetz ist eine Abschlussvereinbarung, wenn und soweit kein gesetzlicher Formzwang besteht, auch formlos wirksam.37 Die Parteien könnten also theoretisch auch per Handschlag auseinander gehen. Da Konflikte im Bau- und Immobilienbereich allerdings typischerweise innerhalb vertraglicher Beziehungen stattfinden, ist es sinnvoll, sie auch so zu beenden. In baurechtlichen Auseinandersetzungen ist es daher empfehlenswert, einen rechtlich verbindlichen Vertrag zu schließen, der die Voraussetzungen eines bürgerlich-rechtlichen Vergleiches38 erfüllt – das erleichtert die folgende Umsetzung der Abschlussvereinbarung. Wenn bereits ein Rechtsstreit anhängig war, können auch prozessbezogene Absprachen enthalten sein, wie Klagerücknahme, Kostentragung oder ähnliches. Das setzt natürlich voraus, dass die Teilnehmer an der Mediation über den Streitgegenstand disponieren können, also Inhaber der Rechte und Pflichten bzw. Prozessteilnehmer sind. Innerhalb der Grenzen der Vertragsfreiheit können die Parteien rechtsverbindlich alles regeln, was sie für richtig und notwendig halten, um ihren Konflikt zu beenden.
97Die Abschlussvereinbarung sollte SMART39 formuliert sein, das heißt:
– spezifisch (wer tut was genau, wann und wie?),
– messbar (klar, nachprüfbar und handlungsorientiert),
– annehmbar (erreichbar, ohne unangemessene Bedingungen und ausgewogen),
– realistisch (alle Hindernisse für die Umsetzung müssen berücksichtigt werden),
– terminiert (Zeitspannen für die Vertragsbedingungen sollen benannt werden).
98Wenn diese Kriterien eingehalten werden, erhöht das die Chancen auf die Nachhaltigkeit und Durchführbarkeit der Vereinbarung. Wenn etwa die Elemente der Abschlussvereinbarung nicht auf ihre Realisierbarkeit überprüft worden sind, nützt sie den Parteien wenig.
Beispiel: Ein Beteiligter an der Mediation verspricht den Anbau eines Außenfahrstuhls an ein Mehrfamilienhaus, obwohl dieser genehmigt werden muss und noch gar nicht klar ist, ob eine Baugenehmigung erteilt wird.
99Ist die Abschlussvereinbarung unklar oder zu kompliziert, oder besteht ein Ungleichgewicht, so dass sich eine Partei übervorteilt fühlt, kann es gut sein, dass der Mediation kein nachhaltiger Erfolg beschieden ist. Nur eine sicher formulierte Abschlussvereinbarung sichert auch den langfristigen Erfolg der Mediation. Um diesen, wenn nötig, schnell durchsetzen zu können, empfiehlt sich unter Umständen ein Anwaltsvergleich.40