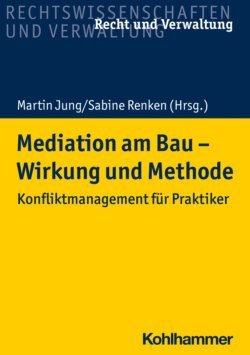Читать книгу Mediation am Bau - Wirkung und Methode - Martin Jung - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10.Techniken und Interventionsmöglichkeiten in der Mediation
Оглавление107Die Parteien in einer Mediation dahin zu führen, dass sie klar und lösungsorientiert miteinander kommunizieren, ist nicht immer einfach – nicht umsonst suchen sie dabei Rat und Hilfe. Dem Mediator steht dabei eine Vielzahl von Methoden und Interventionstechniken zur Verfügung, deren vollständige Darstellung den Rahmen dieses Ratgebers allerdings sprengen würde. Im Folgenden werden wir daher nur eine Auswahl der gängigsten Methoden vorstellen.
108a) Shuttle-Mediation und Einzelgespräche. Vor allem in den USA nutzen Wirtschaftsmediatoren häufig die Shuttle-Mediation, dort auch „caucussing“ genannt. Nach ersten gemeinsamen Gesprächen in Phase 1 und 2 ziehen die Parteien in separate Räume und der Mediator pendelt zwischen ihnen hin und her. Die Kommunikation zwischen den Parteien findet also nur noch über den Mediator statt. Der Vorteil dieser Arbeitsweise ist, dass eine Eskalation zwischen den Parteien weitgehend ausgeschlossen ist und die Hemmschwelle einer offenen Kommunikation ausgeschaltet wird. Das ist gleichzeitig auch der Nachteil dieser Technik: eine Veränderung oder Transformation der Parteien hin zu optimierter Kommunikation miteinander und damit gleichzeitig zu besseren Beziehungen zueinander findet nicht statt. Dafür lässt sich Shuttle-Mediation auch gut telefonisch durchführen und ist daher leichter zu organisieren.
Einzelgespräche können in allen Phasen der Mediation sinnvoll sein. Das gilt unter anderem dann, wenn die Parteien sich im Preisgeben von Informationen oder dem Ideenaustausch zu Lösungsoptionen zurückhaltend geben und der Mediator ihnen im separaten Gespräch besser vermitteln kann, dass sie sich vertrauensvoll öffnen können. Auch kann der Mediator damit wenig konstruktive Kommunikationsmuster zwischen den Parteien unterbrechen oder ggf. übersteigerte Erwartungen an den Ausgang des Verfahrens besprechen, ohne dass eine der Parteien bloßgestellt wird.
109Allerdings bergen Einzelgespräche auch das Risiko, dass der Mediator mehr Entscheidungsmacht über den Austausch von Informationen und damit über das gesamte Verfahren gewinnt. Das kann das empfindliche Gleichgewicht der Eigenverantwortung zwischen den Parteien stören,46 und der Mediator gerät leichter in den Verdacht der Parteilichkeit, ob nun berechtigt oder nicht. Dementsprechend ist im Mediationsgesetz auch geregelt, dass Einzelgespräche nur im Einvernehmen aller Parteien geführt werden dürfen.47
110b) Aktives Zuhören. Wenn die Konfliktbeteiligten zu Beginn der Mediation Regel nicht gut kommunizieren, muss der Mediator ihnen dabei helfen und sie anregen, einander wieder zuzuhören. Er übernimmt so die Rolle des Vermittlers im Gespräch.
111Dies geschieht durch aktives Zuhören, auch „loopen“ oder „paraphrasieren“ genannt. Der Mediator hört dem Sprechenden aufmerksam zu und gibt dann das Gehörte in seinen eigenen Worten wieder. Er formuliert es so, wie er es verstanden hat oder fasst es zusammen. Dann fragt er den, der gesprochen hat, ob er das Gesagte richtig wiedergegeben hat und wartet ab, bis dieser nickt oder dies ausdrücklich bestätigt.
Beispiel: „Habe ich das richtig verstanden, dass … haben Sie das so gemeint“?
112Das klingt einfach, kann aber durchaus anspruchsvoll sein. So kann der Mediator das Gesagte zusammenfassen, bestimmte Dinge hervorheben, mit seiner Formulierung zuspitzen oder deeskalieren, aber auch Emotionen wahrnehmbar machen.
Beispiel: „Ich habe den Eindruck, dass Sie darüber sehr verärgert sind, ist das richtig?“
Wenn der Mediator versucht, den „Sender“ der Botschaft wirklich zu verstehen, kann dieser sich bestätigt fühlen oder auch seine Sichtweise überprüfen. Anders formuliert kann seine Botschaft vielleicht erstmalig beim „Empfänger“ ankommen, ohne dass dieser sie reflexartig zurückweist. Das kann die Wahrnehmung verändern und fördert das Verständnis zwischen den Konfliktteilnehmern. Durch das Fragen, Wiederholen und Zusammenfassen findet außerdem eine Entschleunigung statt, die dem Kommunikationsprozess gut tut. Eine Betonung positiver Aussagen kann die Situation entspannen.
113c) Fragen. Eine gute Fragetechnik unterstützt die Mediation in mehrfacher Hinsicht. Durch geschicktes Fragen kann der Mediator die Verhandlungen und das Gespräch in verschiedene Richtungen lenken, z. B. in die Vergangenheit mit Fragen nach der Ursache des Konfliktes – was negative Gefühle auslösen kann – oder mit in die Zukunft gerichteten Fragen, welche die Aufmerksamkeit der Teilnehmer eines Gespräches vielleicht eher in Richtung von Lösungsansätzen führen.
Beispiel: „Was könnte jetzt helfen, den Bauablauf zu beschleunigen?“
114Eine wichtige Unterscheidung ist die zwischen geschlossenen und offenen Fragen. Geschlossene Fragen lassen nur eine Antwort (Ja/Nein) zu, danach muss das Gespräch proaktiv wieder aufgenommen werden.
Beispiel: „Gefallen Ihnen die Pläne des Architekten?“
Offene Fragen hingegen regen das Gegenüber zu einer längeren Antwort oder Stellungnahme an, aus der sich dann weitere inhaltliche Aspekte ergeben können, die den Parteien weiterhelfen.
Beispiel: „Was gefällt Ihnen/gefällt Ihnen nicht an der Planung des Architekten?“
115Wichtig für das Herausarbeiten der Interessen sind Fragen, die sich auf die innere Motivation der Parteien richten. Dazu muss der Mediator natürlich wahrnehmen können, was die Beteiligten besonders bewegt und antreibt.
Beispiel: „Warum ist es Ihnen so wichtig, dass…?“
116Weitere Fragetechniken48 zielen auf einen Perspektivwechsel, wie zirkuläre Fragen, mit denen der Fragende sein Gegenüber dazu anregt, die Sache aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
Beispiel: „Was würde Ihr Bauleiter zu dem neuen Bauzeitenplan sagen?“
117Durch Skalenfragen kann der Mediator sich schnell einen Überblick darüber verschaffen, wie die Konfliktparteien etwa die Chancen einer Einigung sehen oder die Wahrscheinlichkeit der Realisierung einer bestimmten Lösung.
Beispiel: „Auf einer Skala von 1–10, wobei 1 ganz unwahrscheinlich und 10 höchstwahr-scheinlich bedeutet: wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Ihre Mitarbeiter diese Veränderung mittragen?“
118d) Visualisierung. Nicht nur das mündliche, auch das schriftliche Darstellen oder Zusammenfassen von Gesprächsinhalten hilft, die Inhalte und Phasen der Mediation festzuhalten. Das erleichtert allen Beteiligten das Erinnern des zuvor Besprochenen und dokumentiert den Ablauf der Mediation. Auf Flipcharts, Whiteboards oder mit dem Beamer kann der Mediator Stichworte notieren, die Themenliste(n) der Parteien aufschreiben und gegenüberstellen sowie Zwischenergebnisse festhalten. Zeitleisten und Organigramme lassen sich ebenso aufzeichnen wie To-do-Listen für weitere Gespräche.
119Auch für die Parteien selbst kann es hilfreich sein, Ihre Ideen zu visualisieren, etwa in der Phase der Lösungsfindung.49 Moderationskarten eignen sich gut für das Anordnen der Reihenfolge der zu diskutierenden Themen oder als optische Hilfe beim feed-back. Manche Mediatoren arbeiten auch mit dem Zeichnen von Figuren oder Stimmungsbildern.
120e) Setting. Sowohl die Auswahl des Ortes als auch die Ausgestaltung des Mediationsraumes kann einen Einfluss auf die Stimmung der Teilnehmer und damit auf den Verlauf der Mediation haben. So ist es zum Beispiel sehr wichtig, einen neutralen Ort für die Mediation auszusuchen, um nicht einer Partei einen „Heimvorteil“ zu gewähren.
121Der Mediator kann durch die Anordnung von Pausen in der Verhandlung für die Beteiligten Raum schaffen, das bisher Geschehene „sacken zu lassen“ und bei entsprechender Bewirtung Abstand zum Geschehen zu gewinnen. Die Pausen können weiter dazu benutzt werden, dass die Parteien sich mit ihren Anwälten oder externen Beratern getrennt besprechen können.
122Auch die Terminierung der Besprechungen will überlegt sein. Manchmal ist es besser, die Termine nicht zu dicht aufeinander folgen zu lassen, z. B. wenn Sachverhalte mit Hilfe Dritter noch aufgeklärt werden müssen oder einfach, um den Konflikt zu entschleunigen.
123f) Mediation bei Planungsprozessen und mit vielen Beteiligten. Mediation wird zunehmend auch von privaten Bauträgern und der öffentlichen Verwaltung bei langwierigen Planungsprozessen eingesetzt, um die Bürger an diesen zu beteiligen. Nach § 3 des Baugesetzbuches (BauGB) hat die Öffentlichkeit Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit den Planungsinhalten und zur Äußerung von Interessen im Planverfahren. In einigen Bundesländern ist die Bürgerbeteiligung inzwischen fester Bestandteil von (auch) Planungsentscheidungen, z. B. wenn es um vorhabenbezogene Bebauungspläne geht.
124Große Projekte und Vorhaben im öffentlichen Bereich zeichnen sich durch eine Vielzahl von Beteiligten und sogenannten „stakeholdern“ (den Vertretern bestimmter, am Planungsprozess beteiligter Interessengruppen) aus, und müssen daher besonders gestaltet werden.50 Großgruppenverfahren werden sehr viel aufwändiger vorbereitet als eine Mediation mit zwei oder drei Parteien, und sie erfordern eine sorgfältigere Organisation des Verfahrens, um die beteiligten Institutionen und Gruppen in einem Arbeitsbündnis zu vereinigen.
125Dazu ist zunächst eine gründliche Konfliktanalyse notwendig, schon um festzustellen, wer an der Entscheidung eigentlich beteiligt werden muss. Dann muss eine arbeitsfähige Gruppe eingerichtet werden, mit der einer oder mehrere Mediatoren arbeiten können. Für alle Beteiligten zugängliche Websites mit für die Entscheidungsprozesse relevanten Informationen schaffen Transparenz über den Verlauf des Verfahrens, und öffentliche Anhörungen binden die interessierte Öffentlichkeit ein.
126Eine der Methoden für Mediation in großen Gruppen ist „open space“,51 eine Konferenz- und Besprechungstechnik. Hier werden die Teilnehmer eingeladen, zu dem Rahmenthema, z. B. einer Verkehrsberuhigung, ihrerseits Themen zu nennen, zu denen sie andere in einen Workshop einladen wollen. Hierzu kann alles benannt werden, was den Teilnehmern am Herzen liegt und/oder wofür sie Verantwortung übernehmen wollen. Die Vorschläge werden ausgehängt, und es finden sich Gruppen zusammen, in denen dieses (Teil-)Thema diskutiert wird. Die Gruppen sind offen und die Teilnehmer können von Gruppe zu Gruppe gehen und solange mitreden, wie sie etwas beitragen können oder wollen. Am Ende werden die Ergebnisse der Workshops in einer Dokumentation zusammengefasst, die eine Grundlage für weitere Maßnahmen sein kann. Schließlich bilden sich neue Gruppen zur Konkretisierung von weiteren Schritten für die Umsetzung der Ergebnisse.
127Auch bei größeren privaten Vorhaben wie dem Bau eines Hotels oder eines Einkaufszentrums kann sich die Notwendigkeit ergeben, eine Mediation mit mehr als 10 Beteiligten durchzuführen. Neben der gründlicheren Konfliktanalyse und Vorbereitung werden größere Runden mit einem Co-Mediator geführt, der z. B. die Visualisierung und Dokumentation übernimmt, so dass der Mediator sich ganz auf die Beteiligten konzentrieren kann. Auch kann man kleinere Gruppen bilden – immer im besprochenen Einverständnis aller Teilnehmer – um bestimmte Themenkomplexe dort abzuarbeiten.