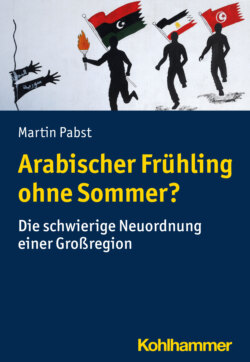Читать книгу Arabischer Frühling ohne Sommer? - Martin Pabst - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3 Das Umbruchjahr 1979
ОглавлениеEin Schlüsseljahr für alle weiteren Entwicklungen war 1979, nach islamischer Zeitrechnung das symbolhafte Jahr 1400.17 Am islamischen Neujahrstag stürmten wahabitische Extremisten die Große Moschee in Mekka. Der Wahabismus ist eine vor allem in Saudi-Arabien praktizierte, fundamentalistisch-puristische Form des sunnitischen Islam, die der apokalyptische Führer der Moscheebesetzer, Dschuhaiman al-Utaibi, noch radikalisierte (siehe S. 22 f.). Angesichts des angeblich bevorstehenden Jüngsten Gerichts rief er zum Sturz der »korrupten« Dynastie al-Saud und der Errichtung eines endzeitlichen Gottesstaates auf. Erst nach zweiwöchigen Kämpfen und 1 000 Toten konnten die Extremisten in der heiligsten Moschee des Islam niedergekämpft werden. Doch lebten ihre Ideen bei von Saudi-Arabien unterstützten arabischen Freiwilligen im bald ausbrechenden Afghanistan-Krieg weiter und mündeten schließlich in den Dschihadismus von al-Kaida und vom Islamischen Staat (IS).
Im selben Jahr 1979 stürzte Ajatollah Ruhollah Chomeini im Iran die Monarchie und etablierte eine von Geistlichen kontrollierte »Islamische Republik Iran« als Gegenmodell sowohl zum westlichen Kapitalismus als auch zum östlichen Kommunismus. Chomeini sah die vom Versprechen sozialer Gerechtigkeit begleitete Islamische Revolution im Iran nicht als nationale bzw. innerschiitische Entwicklung, sondern auch als emanzipatorisches Modell für die gesamte islamische Welt, ja sogar für den gesamten globalen Süden. Entsprechend intensivierte die Islamische Republik Iran ihre revolutionären Anstrengungen zum Aufbau verwandter Bewegungen und der Gewinnung von Partnern im sunnitischen wie im schiitischen Lager.
Auch eine dritte islamistische Strömung hatte nach 1979 Aufwind: die sunnitische Muslimbruderschaft. Vom ägyptischen Lehrer Hasan al-Banna 1928 als Reaktion auf die koloniale Fremdherrschaft, die jüdische Einwanderung in Palästina und die Abschaffung des Kalifats gegründet, bekämpfte die Geheimorganisation den europäischen Imperialismus. Über Mission (dawaa) und Erziehung (tarbiah) versuchte sie, alle Institutionen zu durchdringen.
Die Muslimbrüder versprachen Stärke durch die Errichtung eines übernationalen Gemeinwesens auf islamischer Grundlage. Um dieses Ziel zu erreichen, etablierten sie ein hierarchisch strukturiertes, logenartiges und nach außen abgeschirmtes System. Geeignete Neulinge werden individuell angeworben und in »Familien« mit den politischen Ideen der Bewegung vertraut gemacht und sozialisiert. Bei Bewährung können sie in höhere Grade aufstiegen. Die Erziehung zum höchsten Grad des aktiven »Bruders« (akhmal) dauert fünf bis acht Jahre. Über den »Familien« stehen Zweige, Gebiete, Gouvernorate, das Allgemeine Schura-Komitee und an der Spitze das Führungsbüro (maktab al-irschad) sowie der Oberste Führer (murschid al-amm), denen mit einem Eid absoluter Gehorsam zu leisten ist. Zum Schutz der Organisation kennen die jeweiligen Zellen nur ihre jeweils vorgesetzten Führer. Auf allen Ebenen werden geeigneten Muslimbrüdern bestimmte Fachressorts übertragen. Sie sind auch aufgefordert, sich für Führungspositionen in Gewerkschaften, Berufsverbänden, an Schulen und Universitäten zu bewerben.18
Über das Internationales Büro in Kairo wurden ab 1936 verwandte Bruderschaften in anderen arabischen Staaten gegründet. Im Jahr 1954 wurde die Muslimbruderschaft in Ägypten verboten, hielt jedoch Strukturen im Untergrund aufrecht. Weitere arabische Staaten, wie z. B. Libyen und Syrien, erließen ebenfalls Verbote, doch in einigen Ländern, wie z. B. Jordanien und Kuwait, konnten die Muslimbrüder weiterhin legal auftreten.
Die desaströse Niederlage säkularer arabischer Staaten 1967 gegen Israel, ihre Zerstrittenheit und ihre ökonomische Misere führten zum schleichenden Niedergang des arabischen Nationalismus und Sozialismus. Viele Araber wandten sich enttäuscht dem politischen Islam (Islamismus) zu, der ihnen politische Macht, ökonomischen Aufschwung, soziale Gerechtigkeit und überstaatliche Einheit auf islamischer Grundlage versprach. So nahmen die in Ägypten seit Mitte der 1970er-Jahre wieder tolerierten Muslimbrüder mit wachsendem Erfolg als »Unabhängige« an den Parlamentswahlen teil.
Die Muslimbrüder sind davon überzeugt, dass ihr Staats- und Gesellschaftsmodell gottgewollt und allen anderen Modellen überlegen ist, sodass es zu einem bestimmten Zeitpunkt gewissermaßen mit geschichtlich-religiöser Notwendigkeit umgesetzt werden wird. Doch kamen immer wieder Stimmen auf, die die geschichtliche Entwicklung durch Gewalteinsatz zu beschleunigen versuchten. Die ägyptische Muslimbruderschaft hatte für den antikolonialen Kampf einen bewaffneten Flügel gegründet. Ihr Verhältnis zum Gewalteinsatz war ambivalent. Der unter Präsident Abdel Nasser hingerichtete Vordenker der Muslimbrüder, Sajid Kutb (1906–1966), hatte die muslimischen Gesellschaften und Staaten als vom Islam abgefallen erklärt und zum dschihad einer kleinen Avantgarde gegen die in dschahilija (Unwissenheit) verfangenen arabischen Herrscher wie auch zum Kampf gegen den dekadenten Westen aufgerufen. Anfang der 1970er-Jahre lösten die ägyptischen Muslimbrüder den bewaffneten »Sonderapparat« offiziell auf und entsagten der Gewalt. Doch blieben Schriften Kutbs in ihren »Familien« Pflichtlektüre.19
Kutbs Denken beeinflusste den radikalen Flügel der syrischen Muslimbrüder, die von 1976 bis 1982 einen schließlich brutal niedergeschlagenen Aufstand gegen die Regierung von Präsident Hafes al-Assad wagten. Der palästinensisch-jordanische Muslimbruder und Rechtsgelehrte Abdallah Assam zog 1984 nach Peschawar (Pakistan), um dort zusammen mit seinem Schüler Osama bin Laden ein »Büro für Mudschahedin-Dienste« in Afghanistan aufzubauen. Assam forderte von jedem Gläubigen eine »individuelle Verpflichtung« zum dschihad ein. 1988 rief er zur Bildung einer al-kaida as-sulba (soliden Basis) erprobter und ideologisch gefestigter Kämpfer auf. Osama bin Laden, der in den 1970er-Jahren bis zu seinem Ausschluß wegen Ungehorsams Muslimbruder gewesen war, setzte dies nach der ein Jahr später erfolgten Ermordung Assams um. Seine Anhänger sahen sich nach dem Rückzug der Roten Armee (1989) als gottgewollte Sieger und Vollender einer islamischen Weltrevolution. Auch der Theoretiker des »Dschihads der Dritten Generation«, Mustafa Netmariam Nasar alias Abu Mussab al-Suri, begann seine politische Karriere in Syrien bei den Muslimbrüdern. Prägend wurde dann allerdings salafistisches Gedankengut.20
Ab den 1970er-Jahren traten zunehmend nichtstaatliche Akteure in Erscheinung. So wurde 1973 letztmals ein konventioneller, zwischenstaatlicher Nahostkrieg zwischen Israel und arabischen Staaten geführt, danach kam es dort immer wieder zu bewaffneten Konflikten Israels mit zivilen Aktivisten, Befreiungsbewegungen oder Terrorgruppen. Kampfmittel wie Sabotage, Geiselnahmen und terroristische Anschläge wurden nun immer häufiger eingesetzt – zunächst von säkular-nationalistischen und säkular-sozialistischen Bewegungen, später auch von militanten islamistischen und dschihadistischen Gruppierungen.
Neu war auch, dass nun Ressentiments gegen ethnische bzw. religiöse Gruppen gezielt angefacht wurden, um Anhänger zu mobilisieren und identitätsstiftende Feindbilder zu schaffen. Erstmals war dies im libanesischen Bürgerkrieg (1975–1990) zu beobachten. Der Libanon war auch ein Vorreiter des Zusammenbruchs von Staatlichkeit, wie heute im Irak, Jemen, Libyen oder Syrien zu beobachten.
Das saudische Königshaus sah sich durch die Ereignisse von 1979 in dreifacher Weise bedroht – von saudisch-wahabitischen Extremisten, vom iranischen Chomeinismus und von den im Aufwind befindlichen Muslimbrüdern. Fortan förderte Riad mit seinen Ölmilliarden die wahabitische Weltmission, um im eigenen Land sowie international an Legitimität zu gewinnen. Der französische Soziologe und Arabist Gilles Kepel spricht von einem islamistischen »Überbietungswettbewerb« zwischen Saudi-Arabien, dem Iran und der Muslimbruderschaft.21
Moderate Islamisten nehmen am parteipolitischen Wettbewerb teil und greifen nicht zu Gewalt. Radikale Islamisten kämpfen mit begrenztem Einsatz von Gewalt in einem bestimmten Land für ein bestimmtes Ziel, wie z. B. für den Ersatz einer ungerechten Regierung durch eine islamisch geprägte Ordnung oder für die Befreiung Palästinas. Davon zu unterscheiden sind global agierende »Dschihadisten«, die nicht mehr lokal verortet sind, sich in einer apokalyptischen Entscheidungsschlacht zwischen dem christlichen Westen und der islamischen Welt sehen, zu unbegrenzter Gewalt greifen und auf eine islamistische Weltrevolution hinarbeiten. Ihre Ideologie ist ein radikalisierter Salafismus/Wahabismus.22
Der Wahabismus ist eine ultrakonservative Richtung des Islam. Er fußt auf der konservativen Rechtsschule der Hanbaliten.23 Entwickelt wurde er von dem Theologen Muhammad ibn Abd al-Wahab (ca. 1703–1792) aus Nedschd, einer Region im Innern der arabischen Halbinsel. Im Vordergrund steht bei ihm das aktive Bekenntnis zur absoluten Einheit Gottes (tauhid). Alle Abweichungen davon sind tabu. Der Wahabismus fordert nicht nur Orthodoxie, sondern auch Orthopraxie. Es genüge nicht, sich als Muslim zu bekennen, sondern tägliches, sichtbares Erfüllen der religiösen Pflichten sei notwendig. Ein islamisches Gemeinwesen müsse mithilfe strikter Vorgaben und harter Strafen gewährleisten, dass die Menschen nicht von diesem Pfad abweichen.
Jegliche Überhöhung des Menschen ist gemäß Abd al-Wahab strikt verboten, weswegen z. B. Geburtstagsfeiern und Grabdenkmäler abgelehnt werden. Nicht nur Heiden, sondern auch Juden, Christen, Schiiten und sogar sich abweichend verhaltende Sunniten erachtet Abd al-Wahab als Ungläubige bzw. vom Glauben Abgefallene. Der rechtgläubige Muslim habe den Kontakt mit ihnen zu meiden und sie zu bekämpfen. In der Urgemeinde von Medina erkennt er die ideale politische und soziale Ordnung. Das islamische Recht müsse auf wörtliche Auslegung von Koran und Sunna fußen. Auf die Tradition der Gelehrten wird nicht rekurriert. Die Altvorderen (salaf) seien die Vorbilder, die Zeit Muhammads und seiner ersten vier Nachfolger sei die strikt nachzuahmende »Goldene Zeit« des Islam.
Abd al-Wahab schloss 1744 mit Emir Muhammad ibn Saud einen Pakt mit wechselseitigem Treueid. Er erkannte die Herrschaft der Familie Saud an, während sich Muhammad ibn al-Saud verpflichtete, Wahabs religiöse Botschaft in seinem Machtbereich durchzusetzen. Dieser Pakt gilt bis heute im 1932 zum Königreich erhobenen Staat Saudi-Arabien. Auch im Emirat Katar ist der Wahabismus Staatsreligion. Er wird aber nicht so rigide wie in Saudi-Arabien durchgesetzt.
Ähnliche Ideen wie der Wahabismus vertritt die islamische Bewegung der Salafisten – in ihrem Namen steckt die Rückbesinnung auf Religionsverständnis und Religionspraxis der Altvorderen (salaf). Zunächst war die salafija eine Reformbewegung im 19. Jahrhundert, die den übermächtigen Einfluss der Tradition bekämpfte und dem Gläubigen wieder einen direkten Zugang zu Gott eröffnen und ihn von Aberglauben und Übertreibungen befreien wollte. Die durchaus vernunftorientierte salafija des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ist heute allerdings überwiegend von einem dogmatischen, rückwärtsgewandten Salafismus verdrängt worden. Anders als beim staatsgeleiteten Wahabismus gibt es in der salafija viele Strömungen.24
Radikalislamistische und dschihadistische Terrorbewegungen wie al-Kaida und der IS berufen sich auf salafistisches bzw. wahabitisches Gedankengut. Doch ist im Gegenzug nicht jeder Salafist militant oder dschihadistisch orientiert. Das dogmatische Weltbild ist jedoch mit demokratischen Vorstellungen kaum vereinbar und kann als Ausgangspunkt für eine spätere Radikalisierung dienen. Al-Kaida wurde zur ersten weltweit agierenden dschihadistischen Organisation. Der »korrupten« Dynastie al-Saud erklärte sie den Krieg. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und vermehrten al-Kaida-Attacken in Saudi-Arabien bekämpfte das Königreich die Terrorbewegung in seinem Land und initiierte Deradikalisierungsprogramme. Doch fern der eigenen Grenzen nahm man es auch danach mit den Partnern nicht so genau, solange sie den eigenen außenpolitischen Zielen dienten. Das ebenfalls wahabitische Emirat Katar praktizierte noch viel länger eine riskante Außenpolitik und pflegte enge Beziehungen nicht nur zu den Muslimbrüdern, sondern auch zu Gruppierungen, die al-Kaida nahestanden. Darüber hinaus kamen erhebliche Finanzmittel für Dschihadisten auch von reichen Privatspendern und religiösen Stiftungen zahlreicher Länder.
Saudi-Arabien schürte ab den 1980er-Jahren konfessionelle Ressentiments gegen Schiiten, um den wachsenden geostrategischen und ideologischen Einfluss der Islamischen Republik Iran einzudämmen. Der saudisch-iranische Machtkampf eskalierte, als der Irak, die dritte Regionalmacht am Persischen Golf, ab 2003 durch die US-Militärintervention destabilisiert wurde und als eigenständiger Akteur ausschied. Der von konfessionellen und ethnischen Ressentiments aufgeladene Machtkampf zwischen Saudi-Arabien und dem Iran spaltete nicht nur Gesellschaften, sondern auch die arabische Staatenwelt, er ließ sogar den lange dominierenden israelisch-palästinensischen Konflikt in den Hintergrund treten. Saudi-Arabien verbündete sich vielerorts mit radikalen sunnitischen Gruppierungen, solange sie nur antischiitisch und antiiranisch waren.25
Auch in den USA gab es Befürworter dieser Strategie. Eine vom US-Militär finanzierte Studie der RAND Corporation identifizierte 2008 eine vereinigte und radikal antiwestliche islamische Welt als zentrale Bedrohung für die USA. Als Gegenstrategien wurden u. a. verschiedene Optionen einer »Teile und herrsche«-Politik entwickelt. So wurde zur Diskussion gestellt, entweder den sunnitisch-schiitischen Gegensatz grundsätzlich anzufachen oder die antischiitische Politik Saudi-Arabiens aktiv zu unterstützen. Letztere Option hätte den doppelten Vorteil, dass einerseits Druck auf den Iran ausgeübt würde und zugleich die Energien von al-Kaida statt auf die USA auf den neuen Hauptfeind Iran gelenkt würden.26