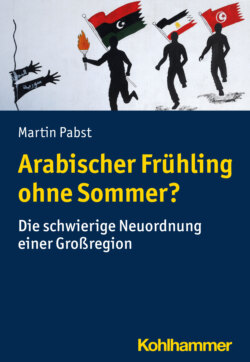Читать книгу Arabischer Frühling ohne Sommer? - Martin Pabst - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.5 Reformaktivisten, Trittbrettfahrer und Gegner
ОглавлениеDie Initiatoren der Proteste waren vorwiegend gebildete, im Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln erfahrene Abiturienten bzw. junge Akademiker. Die dezentrale Mobilisierung und Führung der Demonstrationen über Mobiltelefon waren ein wesentlicher Teil ihres anfänglichen Erfolges. Vielerorts gelang es den Initiatoren, auch frustrierte Angehörige der Mittelschicht sowie unzufriedene Arbeiter und die Unterschichten zu mobilisieren. Beispielsweise begannen sie Proteste am Stadtrand und zogen dann gezielt durch arme Viertel. Damit wurde eine kritische Masse erzeugt, die hinreichenden Druck auf die Regierungen ausübte und Veränderungen erzwingen konnte.28
Eine starke Beteiligung von Frauen war erkennbar. In den UNDP-Berichten über die Menschliche Entwicklung im arabischen Raum wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die hinter den Möglichkeiten zurückfallenden Fortschritte auch der zu geringen Nutzung des Potenzials der arabischen Frauen geschuldet waren. Nun nutzten Frauen die Gelegenheit, sich zusammen mit Männern nicht nur für politische Veränderungen einzusetzen, sondern auch größere politische und gesellschaftliche Freiräume für die weibliche Bevölkerung einzufordern.29
Abb. 2: In der »Tahrir Lounge« im Goethe-Institut Kairo tauschten sich 2011/12 unter dem Motto »Positiv zum Wandel beitragen« zivilgesellschaftliche Vertreter aller Richtungen bei Diskussionen, Veranstaltungen und Workshops aus.
Die zunächst zögerliche Muslimbruderschaft sprang schon bald auf den Zug der Veränderung auf und versuchte, ihre gesellschaftliche Popularität und ihre gut ausgebauten organisatorischen Strukturen bei Wahlen umzumünzen. Insbesondere jüngere Muslimbrüder sympathisierten mit den Zielen der Protestbewegung und hatten an Demonstrationen teilgenommen.
Dschihadisten wie al-Kaida wurden zunächst von den Entwicklungen überrascht und an den Rand gedrängt. Doch als mancherorts die Proteste zu bewaffneten Konflikten mit den Machthabern eskalierten bzw. verstärkte Repression die Überhand gewann, nutzten die Dschihadisten ihre Chance. In Libyen, Syrien oder im Jemen nisteten sie sich in Gebieten ein, aus denen sich die Staatsmacht zurückgezogen hatte, und sie inszenierten sich als die entschiedensten Kämpfer für eine gerechte Ordnung.
Der französische Islamwissenschaftler Gilles Kepel unterscheidet drei Generationen des Dschihadismus: Die erste Generation bestand aus Afghanistan-Heimkehrern, die vergeblich danach strebten, in ihren Heimatländern wie Ägypten und Algerien die »ungläubigen« Regime zu stürzen. Die zweite Generation bildete al-Kaida mit dem neuen strategischen Ziel, den »fernen Feind« USA zum Kampf herauszufordern und zu besiegen. Doch habe man hierfür weder Ressourcen noch Anhänger in genügendem Maß mobilisieren können. Mustafa Netmariam Nasar alias Abu Mussab al-Suri habe mit seinem Manifest Aufruf zum weltweiten islamischen Widerstand (2005) den Dschihadismus der dritten Generation formuliert: einen führerlosen, netzwerkartigen Dschihad von unten mit extremer Brutalität gegen den »nahen Feind«, ergänzt durch individuell ausgeübte Attentate in Europa von dort lebenden Muslimen. Über Gewaltaufrufe und Siegesmeldungen in sozialen Medien sollten die Muslime weltweit mobilisiert und radikalisiert werden.30
Als der »Arabische Frühling« begann, entstand gerade der »Islamische Staat« (IS) als Verkörperung jenes »Dschihadismus der Dritten Generation«. Neu war auch sein Konzept, in »befreiten Gebieten« sukzessive ein »Kalifat« zu errichten. Dies war das radikalste Gegenmodell sowohl zur autoritären Despotie als auch zur westlich-liberalen Demokratie. Seinen Unterstützern versprach der IS das Kalifat nicht als fernen Endzustand wie al-Kaida, sondern er setzte es mit sofortiger Wirkung um. Dies trieb dem IS abenteuerlustige, gewaltbereite und hoffnungsvolle Unterstützer aus aller Welt zu. Ab 2013 dominierte er die Medien mit seinen erstaunlichen militärischen Erfolgen vor Ort und seinen terroristischen Attentaten in Europa.31
Al-Kaida und der IS erhielten nicht nur von Staaten, sondern auch von reichen Personen und religiösen Stiftungen Unterstützung. Auf Internetseiten konnten Zuwendungen mittels eines Klicks erfolgen, beispielsweise wurden »Patenschaften« für bestimmte Waffen angeboten. Mitunter war der Kampfbeitrag auch als humanitäre Hilfsleistung getarnt. Die dschihadistischen Organisationen machten sich die laxe Kontrolle von Finanzströmen in bestimmten Staaten zunutze. Insbesondere Kuwait spielte eine unrühmliche Rolle. So brachte die »Kuwait Scholars’ Union« Millionen Dollar zusammen, um Luftabwehrraketen, rateketengetriebene Granaten und Kämpfer für al-Kaidas syrischen Alliierten Dschabat al-Nusra (Front der Unterstützer) zu finanzieren. KSU-Präsident Nabil al-Awadi verkündete im Juni 2013 stolz in Bezug auf Syrien, dass man bereits 8 700 Mudschahedin für den Einsatz vorbereitet habe.32 Nach massivem Druck der USA erließ das Emirat 2017 strengere Regelungen der Finanzströme, designierte Individuen und Organisationen als »terroristisch« und startete Deradikalisierungsprogramme.
Abb. 3: Das Militär hat in den arabischen Staaten eine einflussreiche Stellung, hier Offiziere bei einer Huldigung an den König in Marokko, Oktober 2008.
Im Laufe der Protestbewegung 2011 kristallisierten sich fünf zentrale interne Akteure des Umbruchprozesses heraus:
1. das Reformlager,
2. der zwischen Reform und Reaktion stehende moderate politische Islam,
3. die militanten Islamisten und Dschihadisten,
4. die alten Eliten sowie
5. die Sicherheitskräfte.
In der Auseinandersetzung zwischen diesen Akteuren wurde um eine neue Ordnung gestritten. Auch mischten sich angesichts der Schwäche der Staaten externe Akteure in den Umbruchprozess ein, um ihre Interessen durchzusetzen und ihren Einfluss zu mehren.