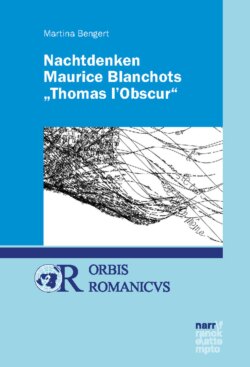Читать книгу Nachtdenken - Martina Bengert - Страница 32
Оглавление2.3 Krypta (Phantasma und Verschiebung)
In Cryptonymie. Le verbier de l’homme aux loups1, unternehmen die Psychoanalytiker Nicolas Abraham und Maria Torok eine Neulektüre der berühmten „Wolfsmann-Texte“2 Sigmund Freuds. Eine Besonderheit dieser Neulektüre ist die Beschreibung der Ausbildung einer intrapsychischen Krypta als Resultat eines gescheiterten Trauerprozesses. Dabei werden die mit Lust und Scham besetzten Objekte (meistens sind es mehrere) phantasmatisch inkorporiert und in einer inneren Krypta verwahrt. Die geschluckten Objekte (frz. fantasmes) sind dem Bewussten unzugänglich, steuern es vielmehr in Wiederholungshandlungen fern und bedienen sich so des Subjektes. Diese Fernsteuerung ist der negative Aspekt der Krypta. Ausgebildet wird sie aber ursächlich, um die Subjektstabilität zu erhalten.
Die Krypta bildet einen Ort im Bewussten, der sich wie ein künstliches Unbewusstes zum Bewusstsein verhält. Künstlich ist dieses Unbewusste insofern als es nicht außerhalb des Bewussten liegt, sondern innerhalb und gleichzeitig dem Bewussten, dem Außerkryptischen unbewusst ist. Von außen gibt es kein Eindringen in die Krypta, es sei denn, man vermag es, über verschlüsselte Pfade die Wege der nach außen dringenden kryptophoren Objekte nachzuverfolgen. Abraham und Torok gehen davon aus, dass es immer wieder Risse an den Grenzzonen der Krypta gibt, durch die die eingeschlossenen Phantome nach außen dringen und sich in Handlungen des Subjektes niederschlagen, die diesem im Nachhinein teilweise völlig fremd sind. Die Doppelbödigkeit der Krypta besteht darin, dass die inkorporierten phantasmatischen Objekte den Grund des Ichs begründen, d.h. Teil des Ich-Fundaments sind, auf dem Neues errichtet wird. Das Gefährliche dieses Grundes ist seine Eigendynamik, denn das vermeintlich Besiegte (das Objekt, dem die Trauer ob seines Verlustes verweigert wurde) muss verwahrt werden, um so zwischen Leben und Tod, zwischen Realität und Latenz, in der Schwebe zu bleiben: unverfügbar, aber da.
Um die Krypta als raum-zeitliches Gefüge in Hinblick auf die Tiefenerfahrung von Thomas im 2. Kapitel von TO2 zu beschreiben, muss die Vorstellung der Krypta jedoch von der rein psychoanalytischen gelöst und in Richtung auf das hin gedacht werden, was Derrida in seinem, der Cryptonymie vorangestellten, Vorwort „Fors“3 beschreibt. Er geht darin gewissermaßen tiefer in die Topik der Krypta hinein und legt Verbindungen zu ihrem Ort-Sein zwischen Natur und Fremdkörper frei, indem er sie als verräumlichte différance liest und ihren metaphorischen Ausdruck zurückbezieht auf die eigentliche architektonische Herkunft als eine unter dem Altar befindliche Grab- oder Reliquienkammer, die aus einem System von Druck und Gegendruck besteht und daraus ihre ganz eigene Stabilität entfaltet. Auch das Moment der Gewalt als ein konstitutives Gründungsmoment ist in der Krypta somit vorhanden, nämlich als stumme Gewalt des Gegendrucks des Verbergens.
Die Wand der Höhle, die Wand der Krypta
Platons Höhle verfügt über zwei Wände, eine natürliche Höhlenwand und eine künstliche Trennwand. Hinter der künstlichen werden Gegenstände vorbei getragen, von denen die Eingeschlossenen lediglich die Schattenwürfe auf der ihnen sichtbaren natürlichen Höhlenwand erblicken können. Ihr Wirklichkeitsbezug besteht in der Auslegung der Schattenzeichen auf der Wand. In der Krypta, wie Derrida sie liest, gibt es ein Verbergungssystem von unterschiedlichsten Trennwänden, Mauern und Abschirmungen, wodurch das Ich zu einem zersprungenen Symbol wird:
La place-forte cryptique protège ce rebelle en provoquant la fracture symbolique. Elle brise le symbole en fragments anguleux, aménage des cloisons internes (intrasymboliques), des cavités, des enfoncements, des couloirs, des chicanes, des meurtrières, des fortifications escarpées. Toujours des ‚anfractuosités‘ puisqu’elles sont l’effet de cassures : telles sont les ‚parois de la crypte‘. Dès lors la muraille à traverser ne sera pas seulement celle de l’Inconscient […] mais la paroi anguleuse à l’intérieur du Moi.1
Das Ich, nicht mehr Herr im Haus, vermag die Innenseiten der Kryptawände nicht zu sehen und folglich genauso wenig zu deuten. Sie bleiben dem Ich verborgen und werden nicht Teil der Semiose. Die Krypta wird errichtet, kann jedoch nicht betreten werden. Das Wesentliche der Krypta ist dieser komplizierte Verbergungsmechanismus, an und in dem eine eindeutige Verortung scheitert, bei dem aber gleichzeitig strikte Trennwände existieren.
Die Krypta als Anti-Metapher
Zum Schutze der in der Krypta eingeschlossenen Objekte, welche sich ihrerseits um ein Ur-Wort oder Tabu-Wort1 herum lagern, müssen alle Verbindungen gekappt werden – nicht nur die der Erinnerung, sondern auch metaphorische Bezüge, durch die ein Eindringen in die Krypta möglich wäre. Wie schon erwähnt, drängt es aber die Kryptaobjekte immer wieder an die Oberfläche. Dieses kryptische Sprechen bezeichnen Abraham und Torok als eine „Figur der aktiven Zerstörung der Bildhaftigkeit“ und schlagen vor, es als „Antimetapher“ zu lesen.2 Sie unterstreichen dabei, dass das Ziel des kryptischen Sprechens nicht sei, mit dem Literalsinn der Worte zu agieren, sondern auf jeder Ebene ihre verbindende, übertragende Kraft zu zersetzen. Die Krypta als Figur des Bruches mit jedem referentiellen Grund der Eigentlichkeit und der radikalen Verschiebung wäre in dieser Lesart, die auch Derrida in seinem Vorwort in Teilen verfolgt, der Ungrund des Verstehens, auf Basis dessen jede Deutung ins Wanken gerät. Dieses Wanken erfasst auch die Handlungskontrolle des Kryptophoren (Träger der Krypta), denn die Krypta erfüllt ihre Funktion der Erhaltung der Subjektstabilität nur scheinbar: Die eingeschlossenen Wörter dringen unkontrollierbar aus ihrem Ungrund nach oben und walten nach ihrer eigenen Ordnung, der das Ich hilflos gegenüber steht. Die ursprüngliche Schutzfunktion der hermetischen Abriegelung einer übergroßen Trauer wird über kurz oder lang zur Gefahr für das Subjekt, dessen Wesenskern von fremden Gestalten besetzt ist. Das Besondere liegt darin, dass diese Ketten des Krypta-Sprechens nicht mehr lediglich auf semantischen Verknüpfungen beruhen, sondern sich andere, verstecktere Kontakte der sprachlichen Fortpflanzung suchen, um das Ur-Wort der Krypta zu verdecken. Die Assoziationen, aufgrund derer Kontiguitätsketten gebildet werden, speisen sich also aus einer lexikologischen Quelle, die von der Ebene der Sache sowie des Wortes zu unterscheiden ist. Sie sind unberechenbarer und beweglicher als übliche Assoziationen, da sie quer durch die Ordnungsstrukturen der Sprache schießen (man könnte auch mit Gilles Deleuze sagen: Transversalen bilden). Eine von den Autoren dabei vielfältig am Wolfsmann diagnostizierte Struktur ist das Verfahren, ein Wort durch ein Synonym bzw. Rebus eines Allosems3 zu ersetzen.
Bei dieser „kryptonymischen Transkription“4 handelt es sich folglich nicht mehr um einfache Ersetzungsvorgänge, sondern um „Verschiebungen zweiten Grades“5, d.h. eine stark erweiterte assoziative Anschlussfähigkeit auf der phonetischen Ebene. Derrida formuliert dies im Bild eines „befremdlichen Staffellaufs“6, bei dem der Stab nicht an eindeutig vorhersehbare und zurück verfolgbare Anschlusspartner übergeben wird und somit die Regeln des Spiels nicht klar erkennbar sind. Die Objekte der Krypta zeigen sich, sie tun dies jedoch verschlüsselt. Ihnen auf die Schliche zu kommen hieße, mit dem Sichtbaren (dem Diskursiven) anzufangen, um zum Unsichtbaren zu gelangen (dem Ur-Wort, dem Ur-Trauma).