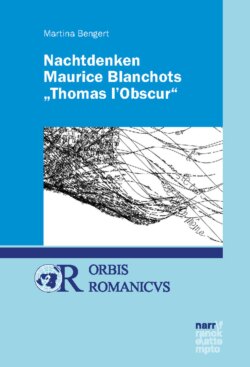Читать книгу Nachtdenken - Martina Bengert - Страница 37
Der Wald in den Händen
ОглавлениеÜber das Problem des Hypothetischen und des Imaginären hinaus wird anhand des Waldes in der Pupille bis zum Ende des Kapitels die Unerbittlichkeit von Repräsentation wortwörtlich mit Händen greifbar. Noch immer unter der Prämisse des Nacht-Sehens, also eines Sehens, bei dem zwischen Körperwahrnehmung und Blick nicht zu unterscheiden ist, greifen die Hände den Wald wieder auf: „Il n’avait d’attention que pour ses mains, occupées à reconnaître les êtres mêlés à lui dont elles discernaient partiellement le caractère, chien représenté par une oreille, oiseau remplaçant l’arbre sur lequel il chantait.“1 Indem der Wald einerseits nur noch durch ‚Hund‘, ‚Vogel‘ und ‚Baum‘ vertreten ist, andererseits diese Vertreter sich wiederum vertreten, nimmt der Prozess der Repräsentation abermals seinen Ausgang. Synekdochisch ‚repräsentiert‘ das Ohr einen (aufgrund des fehlenden Artikels) generischen Hund, metonymisch ersetzt ein wiederum generischer Vogel den „arbre sur lequel il chantait“.2 Neben der metonymischen Verschiebung kommt es zudem zu einer Verdichtung, die das Ohr des Hundes mit dem Gesang des Vogels überblendet – all dies innerhalb einer hochkomplexen chiastischen Struktur. Auf diesen Repräsentationen gründend, genauer noch auf der kreativen Prozessualität des Ersetzungsvorgangs selbst, setzt hier eine Imagination ein, deren abgründige Realität betont wird. So werden „villes entières“ konstruiert, die „villes réelles faites de vide“ sind. Der derart erschaffene Raum ersetzt Konzepte der (philosophiegeschichtlichen) Vergangenheit.
Die Violenz des Repräsentationsvorgangs zeigt sich zunächst im Repräsentierten der „créatures roulant dans le sang et parfois déchirant les artères“.3 Im darauf folgenden Übergang von der Angst zur Leiche wird sie jedoch im repräsentationslogischen Verhältnis von Angst, Leiche und Begehren auch als Ersetzungsvorgang an sich sichtbar. Angst und Begehren inkorporieren sich beide in der Leiche, die somit zur toten Personifikation wird. In einer schwerfälligen Aufstiegsbewegung bewegt sich die gestorbene Lust an die Grenze des Außen, um im Mund gleichsam als Laut oder Sprache zu erscheinen.4 Von dort aus frisst sie sich in den Körper und sorgt letztlich für die Auslöschung der ganzen Imaginationsszene. Die Inkorporierung der Angst und des Begehrens erscheint dabei als bedrückende Belagerung des Körpers, bevor diese Körperlichkeit zurückgeführt wird auf die Wunde des Nacht-Gedankens. Denn es ist nun „sa pensée, confondue avec la nuit“,5 die Thomas heimsucht und von außen versucht, sich in den Körper zu inkorporieren und eine „union monstrueuse“ herzustellen. Anzumerken sei, dass sich diese monströse Vereinigung auch sprachlich im Personalpronomen „elle“ zeigt, bei dem unentscheidbar ist, ob es „la nuit“, „la pensée“ oder eben beides bezeichnet. Diese Figur einer kryptischen Selbstfundierung bewirkt unter den Augenlidern einen „regard nécessaire“, welcher im Kuss zur furiosen Auslöschung des „visage“ führt.6 Visage kann zweierlei meinen in diesem Kontext: zum einen Thomas’ Gesicht, dessen Oberflächen grotesk geöffnet werden, zum anderen aber das Gesicht (das Gesehene) der Imagination. Die Szenerie wird abgeräumt und entleert. Von der Krypta bleiben am Ende des Kapitels nur mehr die Spur (des Textes), ein paar versetzte Bäume und Thomas’ sinnloser, gedankenvoller Körper.