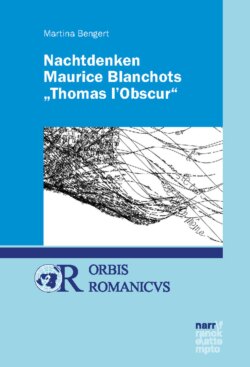Читать книгу Nachtdenken - Martina Bengert - Страница 38
3. Licht-Blick – Berührung des Anderen
ОглавлениеDas 3. Kapitel meiner Untersuchung steht im Zeichen des Blicks und der Wahrnehmung. Es enthält ein separates Unterkapitel zur Wahrnehmungstheorie Maurice Merleau-Pontys, auf dessen Trennung von Auge und Blick auch andere Kapitel immer wieder Bezug nehmen werden. Zudem liegt mein Augenmerk auf der Frage der taktilen Wahrnehmung, die Blanchot mit Merleau-Ponty dem Sehen annähert, sofern dem Blick – wenngleich auf Entfernung – ein taktiles Abtasten des erblickten Objektes zugeschrieben wird.
Zum einen bedarf das Sehen eines physischen (übertragen auch eines denkerischen) Abstandes zwischen Betrachter und Betrachtetem, zum anderen überwindet das Sehen die Entfernung in einer Berührung auf Distanz.1 Während das analytisch begreifende Sehen auf der Unterscheidung von Subjekt (Betrachter) und Objekt (Betrachtetem) basiert, wird in Thomas l’Obscur das Begreifen zum Ergriffen-Werden durch das Objekt, wodurch sich die Subjekt-Objekt-Relation nicht nur verkehrt, sondern völlig in sich zusammenbricht. Basis des Sehens ist, wie die Kryptaerfahrung des 2. Kapitels gezeigt hat, das Nicht-Sehen – eine Schwärze oder Leere, in der es keine Möglichkeit zur Unterscheidung gibt bzw. jeder Versuch einer Differenzierung an der Unsichtbarkeit scheitert. Auch wenn das analytische Sehen Trennungen vollzieht, besteht über jeden Blick potentiell die Gefahr der Gegenreaktion des Erblickten, z.B. in Form des Zurückblickens, Blendens oder des Entzuges. Diese Umkehrbewegung betitelt Blanchot in seinen theoretischen Schriften in L’espace littéraire als Faszination.2 Sie bildet eine durchgängige Makrostruktur der Begegnung in Thomas l’Obscur. Auf einen in Bezug auf das Subjekt sehr bedrohlichen Aspekt der Faszination wird das 4. Kapitel näher eingehen.
Das vorliegende Kapitel wendet sich der Faszination als Grundlage einer wesentlich phänomenologisch geprägten Blicktheorie zu. Welche Rolle dieses Blicken für die Begegnung von Thomas mit der zweiten Figur – Anne – einnimmt, soll unter anderem anhand ihres Eigennamens untersucht werden, nicht zuletzt, weil über die Aussprache des Eigennamens eine unmittelbare Verbindung oder Berührung möglich ist, die dem Sehen das Hören beifügt. Im Falle von Thomas wird sein Name über die Frage der Berührung mit seinem biblischen Namensgenossen, Thomas dem Ungläubigen, sowie dem Thomas der apokryphen Thomas-Schriften verknüpft.