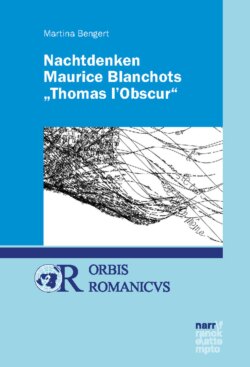Читать книгу Nachtdenken - Martina Bengert - Страница 39
3.1 Annäherung
ОглавлениеDas 3. Kapitel von TO2 ist gerahmt durch den Eintritt Thomas’ in ein Hotel und dessen Speisesaal mit dem Ziel der Nahrungsaufnahme in Form eines Abendessens zu Beginn des Kapitels und dem Verlassen dieses Gesellschaftsraums am Ende des Kapitels. Man erfährt, dass Thomas am Nachmittag schwimmen war, wodurch eine etwas genauere zeitliche Fixierung des Schwimmens im 1. Kapitel möglich ist und ein Bezug des 3. Kapitels zum 1. Kapitel hergestellt wird, welcher strukturell zusätzlich in der Bewegung des Eintritts und Austritts das Wasser mit dem geschlossenen Raum verschränkt.
Thomas trägt die Einschreibung der anderen Nacht als Spur der Krypta-Erfahrung in sich und erprobt aus dieser „nouvelle manière d’être“ heraus, wie die anderen Hotelgäste auf ihn reagieren.1 Seine neue Art des Seins bedeutet, dass er, so meine These, in der (Wieder-)Annäherung an die (Sprach-)Gemeinschaft alle Phasen der frühkindlichen Entwicklung der Sprache durchleben muss. Die erste dieser Phasen ist der akustische Kontakt, d.h. das Hören von zunächst undifferenzierten Geräuschen, die noch nicht an ein Objekt gekoppelt werden können.2 Nachdem Thomas einige Schritte in den Raum gewagt hat, konzentriert er sich zunächst auf seine auditive Wahrnehmung mit dem Ziel, auf diese Weise mit der Umwelt in Kontakt zu treten. Dieses genaue Hinhören ist jedoch nicht auf ein Objekt bezogen, sondern intransitiv: „D’abord il prêta l’oreille; il y avait un bruit confus, grossier, qui tantôt s’élevait avec force, tantôt s’atténuait et devenait imperceptible […] c’était un bruit de conversation […].“3 Aus dem lärmend-chaotischen Rauschen filtert Thomas langsam verständliche Lautketten heraus, die eine weitere physische Annäherung seinerseits bewirken. Isotopisch ist das Feld der Kommunikation in Ausdrücken wie „conversation“, „langage“, „des mots très simples qu’on semblait choisir pour qu’il pût les comprendre“, „interpeller“, „dire“, „On lui fit signe“, „invitation“, „On l’appela plus fort“, „entretien“ innerhalb weniger Zeilen unübersehbar realisiert.4 Mit anderen Menschen in Verbindung zu treten, d.h. zu interagieren, ist alles andere als selbstverständlich für Thomas. Es ist vielmehr ein Akt der ständigen Überwindung, Rücknahme, Korrektur und des Versuchens, denn die Kommunikation bedeutet eine Begegnung mit dem Anderen und als solche auch eine mit der anderen Nacht, sofern diese „die Leere des Zwischen“ von Ich und Anderem ist.5 Sofern sie dies ist, verschieben sich in ihr alle Verhältnisse permanent. Nähe ist nur durch Entfernung möglich, da allein die Distanz eine Selbstwahrnehmung wie eine Fremdwahrnehmung ohne sofortige Aneignung des Anderen ermöglicht.
Wie der Text im Weiteren vorführt, benötigt Thomas für die Möglichkeit einer Begegnung mit den anderen Menschen im Raum deren Bereitschaft, ihm offen und positiv entgegen zu treten, wenngleich er ihnen eine gewisse Hinterhältigkeit unterstellt, die sein Vertrauen zügelt. Zunächst einmal muss Raum geschaffen werden, der es ihm rein physisch ermöglicht, auf einem von einer betagten Dame verlassenen Stuhl Platz zu nehmen, um einen Ausgangspunkt der Kommunikation zu schaffen. Der leere Stuhl, den er sehr schnell besetzt, markiert auf der Ebene des Sprachlichen eine Lücke in der symbolischen Ordnung, in die Thomas als Fremder eindringt. Im Zuge seiner Selbstverortung und Orientierung am Tische wird Thomas seiner direkten Tischnachbarin gewahr, die er fasziniert betrachtet, zu der er jedoch auch im weiteren Verlauf nichts sagen wird, da er einen leeren, begehrenden Blick ohne Stimme verkörpert.