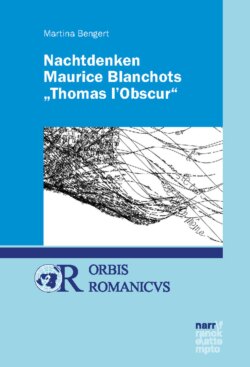Читать книгу Nachtdenken - Martina Bengert - Страница 33
2.4 Thomas’ Gang in die Krypta
ОглавлениеWenn sich Thomas im 2. Kapitel nun ein Raum eröffnet, den man als Krypta lesen kann, ist, so meine These, das Betreten der Krypta nicht wie das physische Betreten eines Raumes zu verstehen, sondern eher als ein Sich-Aussetzen einer Erfahrung all dessen, was die Stabilität gefährdet, d.h. einer Begegnung mit all den Wörtern, die aus dem Diskurs ausgeschlossen sind. In die Krypta zu steigen, heißt den Weg ins Außen zu beschreiten und auf der Suche nach dem Ausweg zu merken, dass das Außen ein Außen im Innen ist, also ein Außen, was die Innerlichkeit von innen zersetzt, weil es immer anders ist und sein wird als jedes mögliche Innen.1 Dies manifestiert sich auf der topologischen Ebene in Gestalt diverser Grenzfiguren, die den Raum teilen, verwinkeln und unpassierbar machen. Die unterschiedlichen Mauerwerke, Trennwände und Grenzen, die Thomas berührt, zeigen dies sehr plastisch. Es sind Grenzfiguren, die – wie bereits erwähnt – keinen konstanten Raum schachtelartig umrahmen, sondern lediglich augenblickliche subjektive Wahrnehmungsentwürfe unterschiedlicher Grenzen darstellen, die durch die Erzählinstanz vermittelt werden. Die Krypta formt so einen Zwischenort zwischen dem Natürlichen und dem Gemachten, was für Thomas (und den Leser) vor allem eine Problematisierung der Räumlichkeit über die Wahrnehmbarkeit impliziert. Man weiß nicht mehr, ob etwas existiert, ob es in Thomas oder außerhalb von ihm da ist oder in wie weit seine Wahrnehmung die räumlichen Gegebenheiten manipuliert und verformt. Die Krypta schreibt sich in den Raum ein und bildet somit ein abgeschottetes Außen im Innen. Dabei, und das ist zentral, verdeckt sie die Differenz zwischen sich und dem natürlichen Raum, in dem sie sich mit ihren Haltekräften aus Widerständen errichtet hat. Sie bildet ihre eigene A-Topik, sprich in ihr gelten andere Regeln des Verstehens und der Interpretation, die sich der Logik des Subjekts entziehen und zur Erhaltung dieses Nicht-Ortes dienen. Die Sprache der Krypta – ein „befremdlicher Staffellauf“ der auf Entdeutung abgerichteten Assoziationen2 – bedeutet mit Blick auf Blanchots Kapitel ein performatives Durchspielen der Gewaltsamkeit der Sprache in ihren Repräsentationsbewegungen, in ihrer gestalterischen Kraft, die sich jedoch mittels der Ersetzungsbewegungen entstaltet oder entdeutet und somit in einem negativen Schöpfungsakt ihre Hervorbringungen unaufhaltsam überschreibt. Was dennoch lesbar bleibt, sind die Spuren dieser Vorgänge. Da es mir – anders als den Psychoanalytikern Abraham und Torok – bei meiner Lektüre nicht um Heilung geht, sondern um das Nachzeichnen der Textbewegungen, möchte ich die schon begonnene Spur weiter verfolgen und an ihr exemplarisch zeigen, wie die Gründungsproblematik im Text verhandelt wird.