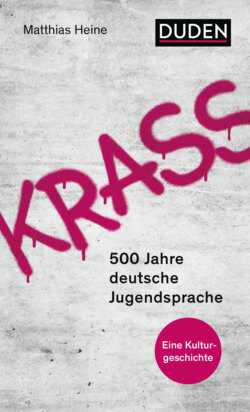Читать книгу Krass - Matthias Heine - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеFichte gegen den Pennalismus
Wie der Philosoph als Unirektor in Berlin Duelle bekämpfte
Für das Unwesen und den Straßenterror, der von den Burschen ausging, prägten die Zeitgenossinnen und -genossen einen eigenen Begriff: Pennalismus. Im Jahr 1811, in seiner Antrittsrede mit dem programmatischen Titel »Über die einzig mögliche Störung der akademischen Freiheit«, prangert Johann Gottlieb Fichte als erster frei gewählter Rektor der neugegründeten Berliner Universität den Pennalismus als größte Gefahr für das Ideal der Universität an. Für Fichte war die Wurzel allen Übels, dass sich die Studenten für eine besondere Art von Menschen hielten, die nur ihren eigenen Regeln zu folgen hätten und von allen anderen Akzeptanz und Unterordnung erwarteten. Die verblendete Selbstwahrnehmung der Studenten schildert Fichte so:
»[…] sie stellen dar das auserwählte Volk Gottes, alle Nichtstudenten aber werden befaßt unter den Verworfenen. Drum müssen alle andere Stände ihnen weichen, und ihnen allenthalben, wo sie hinkommen, den Vortritt oder Alleinbesitz lassen; alle müssen von ihnen sich gefallen lassen, was ihnen gefällt denselben aufzulegen, keiner aber darf es wagen, ihnen zu mißfallen; alle Nichtstudenten, ihre Lehrer und unmittelbare Obrigkeiten am wenigsten ausgenommen, müssen durch ehrerbietigen Ton, durch Reden nach dem Munde, durch sorgfältige Vermeidung alles dessen, was ihre zarte Ohren nicht gern hören, sich ihrer Geneigtheit empfehlen; das ist die Pflicht aller gegen sie; sie aber dürfen alle Menschen ohne Ausnahme aus dem Gefühl ihrer Erhabenheit und Ungebundenheit herab behandeln, das ist ihr Recht auf Alle.«12
Die Krebsherde dieses Sonderbewusstseins waren nach Fichte die studentischen Verbindungen, Landsmannschaften und Orden, die nicht nur mit dem Trinkkomment, in dem rituelles Betrinken geregelt und erzwungen wurde, das Ziel aller Bildung untergruben. Als noch verwerflicher und zerstörerischer empfand Fichte den selbst auferlegten Zwang der Studentenkaste, alle Dinge durch hemmungslose Schlägereien mit dem Degen zu regeln.
Doch selbst als Rektor der neuen Reformuniversität Berlin gelang es ihm nicht, diese Unsitte zu unterbinden. Eine Auseinandersetzung mit Friedrich Schleiermacher, dem damaligen Dekan der theologischen Fakultät, und dem Universitätssyndikus, dem Juraprofessor Friedrich Eichhorn, um den Duellzwang führte schließlich zu Fichtes Rücktritt: Der jüdische Medizinstudent Joseph Leyser Brogi aus Posen war in Streit mit dem ebenfalls aus Posen stammenden Burschen Melzer geraten. Antisemitische Motive spielten bei dem Konflikt mit Sicherheit eine Rolle. Sogar die sich neutral gebenden Quellen schildern Brogi als »Sohn eines jüdischen Händlers von schlechten Manieren, schäbig in der Kleidung und, was selbst diejenigen, die ihm wohlwollten, nicht zu leugnen vermochten, auch von Gesinnung«. Brogi verweigerte ein von Melzer gefordertes Duell. Daraufhin lauerte dieser ihm am helllichten Tage auf dem Platz vor der Universität auf und schlug ihn mit der Hetzpeitsche. Das entsprach dem studentischen Komment. In Kindlebens Wörterbuch der Studentensprache, von dem später noch genauer die Rede sein wird, wird die Hetzpeitsche als ein quasi-juristischer Gegenstand beschrieben: »Einem die Hetzpeitsche geben ist unter den Musensöhnen die größte Prostitution, das größte Skandal, welches nicht anders als durch einen Duell ausgelöscht werden kann. Oft bekommt auch derjenige die Hetzpeitsche, der von einem herausgefordert worden ist, und sich nicht gestellt hat.«13
Brogi beklagte sich über diesen unerhörten Rückfall in übelste Zustände des Pennalismus bei Fichte, der selbst eigentlich ein Judenfeind war. Dennoch wollte der Rektor – ganz im Sinne seiner Eröffnungsrede – gegen solches Mobbing, wie wir heute sagen würden, einschreiten. Er empfahl, den Fall vor den Senat der Universität bringen. Damit wollte er die nicht studentische akademische Gerichtsbarkeit stärken. Doch Schleiermacher und der Syndikus bremsten Fichte aus. Die Affäre gelangte vor eines der berüchtigten studentischen Ehrengerichte. Dort wurde Melzer eine vergleichsweise milde Karzerstrafe von vier Wochen auferlegt – und dem eigentlichen Opfer Brogi genau dieselbe Zeit.
Bald nach der Entlassung wurde Brogi erneut gedemütigt: Ein Student namens Klaatsch ohrfeigte ihn öffentlich. Fichte platzte nun endgültig der Kragen. Diesmal brachte er den Fall wirklich vor den Senat. Als das Gremium ebenfalls nur eine milde Strafe verhängte und eine Drohung gegen das Opfer Brogi aussprach, bat Fichte um seine Entlassung aus dem Rektorenamt. Nach weiteren harten Auseinandersetzungen wurde sie am 16. April 1812 genehmigt.