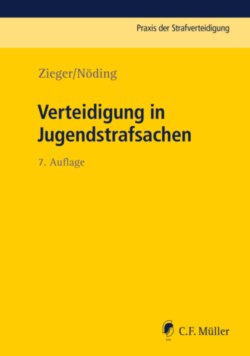Читать книгу Verteidigung in Jugendstrafsachen - Matthias Zieger - Страница 16
2. Alkohol, Drogen, Sucht
Оглавление14
Es ist nicht verwunderlich, dass in einer Gesellschaft, in der die Einnahme von Drogen (Nikotin, Alkohol, Tabletten) in der Erwachsenenwelt zum Alltag gehört, auch junge Menschen in ihrer Übergangssituation Drogenerfahrungen machen und dabei in ihrem Probierverhalten vor legalen und illegalen Drogen („Schnüffeln“ von Lösungsmitteln, Konsum von Haschisch und Marihuana, Heroin, Kokain oder synthetischer Drogen etc.) nicht Halt machen. Rauchen, Trinken und Drogeneinnahme haben zunächst den Reiz des Verbotenen, den Reiz des Eindringens in die Erwachsenenwelt, sind daneben Bestandteil von Gruppenerlebnissen (Party, Clubs). Der dauerhafte Konsum von Alkohol oder Drogenkontakt stellt sich häufig als Fluchtverhalten sowie als Versuch dar, durch die im Alkohol- oder Drogenrausch erlebten Glücksgefühle oder Überhöhungen des Selbstwertgefühls partiell einen (scheinbaren) Ausweg aus der eigenen Problemsituation zu finden.[10]
15
Zwar geht der regelmäßige Alkoholkonsum Jugendlicher und junger Erwachsener seit den 1970er Jahren kontinuierlich zurück,[11] dennoch wird weiter ein erheblicher Teil der von Jugendlichen und Heranwachsenden verübten Straftaten unter Alkoholeinfluss begangen.[12] Die Probleme bei Alkoholkonsum treten zugespitzt in Form modischer Verhaltensweisen auf, wie „Flatrate-Trinken“. Die Jugendlichen nennen das auch „Koma-Saufen“ („binge drinking“), eine Bezeichnung, welche die Gefahren der von einigen Gastwirten in unverantwortlicher Weise angebotenen Gelegenheiten zum grenzenlosen Alkoholkonsum und zum Trinken um die Wette gut trifft.
Da bei Alkohol vor allem die Selbstkontrolle eingeschränkt oder ausgeschaltet wird und der Alkohol enthemmende Wirkung entfaltet, bedarf es oft nur eines geringfügigen Anlasses, um die Gefahr aggressiver Entladung zu verwirklichen. Dies gilt vor allem für die Jugendlichen, die Alkohol in schwierigen Lebenssituationen in dem bewussten oder unbewussten Wunsch konsumieren, ihre eigene schwierige Situation, das Empfinden des Scheiterns oder des Versagens, zu überwinden und sich selbst als groß und mächtig zu erleben.[13] Der Verteidiger wird in diesem Zusammenhang klären und thematisieren, dass bei jungen Tätern die von der Rechtsprechung entwickelten Faustregeln der Auswirkungen des Alkoholkonsums auf die Schuldfähigkeit (verminderte Schuldfähigkeit ab 2 ‰, Ausschluss der Schuldfähigkeit ab 3 ‰)[14] nicht einfach unbesehen übernommen werden können. Vielmehr ist insbesondere eine Prüfung der verminderten Schuldfähigkeit (§ 21 StGB) schon bei Blutalkoholwerten unter 2 ‰ angezeigt.[15] In Zweifelfällen darf sich der Tatrichter nicht auf eigene Sachkunde verlassen, sondern muss einen Sachverständigen hinzuziehen.
16
Entgegen weitverbreiteter Meinung ist auch der Drogenkontakt für die weitaus meisten jungen Menschen nur eine Episode, kein „Einstieg“ in eine irreversible Drogenkarriere, ebenso wenig wie die Einnahme von Haschisch notwendig dazu führt, dass über dieses oft „Einstiegsdroge“ genannte Betäubungsmittel stets der Weg zu harten Drogen führt. Junge Menschen wollen dazu gehören, das ausprobieren, was andere machen, wollen ihre Erfahrungen erweitern, Grenzen überschreiten und sich auch von Verboten und Geboten der Erwachsenenwelt abgrenzen. Das „Kiffen“ gehört dazu.[16] Aber auch das in Mode gekommene, weil in der Apotheke mit gefälschten Rezepten zu erhaltene Schmerzmittel Tilidin wird zunächst nur genommen, um sich in Auseinandersetzungen schmerzunempfindlich behaupten zu können und sich dabei unüberwindlich und großartig zu fühlen.[17] Der Drogenkonsum junger Menschen wird aber dann zu einer regelmäßig nur noch durch geeignete Therapien zu überwindende Gefahr, wenn eine Suchtabhängigkeit entsteht und das gesamte Leben vom Streben beherrscht wird, an die Droge heranzukommen und die dafür erforderlichen Mittel auf welche Art auch immer zu beschaffen. Der Finanzbedarf für die Beschaffung illegaler, insbesondere „harter“ Drogen (vor allem Kokain, Ecstasy und Amphetamin sind im Vormarsch) wird von den jungen Mandanten mit mindestens 50-150 € pro Tag angegeben. Schlimmer noch als die durch die Beschaffungskriminalität angerichteten Schäden sind der Raubbau an der Gesundheit und die soziale Vereinsamung und Verelendung der drogenabhängigen jungen Täter.[18] Hinzu kommt, dass der Jugendliche sich zum illegalen Erwerb der Drogen im Regelfall ins kriminelle Milieu begeben muss.[19]
Wie beim Alkohol- wird man auch beim Drogenkonsum annehmen können, dass eine verminderte Schuldfähigkeit schon dann in Betracht kommt, wenn noch nicht alle von der Rechtsprechung bei Erwachsenen formulierten Anforderungen an die Annahme einer die Schuld erheblich mindernden oder möglicherweise sogar ausschließenden Drogensucht erfüllt sind. Die Rechtsprechung geht bei Erwachsenen davon aus, dass die Drogenabhängigkeit für sich noch nicht den Zustand verminderter Schuldfähigkeit indiziert. Vor allem bei einem chronischen Drogenmissbrauch mit nachteiligen Auswirkungen auf das Persönlichkeitsgefüge oder dann, wenn der Täter unter akuten körperlichen Entzugserscheinungen leidet oder aber die Angst vor zuvor schon als äußerst unangenehm erlebten Entzugserscheinungen die Triebfeder des strafbaren Handelns ist, ist § 21 StGB anwendbar.[20]
Eine bestehende Drogenabhängigkeit hat regelmäßig auch unabhängig von den lebensgeschichtlichen Zusammenhängen aus denen heraus sie entstanden ist, negative Auswirkungen auf die Entwicklung der sozialen Reife und ist ein wichtiges Indiz für die Anwendung von Jugendstrafrecht i.S.d. § 105 Abs. 1 Nr. 1 JGG.[21] Umgekehrt ist allein die Feststellung, dass ein junger Angeklagter harte Drogen erworben hat, nicht ausreichend, um allein hieraus Rückschlüsse auf das Vorliegen von schädlichen Neigungen zu rechtfertigen, die eine Jugendstrafe erforderlich machen.[22] Zu Recht wird auch davor gewarnt, auch schon bei sehr jungen oder erst seit relativ kurzer Zeit drogengefährdeten oder drogenabhängigen jungen Tätern eine Entwöhnungsbehandlung anzuordnen, da diese sehr einschneidende Maßnahme sie unverhältnismäßig stigmatisiert und darüber hinaus die Gefahr besteht, dass durch die dauernde Beschäftigung mit der Droge einerseits, den Kontakt zu anderen drogengefährdeten Menschen andererseits die Weisung (§ 10 Abs. 2 JGG) kontraproduktive Wirkung hat und den jungen Delinquenten am Drogenkonsum festhält.[23] Streitig ist, ob eine Therapie die Freiwilligkeit des Patienten voraussetzt oder justizieller Zwang oder zumindest der durch solchen Zwang verursachte Leidensdruck eine (noch) nicht vorhandene Therapiemotivation fördern können.[24] Das JGG und Regelungen des BtMG sprechen sich tendenziell für die Freiwilligkeit aus (§§ 10 Abs. 2, 23 Abs. 2 JGG, § 37 BtMG, § 82 JGG i.V.m. §§ 35, 36, 38 BtMG). Typisch für den „Weg aus der Sucht“ ist, dass vor einem Behandlungserfolg zunächst eine Reihe zunächst vergeblicher Therapieversuche steht; ein früherer Therapieabbruch reicht also nicht aus, um bei einem erneuten Versuch die Therapiebereitschaft zu bezweifeln oder von vornherein eine ungünstige Prognose zu stellen.[25]
17
Kurzer Erwähnung bedarf in diesem Zusammenhang noch die Spielsucht, in der psychiatrischen Krankheitslehre katalogisiert als „pathologisches Spielen“. Häufig wird der den zur Aburteilung stehenden Taten zugrundeliegende Geldbedarf nicht hinterfragt. Gerade bei Heranwachsenden nimmt aber die Zahl derjenigen, die alles Geld an Spielautomaten verlieren, zu.[26] Um Auswirkungen für die Schuldfähigkeit i.S.d. §§ 20, 21 StGB zu erlangen („schwere seelische Abartigkeit“), reicht aber allein chronisches Spielen nicht aus. Maßgebend ist vielmehr, inwieweit das gesamte Erscheinungsbild des jungen Täters bei Zugrundelegung der in der Literatur aufgeführten Beurteilungskriterien psychische Veränderungen der Persönlichkeit aufweist, die in ihrem Schweregrad der krankhaften seelischen Störung gleichwertig sind. Die maßgeblichen Kriterien des ICD 10 und des DSM-IV-TR sind: Spielen wird zum zentralen Lebensinhalt, es tritt Kontrollverlust ein, die Einsätze, Gewinne und Verluste werden gesteigert, ohne Spielen treten entzugsähnliche Erscheinungen auf, trotz hoher Verluste kann der Betroffene nicht aufhören und muss die Verluste zurückgewinnen, er ist zur Abstinenz nicht in der Lage, zieht sich aus seinem sozialen Umfeld zurück, gibt alle anderen Interessen auf und begeht Handlungsweisen, die einer bewussten Selbstbeschädigung gleich kommen.[27]
Teil 1 Jugenddelinquenz und Jugendstrafrecht › III. Problemgruppen, Problemkonstellationen › 3. Einfluss der Medien