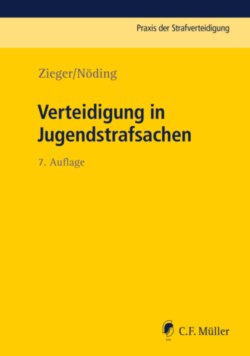Читать книгу Verteidigung in Jugendstrafsachen - Matthias Zieger - Страница 9
ОглавлениеTeil 1 Jugenddelinquenz und Jugendstrafrecht › I. Die „Normalität“ von Jugenddelinquenz
I. Die „Normalität“ von Jugenddelinquenz
1
Dem Jugendstrafrecht liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Straftaten junger Täter weitgehend Ausdruck der schwierigen Umorientierungsphase in Pubertät und Adoleszenz sind. Sie sind von daher „normal“, auf sie soll deshalb möglichst nur mit erzieherisch wirkenden Mitteln reagiert werden. Sie lassen sich in allen gesellschaftlichen Gruppen unabhängig von Schichtzugehörigkeit oder Nationalität feststellen, sind also allgegenwärtig („ubiquitär“). Diese Verhaltensweisen enden meist auch dann wenn sie nicht entdeckt und ihnen nicht mit den Mitteln des Jugendstrafrechts entgegengetreten wird, von selbst, wenn der Reifungsprozess abgeschlossen, Sozialverhalten erlernt und die persönliche Situation durch Arbeitsaufnahme und/oder Familiengründung stabilisiert ist. Jugenddelinquenz ist also ganz überwiegend eine vorübergehende Erscheinung, ist „passager“ bzw. „episodenhaft“. Die statistischen Zahlen erweisen einen rasanten Anstieg der Kriminalitätsbelastung vom 14. bis zum 21./22. Lebensjahr und danach ein deutliches, kontinuierliches Absinken mit zunehmendem Lebensalter. Bei jungen Männern steigt die Kurve der Kriminalitätsbelastung zwischen dem 14. und dem 21. Lebensjahr von Null (Strafunmündigkeit) auf knapp 8 % an, und senkt sich dann auf 3 % bis zum 50. Lebensjahr. Junge Frauen haben zwar insgesamt eine deutlich geringere Kriminalitätsbelastung aufzuweisen, aber auch dort steigt die Kurve zwischen dem 14. und dem 21. Lebensjahr von Null auf etwa 2 %, um dann bis zum 50. Lebensjahr auf 1 % zurückzugehen. Der ganz überwiegende Teil der im Jugendalter episodenhaft auftretenden Deliquenz ist dabei der sog. Bagatellkriminalität zuzuordnen. Diese allgemein anerkannten, auch in den einschlägigen Kommentaren berücksichtigten und von der Rechtsprechung durchaus erkannten und vor allem in der Diversionspraxis verarbeiteten kriminologischen Erkenntnisse sind heute, trotz aller Bewertungen im Einzelnen, unbestritten.[1] Sie werden durch die Polizei- und Rechtspflegestatistiken zu den Tatverdächtigen- bzw. Verurteiltenzahlen[2] ebenso belegt wie durch die Ergebnisse der Dunkelfeldforschung.[3] Jeder Einzelne wird, wenn er sich ohne Verdrängung an seine eigene Jugend oder an Erlebnisse mit Jugendlichen aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis erinnert, dies aus eigener Erfahrung bestätigen können.
2
Die Polizei- und Rechtspflegestatistiken erfassen natürlich nur das „Hellfeld“, also die ermittelten Straftaten. Davon sind aber bereits 15-20 % aller jungen Menschen erfasst. Dabei hat die Dunkelfeldforschung ergeben, dass nur ein geringer Teil der von jungen Tätern begangenen Straftaten entdeckt wird.[4]
3
Würde man diese Erkenntnisse ernst nehmen, bestünde unabhängig von der Streitfrage, ob Erziehen durch Strafen überhaupt möglich oder sinnvoll ist, eigentlich überhaupt kein Grund, auf Jugenddelinquenz mit den Mitteln des Jugendstrafrechts zu reagieren. Nicht gefasste und nicht bestrafte junge Menschen führen regelmäßig später ein ebenso geordnetes Leben wie diejenigen, die aus Anlass von Straftaten im Jugendstrafverfahren ermittelt und sanktioniert worden sind. Zumindest die üblichen Jugendstraftaten beweisen nicht einmal eine gesteigerte Erziehungsbedürftigkeit. Wenn dennoch reagiert wird, und sei es auch nur durch die oft bereits sehr beeindruckende Einleitung des Verfahrens (polizeiliche Vernehmung, Reaktion der Eltern und des Umfelds), dann ist dies pädagogisch nur erklärbar durch die Sorge, dass die jungen Menschen es als Gleichgültigkeit oder Inkonsequenz missverstehen würden, wenn die Verletzung von Strafrechtsnormen völlig folgenlos bliebe. Sinn der Sanktion ist dann also lediglich die Normverdeutlichung.[5] Die Jugendkriminalität muss gegenüber besorgten oder entsetzten Eltern ebenso entdramatisiert werden wie gegenüber dem gesellschaftlichen Umfeld. Es gilt der Leitsatz „weniger ist mehr“. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität jugendstrafrechtlicher Reaktionen muss strikt beachtet werden.[6] Diese Folgerung zieht auch der Gesetzgeber, vor allem in § 5 JGG (Subsidiaritätsgrundsatz), §§ 45, 47 JGG (Vorrang der informellen Erledigung durch Diversion) und §§ 71, 72 JGG (Vorrang der Haftvermeidung vor Untersuchungshaft). Diese Grundsätze hat der Verteidiger deshalb immer wieder in Erinnerung zu rufen.[7]
4
Diese Erkenntnisse passen nicht für die etwa 5 % ausmachende Gruppe junger Menschen, die wiederholt und oft auch sehr intensiv Straftaten begehen und auf deren Konto sich 30 bis 50 % der entdeckten Straftaten und dabei zumeist die schwereren Straftaten, insbesondere auch Gewaltdelikte, zurückführen lassen.[8] So wünschenswert es wäre, über Kriterien zu verfügen, um schon nach den ersten Straftaten zu erkennen, wer zu dieser Gruppe gehört, um dann mit geeigneten erzieherischen Mitteln den sich anbahnenden kriminellen Karrieren vorzubeugen, ist es trotz aller Bemühungen bisher nicht gelungen, hierfür taugliche Maßstäbe herauszufinden. Thesen, dass Schwierigkeiten im Sozialisationsprozess oder die Kontraproduktivität erlittener freiheitsentziehender Reaktionen dazu führen, dass der Jugendliche später zur Gruppe der mehrfach Auffälligen, sog. „Intensivtäter“ gehört, haben sich nicht bestätigt. Übrig geblieben ist eine aus praktischer Erfahrung gewonnene Faustregel: Wer mehr als fünfmal auffällig wurde, kann zu dieser Gruppe gerechnet werden. Das bedeutet aber umgekehrt: Bei bis zu vier Registrierungen darf man von den Grundsätzen der Normalität und Episodenhaftigkeit des Straffälligwerdens ausgehen.[9]
5
Die Erscheinungsformen der „normalen“ Jugendkriminalität lassen sich aus den einschlägigen Statistiken herauslesen. Typische Jugenddelikte sind einfacher Diebstahl, insbesondere Ladendiebstahl, schwerer Diebstahl (Automaten- und Kfz-Diebstahl), einfache und schwere, insbesondere gemeinschaftliche Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Schwarzfahren und natürlich Verkehrsdelikte (Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstöße gegen Pflichtversicherungsgesetz).[10] Seit einigen Jahren gesellen sich zu diesen „klassischen“ typischen Jugenddelikten noch vermehrt die Sachbeschädigung (Graffities, Tags) und das „Abziehen“ (Statussymbole bzw. Prestigeobjekte, insbesondere Handys oder Mützen, Jacken oder Turnschuhe angesehener Hersteller, werden von Gleichaltrigen durch Anwendung oder Androhung von Gewalt weggenommen oder heraus verlangt).[11] In letzter Zeit werden zudem gehäuft Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche wegen im Internet und den sozialen Netzwerken begangenen Beleidigungs-, Nachstellungs oder Verbreitungsdelikten (sog. Cyberbullying, Cybergrooming, Cyberstalking und Sexting[12]) geführt.[13] Außerdem treten vor allem islamische Jugendliche und Heranwachsende – fasziniert von der Gewaltpropaganda des sog. „Islamischen Staats“ – häufiger als Mitglieder oder Unterstützer terroristischer Vereinigungen (insb. nach §§ 129a, 129b StGB) in Erscheinung.[14]
6
Angesichts dieser Befunde hat sich die jugendkriminologische Forschung immer nachdrücklich gegen regelmäßig wiederkehrende Forderungen gewandt, wegen der angeblich zunehmenden und immer gefährlicher werdenden Jugendkriminalität das Jugendstrafrecht zu verschärfen, Heranwachsende generell nach Erwachsenenstrafrecht zu beurteilen oder die Strafmündigkeitsgrenze unter 14 Jahre zu senken.[15] Es sind zumeist Straftaten, begangen von der Minderheit junger Mehrfachtäter, die immer wieder Anlass für Forderungen aus dem politisch-konservativen Bereich geben, das Jugendstrafrecht ganz oder teilweise abzuschaffen und härtere, insbesondere freiheitsentziehende Sanktionen vorzusehen. Dieser Forderung muss schon deshalb entgegen getreten werden, weil sie wegen des Verhaltens einer Minderheit jugendlicher Straftäter die sonst unbestrittenen Vorteile des Jugendstrafrechts für die große Mehrheit junger Delinquenten aufgeben will. Es wird auch im Folgenden zu zeigen sein, dass härtere, freiheitsentziehende Sanktionen selbst bei dieser Minderheit keinen Präventionserfolg versprechen.
Aktuelle Statistiken weisen im letzten Jahrzehnt einen Rückgang der Kriminalitätsbelastung junger Menschen aus, wobei der Rückgang im Bereich der Gewaltkriminalität besonders stark ist.[16] In den Jahrzehnten zuvor war dagegen – durchbrochen von kurzen Perioden der Stagnation – ein Anstieg der registrierten Jugendkriminalität zu verzeichnen.[17] Im Hinblick auf diesen Anstieg der Jugendkriminalität in den 50er bis 80er Jahren ist aber zu berücksichtigen, dass sich auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geändert haben: Es wird geschätzt, dass etwa 50 % der heutigen Ermittlungsverfahren gegen junge Menschen Vorwürfe betreffen, die früher meist durch Eltern, Schule, Ausbildungsstelle oder in der Nachbarschaft informell (Erziehungsmaßnahme der Eltern, Schadensausgleich) und somit rein erzieherisch beigelegt wurden. In der heutigen, eher anonymen Gesellschaft dagegen, überwiegt eine verpolizeilichte Sozialkontrolle. Hinzu kommt in der jetzigen weitgehend „versicherten“ Gesellschaft die Notwendigkeit, durch eine Strafanzeige die Voraussetzung für eine rasche Schadensregulierung durch die Versicherung zu schaffen. Neben dem Anzeigeverhalten der Bevölkerung beeinflussen aber auch Ermittlungskapazität und Aufklärungsquote die polizeiliche Kriminalitätsstatistik. Orientiert man sich an den Verurteilungsstatistiken zeigt sich ein weitaus positiveres Bild der Kriminalitätsbelastung junger Menschen, wobei allerdings einkalkuliert werden muss, dass sich die Verurteilungsziffern durch die Diversionspraxis (§§ 45, 47 JGG) deutlich verringert haben. Im Hinblick auf die statistische Erfassung von Gewalt- und insbesondere Raubdelikten in beiden Statistiken darf nicht außer Acht bleiben, dass es sich in der Mehrzahl um Taten handelt, in denen körperliche oder bewaffnete Gewalt nur angedroht wird („Abziehen“ Gleichaltriger) oder der junge Täter sich die Überraschung des Opfers zunutze machen will (Handtaschenraub).[18]
Demnach ergibt sich auch aus den Kriminalstatistiken nicht, dass das Jugendstrafrecht keine zeitgemäße Reaktionsmöglichkeit mehr auf die Jugendkriminalität darstellt. Im Gegenteil werden Praktiker und Kriminologen nicht müde, sich statt für eine Verschärfung des Jugendstrafrechts für pädagogische und soziale, die Ursachen bekämpfende Gegenkonzepte auszusprechen: Schaffung der Voraussetzungen für eine gesicherte ökonomische Existenz in Ausbildung und Beruf, Herstellung von Bedingungen, unter denen sich ein stabiles Selbstwertgefühl und die Fähigkeit entwickeln können, verlässliche persönliche Beziehungen aufzubauen.[19] Sie plädieren für eine Erweiterung der Schutzvorschriften des Jugendgerichtsgesetzes z.B. auf junge Erwachsene bis zu 24/25 Jahren.[20]