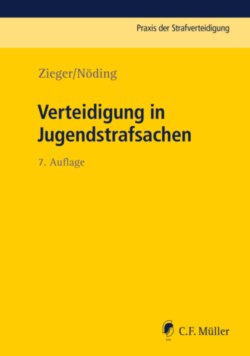Читать книгу Verteidigung in Jugendstrafsachen - Matthias Zieger - Страница 19
5. Mehrfach Auffällige, Intensivtäter
Оглавление21
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass mehrfach auffällige junge Täter, auch genannt Intensivtäter, Mehrfach- oder Schwellentäter, Serientäter etc., die eigentliche Problemgruppe des Jugendstrafrechts darstellen. Bei ihnen summieren sich die vielfältigen Faktoren, welche die „normale“ Jugendkriminalität verstärken und zu einer kriminellen Karriere führen. Dazu gehören Sozialisationsdefizite, Erleben häuslicher Gewalt, beziehungsunfähige Eltern, das broken-home-Syndrom, Loyalitätskonflikte, negative Einflüsse der peer group, aber auch psychische Auffälligkeiten bis hin zu psychiatrischen Diagnosen wie Störung des Sozialverhaltens, Bindungsstörung, ADHS, posttraumatische Belastungsstörungen und natürlich auch Alkohol- und Drogenabusus.[57] Es ist aber bisher nicht gelungen, aussagekräftige Kriterien zu finden, die eine frühzeitige Entscheidung erlauben, wer zu dieser Problemgruppe gehört und wer nicht.[58] Es geht hier nicht nur um spektakuläre Taten wie aufsehenerregende Morde, Sittlichkeitsverbrechen oder schwere Brandstiftung an Asylheimen, sondern auch um alltägliche Fälle vor den Jugendgerichten (Diebstahl, „Abziehen“ etc.), nur mit der Besonderheit, dass die jungen Angeklagten immer wieder vielfältig vor den Jugendgerichten in Erscheinung treten. Für diese Jugendlichen wurde früher der diskriminierende Begriff der „Verwahrlosung“ gebraucht, der nach §§ 64, 65 JWG (außer Kraft getreten 1990) die Anordnung von Fürsorgeerziehung rechtfertigte, während das neue Jugendhilferecht nunmehr „Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen“ vorsieht, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung sonst nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist (§§ 27 Abs. 1, 34 SGB VIII).[59]
Die Jugendkriminologie versucht, die Karriere von Mehrfachtätern idealtypisch in acht Phasen zu erfassen:[60] (1) Ein Jugendlicher begeht ein kleines Delikt zur Lösung eines Problems. Er erfährt Hilfe durch Eltern oder Freunde oder kann durch sonstige Erfolgserlebnisse das Problem kompensieren. Ohne eine solche Problemlösung kommt es zu (2) einer erneuten Verfehlung. Wenn er Glück hat, wird er erneut offiziell nicht erfasst oder es hilft ihm jemand, ohne dass seine Umwelt darauf reagiert; andernfalls wird er ertappt und „bestraft“, muss beim Jugendamt erscheinen oder erhält gar vom Jugendgericht eine Weisung. (3) Das ursprüngliche Problem vertieft sich. Wenn er Glück hat, wird der Jugendliche von seinen Altersgenossen einigermaßen aufgefangen, soweit er in eine „intakte Gruppe“ kommt. Ist seine peer-group das nicht, sucht der Jugendliche seine Selbstbestätigung in der jugendlichen Bande, sein Delikt führt zur Anerkennung in derselben, Strafe wird als Ungerechtigkeit abgelehnt. (4) Es wird immer wahrscheinlicher, dass er bei einem neuen Delikt erwischt wird, positive Lösungen werden immer unwahrscheinlicher, die Sanktionen werden, schon wegen der unvermeidlichen Abstempelung, härter. (5) Der Jugendliche gilt nun offiziell als „delinquent“. Obwohl immer mehr Einfühlungsvermögen, Verständnis und gezielte aktive erzieherische Hilfe notwendig wären, um den Prozess aufzuhalten, schränkt sich der Handlungsspielraum immer mehr ein: Der Jugendliche muss die Schule wechseln, verliert die Lehrstelle, darf den Führerschein nicht machen und rechnet sich selbst zu den „Delinquenten“. (6) Jetzt beginnt eine delinquente Rollenkarriere, und eine normale Sozialisation wird nahezu unmöglich gemacht. Es werden ihm „schädliche Neigungen“ bestätigt, und er erfährt eine Rollenfestlegung von außen als Dieb, Schläger, Rocker, Drogenkonsument etc. (7) Er wird in eine Jugendstrafanstalt eingewiesen, die Rolle wird endgültig verfestigt und die Probleme, die ihn ins Gefängnis geführt haben, verstärken sich. Anerkennung und Vorteile erhält er nur noch im Rahmen seiner negativen Rollenfixierung. (8) Nach der Entlassung ist er vorbestraft und isoliert, zu den alten Problemen kommen neue hinzu mit Vermietern, Arbeitgebern, so dass er sich eigentlich nur noch an andere Vorbestrafte anschließen kann.
Nach der Faustregel der Praxis gehört zur Gruppe der „mehrfach Auffälligen“ derjenige, der mehr als fünfmal mit Taten, die nicht nur Bagatellcharakter haben, jugendgerichtlich in Erscheinung getreten ist.[61] Die Berliner Intensivtäterrichtlinie nennt als Zielgruppe Personen, die durch besonders intensive kriminelle Energie auffallen in Hinblick auf besondere Gewaltanwendung, Rücksichtslosigkeit, Opferauswahl, zeitliche Abfolge der Straftaten, Mangel an Einsicht und/oder Resozialisierungsbereitschaft, Tatbegehung während Freigangs, offenen Vollzugs, Hafturlaubs, Haftverschonung, Bewährung. Sie definiert als Intensivtäter diejenigen jungen Straftäter, die verdächtig sind entweder eine den Rechtsfrieden besonders störende Straftat „herausragender Art“, insbesondere aus dem Bereich der Raub- oder Rohheitsdelikte oder innerhalb eines Jahres in mindestens fünf Fällen, in zehn Fällen „den Rechtsfrieden besonders störende Straftaten“ oder innerhalb eines Jahres in mindestens zehn Fällen „Straftaten von einigem Gewicht“ begangen zu haben und bei denen die Gefahr einer sich verfestigenden kriminellen Karriere besteht.[62]
In allen Bundesländern sind zwischenzeitlich spezielle Richtlinien und Konzepte zum Umgang mit jungen Mehrfachtätern eingeführt, oft auch spezielle Jugend-Intensivtäterabteilungen der Staatsanwaltschaft. Sie setzen auf eine Steigerung der Effektivität der Kriminalitätsbekämpfung und enthalten regelmäßig folgende Maßnahmen: Täterorientierte Sachbearbeitung (ein Sachbearbeiter für einzelne Täter) auf polizeilicher, teils auch auf staatsanwaltschaftlicher Ebene; beschleunigte Ermittlungen, um eine möglichst schnelle zeitliche Folge von Tat und Sanktion zu erwirken; besondere polizeiinterne Dateien und intensiver Informationsaustausch zwischen Polizei, Jugendamt, Staatsanwaltschaft und Gericht; Erarbeitung von personenorientierten Berichten; Erhöhung der Kontrolldichte durch Streifen- und Observationsbeamte; Gefährderansprachen, in denen die jungen Mehrfachtäter über die Aufnahme in das Programm und den damit verbundenen Kontrolldruck hingewiesen werden; Aufklärungsgespräche mit Personensorgeberechtigten.[63] Diese Programme haben sicherlich zu höherer Effizienz der Ermittlungen geführt, ändern aber nichts an den psychosozialen Faktoren für die vielfache Straffälligkeit und verstärken den oben dargestellten Effekt der negativen Stigmatisierung dieser jungen Menschen.[64] Insbesondere die rechtliche Grundlagen und Grenzen des Datenaustausches und der Zusammenarbeit zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendamt, Gericht, weiteren Behörden und freien Trägern sind weitestgehend ungeklärt[65] und unter datenschutzrechtlichen Aspekten hochproblematisch.[66]
22
Die allgemeine Ratlosigkeit, wie mit dieser Gruppe richtig umzugehen ist, drückt sich in einem deutlichen Widerspruch zwischen Theorie und Praxis aus: Während die Wissenschaft jugendstrafrechtliche Reaktionen eher für problematisch hält und eine intensive sozialpädagogische Aktivität verlangt,[67] eskaliert die Praxis der Jugendgerichte bei jedem Auffällig werden die jugendstrafrechtliche Reaktion, so dass der Weg scheinbar unvermeidlich schließlich in die Jugendstrafanstalt führt.[68] Diesem Eskalationsprinzip liegt die Bewertung zugrunde, dass es erzieherisch nicht angebracht wäre, einen jungen Täter, der die Warnung der vorhergehenden jugendstrafrechtlichen Reaktion missachtet und erneut Straftaten begangen hat, diese Missachtung nicht durch eine Verschärfung der Sanktion spüren zu lassen („Wer nicht hören will, muss fühlen.“). Hinzu kommt die Erwägung, dass die Verschärfung deshalb erforderlich ist, weil sich ja erwiesen hat, dass die bisher ausgesprochene Maßnahme den Jugendlichen nicht davon abgehalten hat, erneut gleichartige Taten zu begehen.[69]
Diese Praxis ist zu beanstanden. Die geringe erzieherische Wirkung jugendstrafrechtlicher Sanktionen ohne Änderung des Umfeldes und der Lebenssituation des Jugendlichen wird gerade bei denjenigen, die aus ihrer besonderen Problemlage heraus mehrfach auffällig werden, verkannt. Darüber hinaus darf das Erziehungsstrafrecht das im Strafrecht geltende Schuldprinzip nicht außer Kraft setzen; das Schuldprinzip setzt einer Strafverschärfung aus erzieherischen Gründen Grenzen, so dass es problematisch ist, schematisch bei wiederholtem, im Handlungsunrecht aber gleichbleibenden Taten eine Strafverschärfung auszusprechen.[70] Es ist deshalb auch festzustellen, dass die Praxis diesem Eskalationsprinzip selbst wieder untreu wird, weil nach Verhängung und Verbüßung von Jugendstrafe erneute Straftaten desselben Angeklagten auffällig häufig wieder mit ambulanten Sanktionen belegt werden, so als ob die Einsicht gewonnen wurde, dass der bisherige Weg nicht der richtige ist.
Ungeachtet solcher Erkenntnisse setzt die Kriminalpolitik aber lieber auf eine harte Spezialbehandlung für diesen Personenkreis, mit regional unterschiedlichen Konzepten. Während sich Staatsanwaltschaft und Polizei der hohen Aufklärungsquote und der Verunsicherung der Intensivtäter durch das harte, konsequente Vorgehen rühmen,[71] kritisieren Kriminologen, ein Teil der Jugendrichter und Verteidiger rechtsstaatliche Defizite in der Praxis dieser Intensivtäterabteilungen: Der Polizei wird eine ihr nicht zukommende Definitionsgewalt zugesprochen, die zu unzulässiger Vorverurteilung führt. Kritisiert wird weiter, dass die Polizei im Bemühen, präventiv zu wirken, Aufgaben und Rollen übernimmt, für die sie nicht ausgebildet ist und die ihr nach der gesetzlichen Aufgabenverteilung nicht zustehen, so z.B., wenn sie in Bereiche der Jugend- und Sozialhilfe durch regelmäßige Hausbesuche oder Mitternachtssportveranstaltungen vordringt, obwohl sie keinen Erziehungsauftrag hat.[72] Das Gebot der Gleichbehandlung wird verletzt, wenn bei diesen Beschuldigten von der Staatsanwaltschaft generell von § 154 StPO oder §§ 45, 47 JGG kein Gebrauch gemacht wird. Junge Angeklagte werden dadurch bloßgestellt, dass im wesentlichen Ermittlungsergebnis der Anklagen ihre problematischen Lebensläufe und alle bisher begangenen Straftaten in extenso dargelegt und damit zur Kenntnis aller Mitangeklagten gebracht werden.[73] Strafanträge der Staatsanwälte dieser Spezialabteilung erwecken den Eindruck, dass es entgegen § 18 Abs. 2 JGG nicht um Erziehung, sondern um Abschreckung geht.[74] Gerichtliche Entscheidungen ignorieren bei Intensivtätern häufiger als sonst geltende Standards (§§ 71, 72 JGG) bei der Begründung der Fluchtgefahr.[75] Evaluationen der Wirksamkeit der dargestellten „Intensivtäterprogramme“ sind kaum vorhanden und kommen zu widersprüchlichen oder wenig aussagekräftigen Ergebnissen.[76]
Teil 1 Jugenddelinquenz und Jugendstrafrecht › III. Problemgruppen, Problemkonstellationen › 6. Gewaltdelikte, Sexualstraftaten