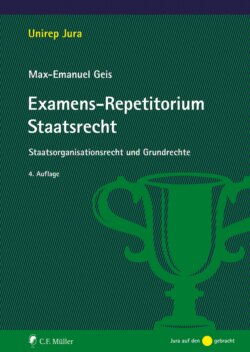Читать книгу Examens-Repetitorium Staatsrecht - Max-Emanuel Geis - Страница 53
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung
Оглавление47
Die Einschränkung der Öffentlichkeit der Wahl ist verfassungsrechtlich nicht vorgesehen. Allerdings könnte die Ungleichbehandlung durch kollidierendes Verfassungsrecht gerechtfertigt sein. Der Gesetzgeber kann in begrenztem Umfang Ausnahmen vom Grundsatz der Öffentlichkeit zulassen, um anderen verfassungsrechtlichen Belangen, insbesondere den geschriebenen Wahlrechtsgrundsätzen aus Art. 38 I 1 GG, Geltung zu verschaffen.[14]
48
Der Gesetzgeber hat durch die Reform des Bundeswahlrechts einige spezielle Wahlrechtsprobleme wie das „negative Stimmgewicht“ und die ausgleichslosen Überhangmandate beseitigt, die den Grundsatz der Gleichheit der Wahl aus Art. 38 I 1 GG verletzt haben. Um dies zu erreichen war es notwendig ein komplexes, mehrstufiges Verfahren zu entwickeln, was sich negativ auf die Öffentlichkeit der Wahl ausgewirkt hat. Allerdings konnte damit der Gleichheit der Wahl hinsichtlich des Erfolgswertes von abgegebenen Stimmen Rechnung getragen werden, so dass die Beeinträchtigung der Öffentlichkeit der Wahl hinter dem Grundsatz der Gleichheit der Wahl zurücksteht und diese folglich verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist.[15]
49
Exkurs: Wahlsystem und Wahlrechtsgrundsätze
Das Grundgesetz trifft über das Wahlsystem selbst keine Regelung, sondern überlässt die Ausgestaltung dem Bundesgesetzgeber (Art. 38 III GG), der davon im BWG Gebrauch gemacht hat.[16] Nach § 1 I BWG erfolgt die Bundestagswahl nach einer mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl (sog. personalisierte Verhältniswahl).[17] Dies ist eine Mischform aus Mehrheitswahlsystem (Persönlichkeitswahl) und der Verhältniswahl (Listenwahl). Aufgrund des Mehrheitswahlsystems ist das Wahlgebiet in Wahlkreise aufgeteilt, in denen jeweils ein Kandidat mit Stimmenmehrheit zu wählen ist (Erststimme). Bei der Verhältniswahl hingegen wird mit der Zweitstimme die Partei (Liste) gewählt, die anhand der prozentual auf sie entfallenen Stimmen Sitze im Bundestag erhält. Die Zweitstimme ist maßgeblich für die Sitzverteilung bzw. die Anzahl der Sitze einer Partei im Parlament. Die Direktmandate aus der Erststimme werden dann auf diese Sitze verteilt. Kurzum bestimmt die Zweitstimme, wie stark eine Partei vertreten ist, während die Erststimme festlegt, welcher Kandidat in das Parlament einzieht. Das BVerfG umschreibt das Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland in seiner Entscheidung BVerfGE 95, 335 (352 f.) folgendermaßen:
„... Das Verhältniswahlrecht bewirkt die Repräsentation dadurch, dass die Parteien ihre Kandidaten und Programme den Wahlberechtigten vorstellen und die Wähler in der Wahl einer Liste die Entscheidung für eine parteipolitische Richtung treffen. Die Verhältniswahl in strikter Ausprägung macht das Parlament zum getreuen Spiegelbild der parteipolitischen Gruppierung der Wählerschaft, in dem jede politische Richtung in der Stärke vertreten ist, die dem Gesamtanteil der für sie im Staat abgegebenen Stimmen entspricht (vgl. BVerfGE 1, 208 [244]). Demgegenüber bestimmt bei der Mehrheitswahl die Mehrheit der gültigen Stimmen den erfolgreichen Kandidaten; die übrigen Stimmen bleiben ohne Auswirkung auf die Zusammensetzung des Parlaments. Die Mehrheitswahl sichert eine engere persönliche Beziehung des Abgeordneten zu dem Wahlkreis, in dem er gewählt worden ist (BVerfGE 7, 63 [74]; 16, 130 [140]; 41, 399 [423]). Die Wahl des Abgeordneten als Person – und nicht als Exponent einer Partei – stärkt den repräsentativen Status des Abgeordneten als Vertreter des ganzen Volkes (Art. 38 I 2 GG; vgl. BVerfGE 11, 266 [273]), stützt die nach Art. 21 GG gebotene innerparteiliche Demokratie und gibt dem Vertrauen des Wählers zu seinem Repräsentanten ...“
Die Wahlrechtsgrundsätze
In Art. 38 I GG sind die Grundsätze der allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl verankert. Die Allgemeinheit der Wahl bedeutet, dass jedem wahlberechtigten Bürger (Art. 38 II GG) das Wahlrecht zusteht. Differenzierungen im Bereich der Wahlberechtigung sind nur aus zwingenden Gründen zulässig.[18] Die Unmittelbarkeit der Wahl gewährleistet, dass die Entscheidung des Wählers direkt den Abgeordneten erreicht. Weitere Entscheidungsinstanzen – wie etwa das amerikanische Wahlmännersystem – dürfen daher nicht zwischengeschaltet werden. Darüber hinaus verlangt der Unmittelbarkeitsgrundsatz, dass der Wähler vor dem Wahlakt erkennen kann, welche Personen sich um ein Mandat bewerben und wie sich die eigene Stimmabgabe auf den (Miss)Erfolg auswirken kann.[19] Der Grundsatz der geheimen Wahl erklärt sich von selbst: Es sind Vorkehrungen zu treffen, die dem Wähler eine unerkannte Stimmabgabe ermöglichen. Die Entschließungsfreiheit des Wählers wird durch die Freiheit der Wahl sichergestellt. Jeglicher Druck oder Zwang auf den Wähler ist gem. Art. 38 I 1 GG ausgeschlossen.
Für alle Wahlrechtsgrundsätze gilt, dass eine Einschränkung grundsätzlich nicht zulässig ist. Es bedarf kollidierenden Verfassungsrechts bzw. eines zwingenden Grundes, um eine Differenzierung oder Ausnahme zu rechtfertigen.