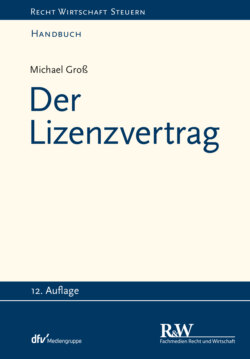Читать книгу Der Lizenzvertrag - Michael Groß - Страница 140
b) Schadensberechnung
Оглавление395
Wegen der Schwierigkeit der Schadensfeststellung bei Patentverletzungen stehen nach der Rechtsprechung des Reichsgerichtes,10 der sich der Bundesgerichtshof ausdrücklich angeschlossen hat,11 demjenigen, der Schadensersatz wegen einer schuldhaft rechtswidrigen Patentverletzung fordern kann,12 wahlweise drei Wege für die Berechnung seines Schadensersatzes offen:
Der Patentinhaber kann verlangen, dass der Verletzer den Vermögenszustand herstellt, der bestehen würde, wenn die Verletzungshandlung nicht erfolgt wäre. Dabei kann er auch gem. § 252 BGB den Ersatz des Gewinnes verlangen, der ihm selbst durch die Verringerung seines eigenen Absatzes infolge der Patentverletzung entgangen ist.13
Der Patentinhaber kann aber auch verlangen, dass der Verletzer als Schadensersatz eine Gebühr abführt, wie er sie hätte zahlen müssen, wenn er eine Lizenz erworben hätte.14
Schließlich kann die Herausgabe des Gewinns, den der Verletzer infolge seiner unzulässigen Handlung erzielt hat, verlangt werden.15
Der Bundesgerichtshof hat sich auf die gewohnheitsmäßige Geltung dieser drei Berechnungsmethoden berufen.16 Nach seiner Rechtsprechung handelt es sich dabei nicht um selbstständige Anspruchsgrundlagen, sondern nur um besondere Arten der Schadensberechnung.17 Der Inhaber des verletzten Patentes hat dementsprechend die freie Wahl, nach welcher Berechnungsart er seinen aus der Patentverletzung sich ergebenden Schaden berechnen will,18 wobei die Berechnungsmethoden allerdings durchaus zu einer unterschiedlichen Höhe des Schadensersatzanspruches führen können.19 Bei der Berechnung des entstandenen Schadens dürfen die drei Berechnungsmöglichkeiten nicht miteinander verbunden werden, da der Anspruch nur aus einer der drei Berechnungsmöglichkeiten zugesprochen werden kann.20 Möglich ist jedoch ein Eventualverhältnis zwischen den Berechnungsarten, z.B. um einen bestimmten Mindestschaden durch mehrere Berechnungen zu begründen.21
396
Will der Patentinhaber mit seiner Schadensersatzklage Erfolg haben, so ist in allen drei Fällen Voraussetzung, dass ihm ein Schaden entstanden ist. Dies wird nicht immer genügend berücksichtigt.22 Für den Schadensnachweis gibt die Vorschrift des § 287 ZPO, nach der das Gericht unter Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung entscheidet, wie hoch sich ein unter den Parteien streitiger Schaden beläuft, eine wesentliche Erleichterung.23 Sie erspart es dem Kläger jedoch nicht, dem Gericht eine tatsächliche Grundlage zu unterbreiten, auf die das Gericht seine Entscheidung stützen kann.24 Dabei hat der Schutzrechtsinhaber auch einen Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung gegenüber dem Patentverletzer.25
397
Unabhängig von allen Schadensersatzansprüchen ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Patentverletzer im Vergleich zu einem Lizenznehmer ungerechtfertigte Vorteile genießt, da das Verletzungsrisiko begrenzt und kalkulierbar ist.26 Teilweise wird daher ein Schadensersatz in Höhe des Zweifachen der üblichen Lizenzgebühr vorgeschlagen.27 Vollrath28 schlägt vor, bei der Bemessung der Schadensersatz-Lizenzgebühr für Patentverletzungen die Grundlizenzgebühr, die vorab pauschal und gesondert von den laufenden Lizenzgebühren gezahlt wird, zu berücksichtigen. Dies hätte die Konsequenz, dass bei der Berechnung des Schadensersatzes eine Aufteilung der Gesamtlizenzgebühr in eine Grundlizenzgebühr und in eine laufende Schadensersatz-Lizenzgebühr vorzunehmen wäre, wodurch sich im Allgemeinen eine Erhöhung des Schadensersatzes ergeben dürfte. Bei der neueren Rechtsprechung ist die Bereitschaft zu erkennen, gewisse Zuschläge vorzunehmen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs29 ist eine Ergänzung der Ermittlung der angemessenen Schadenslizenzgebühr in Form eines Aufschlages nach Maßgabe der kaufmännischen Zinspflicht deshalb möglich, da der Verletzer nicht, wie ein Lizenznehmer es müsste, in kurzen zeitlichen Abständen abrechnet und zahlt, sondern erheblich später. Die bisherige Berechnungsgrundlage des Schadensersatzes auf der Basis des Wertes einer einfachen vertraglichen Lizenz30 ist daher zumindest um den Verzinsungsaspekt zu ergänzen.
398
Insbesondere wenn Lizenzen erteilt sind, kann es fraglich sein, ob dem Lizenzgeber ein Schaden entstanden ist.31 Ist kein konkret nachzuweisender Schaden entstanden, kann der Patentinhaber allenfalls nach einer in der Literatur vertretenen Meinung aus dem Gesichtspunkt der ungerechtfertigten Bereicherung den Gewinn des Verletzers herausverlangen.32 Der Bundesgerichtshof hat sich allerdings auf den eindeutigen Standpunkt gestellt, dass der Anspruch des Bereicherungsgläubigers nach der Verletzung gewerblicher Schutzrechte auf die Zahlung einer angemessenen Lizenz zu begrenzen ist und sich nicht auf die Herausgabe des Verletzergewinnes erstreckt.33
Ist eine ausschließliche Lizenz erteilt, bei der die Lizenz als Stück- oder Umsatzgebühr34 berechnet wird, so liegt der Schaden meist darin, dass anzunehmen ist, dass der Lizenznehmer das Geschäft gemacht und daher dem Lizenzgeber eine Lizenzgebühr gezahlt hätte35 bzw. der Lizenzgeber erhöhte Lizenzeinnahmen erhalten hätte, wenn dieser – berechtigt – eine Unterlizenz erteilt hätte.36 Der Schaden kann aber auch darin liegen, dass der Verletzer minderwertige Ware herstellt, wodurch das Ansehen des Patentinhabers geschädigt wird und dadurch auch Schäden entstehen. In diesem Fall kann der Ersatz dieses – ggf. erheblichen – Schadens über die übliche Lizenzgebühr hinaus gefordert werden.37
Grundsätzlich kann der Patentinhaber aber nur den Ersatz des ihm entstandenen Schadens verlangen. Ist daher eine ausschließliche Lizenz mit der Maßgabe erteilt, dass eine einmalige Gebühr zu entrichten ist, so ist es möglich, dass dem Lizenzgeber durch die Verletzungshandlung kein Schaden entstanden ist, es sei denn, dass infolge der Beeinträchtigung des Schutzrechtes der Lizenznehmer gegen den Lizenzgeber aufgrund des Vertrages Ansprüche erheben kann.38
399
Sind einfache Lizenzen erteilt, so kann der Schaden darin liegen, dass anzunehmen ist, dass das Geschäft durch einen Lizenznehmer gemacht worden wäre und der Lizenzgeber eine Gebühr erhalten hätte. Nichts anderes gilt, wenn der Lizenzgeber selbst neben den Lizenznehmern den Lizenzgegenstand herstellt und anzunehmen ist, dass entweder er oder seine Lizenznehmer das Geschäft gemacht hätten. Dabei sind bei der Berechnung des Schadens ggf. auch die Vorteile der Situation des Verletzers gegenüber der Stellung des Lizenznehmers zu berücksichtigen.39 Der Bundesgerichtshof verweist insofern darauf, dass z.B. bei einer sich auf den Vertrieb beschränkenden Schutzrechtsverletzung keine Belastungen mit langfristig zu amortisierenden Investitionen vorliegen.40 Ebenso ist der Zinsgewinn41 zu berücksichtigen. Ist der Lizenzgeber durch seine einfachen Lizenznehmer schon vollständig abgefunden und können diese nicht aufgrund vertraglicher Vereinbarungen Rechtsansprüche gegen den Lizenzgeber geltend machen, wenn ein Unbefugter ein Schutzrecht verletzt, so ist es für den Lizenzgeber sehr schwer nachzuweisen, dass er geschädigt worden ist. Die Rechtsprechung ist allerdings von dem Bestreben gekennzeichnet, dem Schutzrechtsinhaber, der sein Schutzrecht nicht auswertet oder den oft schwierigen Nachweis eines durch die Verletzungshandlung entstandenen konkreten Vermögensschadens nicht oder nur unvollkommen führen kann, gleichwohl einen Ausgleich dafür zu verschaffen, dass der Verletzer durch die unerlaubte Benutzung des Schutzrechtes einen geldwerten Vermögensvorteil erlangt hat.42 Diese relativ großzügigen Maßstäbe der Rechtsprechung erklären sich daraus, dass der Inhaber einer einfachen Lizenz – wie noch näher zu erläutern ist – nach herrschender Meinung keine Ansprüche gegen den Verletzer geltend machen kann, auch wenn ihm ein Schaden entstanden ist, und so das Dilemma entstehen kann, dass der anspruchsberechtigte Schutzrechtsinhaber keinen Schaden, der Lizenznehmer zwar einen Schaden, aber keinen Anspruch hat.43
Aufgrund immer seltener gewordener komplett neuer Technologien, die zudem immer häufiger nur teilweise durch Patente geschützt werden, gibt es immer öfter Verletzungsstreitigkeiten über „zusammengesetzte“ Technologien, was bei der Frage der Bemessung der „angemessene Lizenzgebühr“ letztlich wieder dazu führt, dass nicht nur die Frage der Höhe des geschützten Teils der Technologie, sondern zusätzlich die Frage der Wertigkeit des geschützten Teils der Technologie im Verhältnis zur Wertigkeit des Gesamtprodukts beantwortet werden muss. Unter Wertigkeit ist insofern nicht der Preis dieses Teils und des Gesamtprodukts, sondern die technische und wirtschaftliche Bedeutung des geschützten Teils im Vergleich zum Gesamtprodukt zu ermitteln. Ein geschütztes Teil kann z.B. einen Materialwert von nur wenigen Cent, aber gleichzeitig einen so hohen Wert für das Gesamtprodukt haben, dass dieses ohne das preiswerte Teil nicht mehr vertrieben werden kann. Es entstehen dadurch sehr komplexe Beurteilungen durch Sachverständige, die immer öfter in der Form gehandhabt werden, dass zunächst ein technischer Sachverständiger die technische Bezugsgröße ermittelt und dann ein Sachverständiger, der in diesem technischen Bereich sehr viele Lizenzverträge abgeschlossen hat, die Höhe der Lizenzgebühr bestimmt. Dies ist jedenfalls die Erfahrung des Autors aus den letzten Jahren im Hinblick auf eine Reihe von ihm gefertigter Gutachten.44