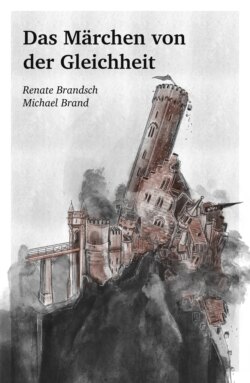Читать книгу Das Märchen von der Gleichheit - Michael Brand - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAuf diese Ordnung kommt es an
In unserem Kosmos gibt es kein Phänomen, dessen Gehalt an Ordnung dem der Lebenserscheinungen nahekäme; und es gibt keine Lebenserscheinung, die nicht selbst auf einem ungeheuren Gebäude von Ordnung beruhte. Leben ist Ordnung schlechthin. Und diese Ordnung ist eine ganz besondere, sie verkörpert sehr viel Information, sie enthält sehr viel Wissen. Darauf kommen wir im nächsten Kapitel zurück.
Normalerweise bezeichnen wir vielfach das als Ordnung, was hohe Regelmäßigkeit aufweist. So scheinen uns die Atome in einem einatomigen Einkristall geordneter zu sein als etwa die Atome in einer DNA-Doppelhelix. Doch höhere, lebendige Ordnung wird zunehmend asymmetrischer. Eine DNA-Doppelhelix beispielsweise besitzt einen höheren Ordnungsgrad als ein regelmäßiges Einkristall, weil in ihr eine hochkomplexe Information steckt. Darum sind solche Systeme asymmetrisch,87 wie eben auch das DNA-Molekül.88
Denn das Leben kann die ständig wachsende Unordnung nur in Schach halten, wenn die eigene Ordnung ebenfalls wächst. Weil aber die zugeführte Information immer begrenzt ist, muss sich ein lebendiges System höchst ökonomisch verhalten, diszipliniert beschränkt es zunächst sich selbst; dann speichert es alle bisherigen, bewährten Informationen und ordnet sie hierarchisch. Folglich ist Leben immer räumlich begrenzt, hierarchisch strukturiert und baut immer auf tradierter Information auf, um sich weiter differenzieren zu können.
Nun etwas genauer:
Begreift man die Welt als ein Ineinander evolvierender Systeme, lässt sich eine kosmische von einer planetaren, eine biologische von einer psychosozialen Evolution unterscheiden.89 Diese Entwicklung zeigt eine Abnahme der Größe der Raum-Zeit-Skala und einen gleichzeitigen Anstieg der Komplexität. Mit anderen Worten: Die Systeme werden kleiner, kurzlebiger, aber komplexer.
Denn Struktur bedeutet nicht nur räumliche Begrenztheit, sondern setzt sie auch voraus.90 Ordnung erwächst also nur aus einer „Verengung der Wirklichkeit“.91 Die vielzitierten „Grenzen des Wachstums“ werden durch die Evolution der Struktur überwunden.92 Darum verbindet der Gestalt- oder Systemcharakter alle Materieorganisationen miteinander.
Ein System stellt eine Einheit aus Teilen dar, die miteinander verbunden sind. Diese Bindung konstituiert eine Grenze, die das System von seiner Umwelt trennt. Ordnung schafft Grenzen. Lebendige Systeme sind darum durch eine vielfältige Kompartimentierung und Grenzziehung charakterisiert. Gleichzeitig erkennt man Ordnung als eine Eigenschaft des Zusammenhangs, denn die Struktur eines Systems wird weniger durch seine Elemente repräsentiert als durch ihre Beziehungen untereinander. In lebenden Systemen sind diese Beziehungen dynamischer Natur, hier ist Struktur ein raum-zeitlicher Prozess, der Funktion wie Umweltbeziehungen des Systems einschließt. Lebende Strukturen sind also keineswegs etwas Solides, sie leben von ständiger Erneuerung.
Die innersystemische Bindung unterscheidet sich von lockeren Assoziationen zum außersystemischen Bereich durch ihre Festigkeit und Dauer: Die innersystemische Bindung eines Organismus beispielsweise ist ungleich fester als seine außersystemischen Beziehungen. Sie bildet die Grundlage der spezifisch geordneten Struktur des Systems und ist Ausdruck eines Aufbaus. Jede neu entstehende Bindung setzt darum angesichts der immer begrenzten Ressourcen eine „ökonomische“ Effizienz, ein konstruktives Haushalten voraus, Strategien, die alles Leben charakterisieren. Sie werden auch deutlich in der Selbstbeschränkung eines lebendigen Systems, das gleichzeitig auch wachsen kann. Wir verstehen das besser, wenn wir eine an Krebs erkrankte Zelle sehen, deren grundlegende Störung darin besteht, dass sie ungehemmt wächst.
Die Grenze eines Systems bildet die Kehrseite ihrer endlichen Struktur bzw. Bindung und spiegelt deren Komplexität wider. Bindung und Grenze bedingen einander. Darum veranlasst uns die hoch differenzierte Strukturierung lebendiger Gebilde, ihre Silhouette als Gestalt zu empfinden.
In der kosmischen Grenzenlosigkeit bedeutet die Konstituierung einer Grenze nämlich eine hohe Leistung. Ohne Grenzen, zum Beispiel ohne ein Magnetfeld, das die harte kosmische Strahlung abschirmt, ohne eine Ozonschicht, die den UV-Anteil des Sonnenlichtes abwehrt, gäbe es die hochkomplexe Biosphäre nicht; ohne eine semipermeable Membran keine Zelle und damit keine höheren Organismen. Denn die „Ur-Erde“, eine „Art Laboratorium mit Bedingungen fern vom thermodynamischen Gleichgewicht“, kennt noch keine Grenzziehung. Erst allmählich entstehen „Kompartimente, Zellwände und halbdurchlässige Membranen, die den selektiven Austausch mit der Umgebung möglich machen“.93 Denn einerseits müssen Grenzen für den ständigen Energie- bzw. Informationsdurchfluss offen sein, anderseits müssen sie die für das System zerstörerische Entropie draußen halten. Das mit der „biologischen Phase” beginnende Leben zeigt dann durch die vielfältige Grenzziehung einen immer mittelbareren und konzentrierteren Informationsaustausch. „Der genetische Code stellt in diesem Sinne eine enorme Informationskompression dar.“94
Schon früh statten Zellen ihre Grenze mit Chemorezeptoren aus, um Nahrung, Feinde oder Gefahren entdecken zu können. In differenzierten Vielzellensystemen bildet sich später eine zweite Grenzfläche zwischen Individuum und Umgebung, eine Grenzfläche höherer Ordnung in der Hierarchie des Lebens. Die Systeme wachsen, Organismen entstehen. Im weiteren Verlauf entwickeln sich im Rahmen der kulturellen Evolution überindividuelle Systeme, Stämme, Völker und Vielvölkersysteme. Wir verstehen, dass die ein Individuum charakterisierende Begrenzung ein grundlegendes Existenzprinzip lebender Systeme darstellt, ganz gleich, ob es sich nun um eine Zelle, einen Organismus oder ein kulturelles System handelt.95
Lebendige Gestalten mit ihrem hochkomplexen Bindungsgeflecht wachsen raumgreifend oder raumkontrollierend durch immer neue Grenzziehung, die nicht nur Bestehendes sichert, sondern auch Zukünftiges möglich macht. Da es keine abgeschlossenen Systeme bzw. keine absoluten Grenzen gibt, ist neben der Offenheit eines lebendigen Systems seine Fähigkeit, Untaugliches auszugrenzen, das Ganze zu schützen und das schon Geschaffene zu konservieren entscheidend, und das auf allen evolutionären Stufen.
Darum ist ohne das Prinzip der Tradierung Evolution nicht möglich. Ohne das Prinzip der konservativen Bewahrung stünde die Natur vor der unlösbaren Aufgabe, alle unzähligen komplexen Gestalten, die das Leben aufrechterhalten, in jeder Generation neu erfinden zu müssen. G. Schramm96 hat gezeigt, dass Evolution nur möglich ist mit einem Verhältnis von hunderttausend Vermehrungs- bzw. Stabilitäts- Prozessen zu einer Mutation (Variabilitäts-Ereignis). „Erst diese stark asymmetrische, die Priorität der Bewahrung verdeutlichende Relation ermöglicht Höherentwicklung; erst das Durchhalten einer raum-zeitlichen Identität über lange Perioden erweist ein Gebilde als Biosystem.“97 Natur und Mensch leben in der Spannung zwischen Stabilität und Variabilität, Bewahrung und Sprung, und schließlich Kontinuität und Diskontinuität. Eine Erhöhung der Stabilitäts-Prozesse ohne gleichzeitige Steigerung der verändernden Mutationsrate würde die Entwicklung bremsen, was eine Erstarrung der Gestalten zur Folge hätte; eine Vermehrung der Mutationsraten würde sie immer instabiler machen und Gestalten zerbrechen lassen. Damit verlöre das System seine Offenheit, „denn partielle Geschlossenheit als Ausdruck der Lebensbewahrung ist Voraussetzung für Offenheit und aufsteigende Entwicklung.“98
Das Dilemma von Tradition und Fortschritt bietet das Musterbeispiel eines komplementären Begriffspaares, dessen Elemente sich gegenseitig auszuschließen scheinen. Doch kann die Natur uns lehren, dass konservatives Beharrungsvermögen und das Wagnis der Einführung neuer, noch von keiner Erfahrung geprüfter Möglichkeit (Risiko), so unerbittlich beide Strategien einander sich in der logischen Dimension auch ausschließen mögen, in der Realität doch zusammen wirken müssen, wenn das Leben erhalten bleiben soll (H. v. Ditfurth).
Die Offenheit braucht das System – soviel ist klar geworden – um seine hochkomplexe Ordnung durch den ständigen Energiedurchfluss (Energiedissipation) aus der Umgebung aufrechterhalten zu können. Darum entwickeln sich dissipative Systeme – ähnlich wie stehende Wellen – aus der Überlagerung von Materietransport und synchronisierter, periodischer Umwandlung und sind als solche nicht in additiver Weise aus Unterstrukturen zusammensetzbar. Darum sind lebende Systeme sehr verletzliche Nichtgleichgewichtssysteme, die wegen ihrer Abhängigkeit von Nebenbedingungen nicht unbeschränkt kombiniert bzw. überlagert werden können. Während ein Kristall als Gleichgewichtssystem unbegrenzt weiterwächst, wenn es in eine geeignete Lösung gelegt wird, beschränkt sich ein dissipatives Nichtgleichgewichtssystem selbst und behält die eigene charakteristische Form auch unabhängig von der „nährenden“ Umgebung.
Ganz wesentlich ist auch die Tatsache, dass der Kern natürlicher Ordnung in der Identität von Form und Inhalt oder Form und Funktion liegt. Die Einheit von Form und Inhalt charakterisiert alle natürlichen Systeme.99 Das bedeutet, dass die Funktion einer Struktur in ihrem raum-zeitlichen Aufbau begründet ist. Je komplexer die Struktur, desto differenzierter ihre Funktion. Denn alle natürlichen, hoch geordneten Strukturen, das gilt nicht nur für die DNA, besitzen über den syntaktischen Aspekt hinaus eine semantische Bedeutung, sie enthalten Wissen, Information. Hier liegt in der Anordnung, in der Gestalt, in der Form, die Information. Dass Ordnung letztlich Energie bedeutet, hat Otto Meyerhof (1884-1951) schon 1916 gesehen.100
Die Komplexität dieser Ordnung, die lebende Organismen so einzigartig macht, hat ihre Wurzeln in der ungeheuren Informationskapazität biologischer Makromoleküle. Wie schon erwähnt, ist der DNA - Faden des Erbgutes, der in jeder Körperzelle im Zellkern enthalten ist und weitervererbt wird, aus vier Bausteinen (Nukleotiden) zusammengesetzt (A, C, T, G). Der Mensch besitzt mehrere Milliarden Nukleotide. Der „Text“ eines Gens besteht aus der definierten Folge dieser vier Bausteine. Hier liegt die Information also nicht nur in der bloßen „Länge“ der Erbmoleküle, in ihrer Syntax, gegeben durch die Anzahl ihrer Nukleotide, sondern vielmehr in deren Semantik, die sich gerade in der spezifischen Abfolge der Bausteine zeigt. Die Zahl der Möglichkeiten, die Nukleotide in einer Nukleinsäure gegebener Kettenlänge anordnen zu können, ist offenbar ein Maß für den strukturellen und funktionellen Reichtum, mit dem sich komplexe Molekülsysteme aufbauen lassen.
Gene üben ihre fundamentale Rolle dadurch aus, dass sie die Herstellung von Proteinen kontrollieren, die für sämtliche Stoffwechselprozesse eines Organismus verantwortlich sind. In ihrer Eigenschaft als beispielsweise Botenstoffe oder Hormone besorgen sie den wesentlichen Teil aller biologischen Abläufe des lebendigen Systems. Die Regulation der Genaktivität erfolgt dabei nicht autonom, das heißt, sie wird nicht allein vom Gen bestimmt, sondern hängt von Signalen ab, die aus dem lebendigen System selbst, aber auch aus der Umwelt kommen können. Auch hier wird die Offenheit des Systems deutlich.
Weil das Prinzip der Hierarchie alles Leben prägt, taucht dieser Begriff immer wieder auf. Lebende Systeme zeigen darum immer eine vielschichtige hierarchische Ordnung. In ihnen schließt jede Ebene alle niedrigeren Ebenen in sich ein: Es bestehen also Systeme innerhalb von umfassenderen Systemen und so fort bis zum Gesamtsystem. Hierarchisch sind Bau und Funktion des Systems, die Systemkontrolle mit ihren Normen, Sollwerten, Bezugs- und Führungsgrößen.101 Überhaupt ist Komplexität ohne dieses Prinzip nicht möglich. Folglich führt auch Evolution zur Differenzierung vielschichtiger hierarchischer Systeme durch Überlagerung und Überformung der Muster.102
Wir wollen noch den Begriff der Selbstorganisationsfähigkeit lebender Systeme erwähnen, der aus ihrer Offenheit und Dissipation erwächst und letztlich nur das betont, was wir schon besprochen haben. Lebende Systeme sind autopoetisch, ihre Funktion ist darauf ausgerichtet, sich selbst zu erneuern, so wie sich eine biologische Zelle ständig im Wechselspiel von anabolischen (aufbauenden) und katabolischen (abbauenden) Reaktionsketten erneuert und nicht über längere Zeit aus den gleichen Molekülen besteht. Im Gegensatz zu einem starren allopoetischen System beispielsweise einer Maschine, die letztlich von außen gesteuert wird, ist ein autopoetisches System selbstreferentiell. Selbstorganisation wird damit zum Schlüsselwort für das Verständnis des Lebens. Frühere Begriffe wie „vis vitalis“ oder „göttlicher Odem“ spiegeln die Faszination wider, die diese Lebenskraft ausübt. Selbstorganisation ermöglicht es lebendigen Systemen, sich zu reorganisieren, weiterzuentwickeln und sich so auf unvorhergesehene Umwelteinflüsse einstellen zu können. Diese Flexibilität ist entscheidend und umso größer, je ausgeprägter der Selbstorganisationskreislauf dieses Systems ist, der seine Umwelt einschließt.
Für ein lebendes System gilt auch das Primat des Ganzen. Das bedeutet, dass es immer seine äußerste Grenze verteidigt und alles, was darin eingebunden ist.103 Denn das ganze System muss als Einheit erhalten bleiben. Ein Lebewesen tritt als Individuum auf und bewahrt auch immer seine Autonomie gegenüber der Umwelt.104
Die durch Bindung und Grenze, Selbstorganisation und Primat des Ganzen entstehenden autonomen Einheiten können sich unter einem übergeordneten, einenden Prinzip auch zu größeren Einheiten zusammenschließen, die sich dann wieder gegen andere komplexere Einheiten abgrenzen.
Von kardinaler Bedeutung ist schließlich, dass lebendige Ordnung immer werten muss. Damit wird die jedem lebendigen System innewohnende Norm zu einer zentralen Größe, weil sie diesen verletzlichen Gebilden lebenserhaltende Orientierung gibt. Die Grundlagen dazu hat uns der „Zweite Hauptsatz der Thermodynamik“ geliefert, der alles Leben zwingt, sich zu entscheiden und nur die ihm taugliche Ordnung aufzunehmen und Untaugliches auszugrenzen. Darum wird jedes lebende System von einem „Soll“ beherrscht, welches eine ständige, rückkoppelnde Korrektur aller Abläufe verlangt. Weil jedes lebende System in der Lage ist, diese Korrektur selbst vorzunehmen, sprechen wir von Autokorrektur. Die Rückkopplung an dieses optimale, weil lebenssichernde „Soll“ nennt Norbert Wiener (1894-1964), der Vater der Kybernetik, darum auch das „Geheimnis des Lebens“.105 „Im Regelkreis sehen wir eine fundamentale Lebens- und Seins-Struktur. Als rückgekoppeltes und rückkoppelndes System reflektiert das Leben endlos über Sein und Sollen. Sein Handeln resultiert aus dem „Nachdenken“ über die Größe der Spannung zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll. Was Wunder, dass diese Spannung, die „inadaequatio rei et intellectus“, auch die Quelle unserer Denkbewegungen ist.“106 Und „da, wo die Spannung zwischen Sein und Sollen ausgeregelt ist, ist nichts als Tod.“107 „Das Bild des Regelkreises, das alles Lebendige durchzieht, verdeutlicht uns, dass das viel geschmähte „Du sollst“ keine Erfindung listiger Theologen, sondern eine jener Größen ist, ohne die kein in Regelkreisen strukturiertes System Bestand hat.“108
Der Erhalt des Ganzen verlangt nun nicht nur, den Informationsbestand des Organismus zu sichern, sondern – auch das lehrt uns der „Zweite Hauptsatz der Thermodynamik“ – ihn durch innersystemische Weiterdifferenzierung und Bildung größerer Systeme zu vermehren. Leben ist differenziertes, maßvolles Wachsen in all seinen Facetten. So schafft Evolution autonome, miteinander in Wechselwirkung tretende Einheiten und damit Vielfalt und Differenzen. Sie bilden nicht nur die Grundlage von Systemen, sondern sie treiben die Entwicklung auch voran, als Ungleichgewicht und Fluktuation auch innerhalb des Systems. Denn nur auf diese Weise kann der Austausch mit der Umwelt aufrechterhalten werden. Nichtgleichgewicht ist demnach eine unversiegbare Quelle für neue dynamische Zustände, für neue Organisationen, für höhere Komplexität. Offenheit und Differenzen erzwingen Evolution. Im Gleichgewicht dagegen kommen die Prozesse zum Stillstand und Stillstand bedeutet Tod.
Wir dürfen das Wichtigste zusammenfassen: In jedem Organismus laufen fortgesetzt Prozesse ab, die dazu beitragen, die Ordnung abzubauen. Nachdem aber Leben die Erhaltung dieser Ordnung verlangt, muss der Organismus ständig von einem Strom an Ordnung bzw. Information durchflossen werden und an einen Entropie-Abfluss angeschlossen sein. Wie differenziert ein Individuum auch sein mag, letztlich wird es von der Struktur des Sonnenlichtes gespeist, während der Abfluss der Biosphäre in der Kälte des Weltraums liegt, an den nach Tod und Auflösung wieder alles verloren geht. „Während der Lebensprozesse aber zeigt sich ein Stau an Energie bzw. Information, der die thermische Energie des äquivalenten Äqulilibrium-Zustandes (des Todes) weit übertrifft; sie nimmt Formen an, die wir als Leistung, als funktionelle oder als strukturelle Ordnung, als Leben, bezeichnen. Ordnung ist thermodynamisch gewissermaßen die Spannung zwischen Speicherung und wahlloser Verteilung einer Energie, zwischen unwahrscheinlicher Balancierung und maximaler Mischung von Bauteilen.“109
Von entscheidender Bedeutung dabei ist der Schlüsselbegriff der Weiter- bzw. Höherdifferenzierung, die der „Zweite Hauptsatz der Thermodynamik“ erzwingt, um die wachsende Entropie in Schach halten zu können. Angesichts immer begrenzter Ressourcen stellt diese Leistung einen höchst konstruktiven Prozess dar, der mit Neustrukturierung, mit neuer Kompartimentierung bzw. Grenzziehung einhergeht. Denn Höherdifferenzierung setzt ökonomisches Haushalten voraus, eine Leistung, die Disziplin des Systems erfordert. Nicht zu unterschätzen ist dabei der Widerstand, der Wachstum auslöst. Not, Enge und Knappheit bilden dabei den Anreiz für die Optimierung der ökonomischen Situation auf allen Stufen des evolutionären Geschehens. Dies gilt für alle lebendigen, also alle biologischen, sozialen und soziokulturellen Systeme, weil sich die systembildende Ordnung des Lebens auch auf kultureller Ebene fortsetzt.110
Im nächsten Kapitel werden wir diese Fakten mit Hilfe des Informationsbegriffes erklären und zeigen, wie sich das für den Menschen so wichtige Gesetz, seine Norm, auf kultureller Ebene herausbildet.
87 Dürr, H.- P. 1989, 43
88 Dürr, H.- P. 1989, 43
89 Popper, K. 1965, 207, 233
90 Jantsch, E. 1979, 51; Fong, P. 1973, 93-106
91 Dürr, H.-P. 1989, 41
92 Jantsch, E. 1979, 51
93 Ebeling, W.; Freund, J.; Schweitzer, F. 1998, 48
94 Ebeling, W.; Freund, J.; Schweitzer, F. 1998, 48, 49
95 Ebeling, W.; Freund, J.; Schweitzer, F. 1998, 48
96 Schramm, G. 1965, 33-36
97 Schramm, G. 1965, 33-36
98 Schramm, G. 1965, 33-36
99 Jantsch, E. 1979, 75
100 Riedl, R. 1990, 62, 63
101 Schriefers, H. 1982, 190
102 Riedl, R. 1990, 188
103 Lorenz, K. 1992, 210; Piaget, J. 1996, 94
104 Jantsch, E. 1979, 74
105 vgl. Beck, H. 1972
106 Schriefers, H. 1982, 73
107 Beck H. W. 1972
108 Schriefers, H. 1982, 74
109 vgl. Riedl, R. 1990
110 Weizsäcker, E. v. 1974, 10