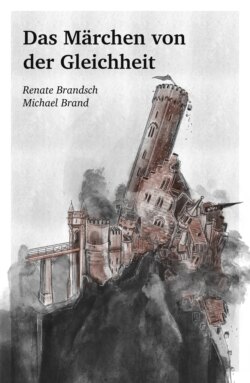Читать книгу Das Märchen von der Gleichheit - Michael Brand - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSprache
Sprache scheint viel älter zu sein als ursprünglich gedacht. Neuere Forschungen lassen vermuten, dass es sie schon vor 1,8 Millionen Jahren gegeben hat, bei Wesen „irgendwo zwischen Australopithecus und Homo ergaster“,203 wobei die Übergänge von einer Tierkommunikation zu einer immer genaueren und differenzierteren Sprache fließend gewesen sein müssen.204 Dagegen ist es fast sicher, dass die Menschen vor 600 000 Jahren miteinander gesprochen haben (Homo heidelbergensis).205 Das gleichzeitig zu beobachtende Gehirnwachstum, nicht nur für die Willkürkontrolle der Stimmbänder, Lippen, Zunge und Atemmuskeln verantwortlich, sondern auch für die Feinmotorik der Hände, weist auf ein immer komplexeres Sozialleben hin.206
Die sprachliche Entwicklung von einer Protosprache hin zu einer grammatikalisch strukturierten Kommunikation erfährt dann vor ungefähr hunderttausend Jahren eine Beschleunigung (Homo sapiens, Homo neanderthalensis). Plötzlich beginnt der Mensch raffiniertere Werkzeuge zu bauen, Schmuck herzustellen, Handel zu treiben und eine Syntax (Satzbau) zu kreieren, die es ihm erlaubt, auch kompliziertere Handlungsmuster zu planen. Wie schon erwähnt, muss man annehmen, dass auch die Entstehung der Sprache Folge einer Not gewesen ist, eines In-die-Engegetrieben-Seins, das jeder emergenten Entwicklung zugrunde liegt. Klimatische Veränderungen mit Nahrungsmittelknappheit, neue Jagdtechniken, größer werdende Sippen und Stämme verlangen nach einer immer differenzierteren Kommunikation, die über die Verständigung durch Laute, Mimik und Gestik hinausgeht.207 Denn mehr noch als Menschenaffen sind wir Menschen auf soziale Kooperation und Kommunikation angewiesen. Diese Besonderheit kann ein Selektionsdruck für die Entwicklung von Sprache gewesen sein.208
1772 erscheint Herders (1744-1803) Aufsatz „Über den Ursprung der Sprache“. Heute wissen wir, dass der Ursprung der Sprache genaugenommen nicht an den Wurzeln der Menschheit liegt, sondern letztlich die Informationstransformation fortsetzt, die alles Leben bestimmt. 209Sprache und ihre Speicherform, die Schrift, müssen als wesentliche, die kulturelle Welt strukturierende, bindende Kraft angesehen werden.
Sprache lebt in viel größerem Ausmaß als die Schrift von ihrem Träger, dem menschlichen Körper. Das, was mitgeteilt werden soll, wird durch Stimme und sozial eingeübte Haltungen, Gesten und Gebärden reicher und komplexer. Nichtsdestotrotz geht bei der sprachlichen Vermittlung viel Information verloren. Das hat man auch schon früh gesehen. Überhaupt hat der Informationsstrom beim Menschen verschiedene Hürden zu nehmen. Darauf müssen wir kurz eingehen.
Die erste Schwierigkeit behandelt die Erkenntnistheorie, die allerdings erst in der Neuzeit zum zentralen Problem der Philosophie wird. Kann der Mensch die Welt überhaupt erkennen, wie sie ist? Schon die „Physiologoi“ unter den frühen Philosophen bezweifeln, dass das, was sich den Augen offenkundig zeigt, wahr sei. Damit beginnt die Entfremdung des Menschen von der Natur. Nach I. Kant (1724 -1804) bleibt ihm das „Ding an sich“ endgültig verborgen, obwohl die Erkennbarkeit der Natur ursprünglich kein Problem gewesen ist. Denn wir haben gesehen, dass die aus der Natur aufgenommene Information, auch wenn sie immer nur einen kleinen Teil der möglichen ganzen Information ausmacht, als pragmatische Information für unser Überleben ausreicht.
Die nächste Schwierigkeit liegt in der adäquaten Umformung des Gedachten bzw. Empfundenen: es muss formuliert, ausgesprochen und/oder niedergeschrieben werden. Diese Umwandlung ist durch den beim Menschen entkoppelten Reiz-Reaktion-Reflex nicht immer gegeben. Unfähigkeit, den Gedanken symbolisch auszudrücken, Schweigen aus anderen Gründen, aber auch bewusste Lüge sind möglich, obwohl die natürlichen Komponenten des menschlichen Ausdrucks (Stimme, Augen, Mimik, Gestik) noch am verlässlichsten die Realität widerspiegeln.
Durch die symbolische Formulierung des Gedachten geht der vielleicht größte Teil der Information verloren. Schon der griechische Philosoph Demokrit (um 460 v. Chr.) hat die Rede den bloßen „Schatten der Wirklichkeit“210 genannt. Auch der Schriftsteller Hermann Hesse (1877- 1962) hat das in seinem Essay „Sprache“ sehr deutlich gesagt: „Wenn also der ein Schelm ist, der mehr gibt, als er hat, so kann ein Dichter niemals ein Schelm sein. Er gibt ja kein Zehntel, kein Hundertstel von dem, was er geben möchte, er ist ja zufrieden, wenn der Hörer ihn so ganz obenhin, so ganz von ferne, so ganz beiläufig versteht, ihn wenigstens im Wichtigsten nicht gröblich missversteht. Mehr erreicht er selten. Und überall, wo man ihn liebt oder ihn verwirft, überall spricht man nicht von seinen Gedanken und Träumen selbst, sondern nur von dem Hundertstel, das durch den engen Kanal der Sprache und den nicht weiteren des Leserverständnisses dringen konnte.“211
Denn auch das Verstehen des Gesagten, in noch viel größerem Ausmaß des Geschriebenen, stellt ein weiteres und entscheidendes Nadelöhr für den verbliebenen Informationsfluss dar, weil eigentlich der Empfänger bestimmt, was an Information bei ihm ankommt. Hören, Verständnisfähigkeit, Vorwissen, Motivation usw. spielen eine Rolle.
All diese Schwierigkeiten beginnen dem Menschen vor über 2500 Jahren bewusst zu werden, sie erschüttern die alte archaische Welt. Darum erfährt die geschichtliche Entwicklung hier einen Einschnitt.
Die Frage, inwieweit Sprache die Realität widerspiegeln kann, hat schon Hesiod (um 700 v. Chr.) gestellt. Er weiß um die Lüge und betont, dass er wahre Geschichten erzählen will. Er verlangt das auch von den Menschen. Denn im Gegensatz zu den gesprochenen Worten der frühen mythischen Zeit, erfüllt die Rede seiner Epoche diesen Anspruch nicht mehr.212 Denn „schon die Namen selbst bilden die Dinge nicht mehr sachgerecht und eindeutig ab.“213 Man beginnt nach der Wahrheit zu suchen und verlässt sich nicht mehr auf ihre einfache göttliche Mitteilung.214
Platon (427-347 v. Chr.) denkt in seinem „Kratylos“, dem ersten zusammenhängend überlieferten sprachphilosophischen Text der griechischen Literatur, über den „archaischen Sprachbegriff“ nach, der das Sprechen noch als Benennen verstanden hat. Das Ergebnis des Dialogs fasst er in einem Satz zusammen: „Gewiss aber wird es einem vernünftigen Menschen gar nicht wohl anstehen, sich selbst und seine Seele den Wörtern in Pflege zu geben.“215 Auch Parmenides (540-480 v. Chr.) spricht einige Jahrzehnte vorher vom „trügerischen Schmuck der Worte“.216 „Damit ist die Trennung von Sprechen und Erkennen (Sprechen und Denken) für die Antike endgültig vollzogen. Dem folgt alsbald die entsprechende Trennung von Wort und Wahrheit.“217
Seitdem setzt man Worte losgelöst von ihrem Wahrheitsgehalt ein als „Werkzeuge der Überredung und allgemein als Mittel, auf andere Menschen einzuwirken“ (Rhetorik).218
Sprachskepsis finden wir auch später immer wieder. Der Kleriker Hrabanus Maurus (780-856) betont den Zeichencharakter der Sprache: man dürfe nicht „die Zeichen für die Sache nehmen“.219 Auch der englische Philosoph und Staatsmann F. Bacon (1561 - 1626), der die neuzeitliche Sprachkritik einleitet, nennt zwar die Worte der Sprache „Spuren der Vernunft“ und sieht sie als Vermittler und Überlieferer von Wissen.220 Doch „Vorurteile erzeuge die Sprache zum einen dadurch, dass die Feinheit der Natur, die die Einteilungsfähigkeit der Sinne und des Verstandes ohnehin übertreffe, durch die Worte unzureichend bezeichnet werde“. Zusätzlich erzeuge die Sprache „Erdichtungen“: einmal schaffe der Intellekt mit den Worten Bezeichnungen für nicht existente Dinge, „oder die Worte seien „verworren“ und „schlecht abgegrenzt“, „voreilig“ und „unangemessen“ von den Dingen abstrahiert.“221
Th. Hobbes (1588-1679) erkennt, dass beim Sprechen unsinnige Wortzusammenstellungen möglich sind, die den Zweck des Sprechens, eine bestimmte Bedeutung auszudrücken, gefährden.222 Und der französische Philosoph und Mathematiker R. Descartes (1596-1650) sieht in der Sprache die eigentliche Quelle von Missverständnissen. Sie kann die Verständigung erschweren und verdunkeln. Seiner Ansicht nach „würden“ „fast alle Kontroversen verschwinden, wenn die Philosophen in der Bedeutung der Worte immer übereinstimmten.“223 Dem englischen Philosophen J. Locke (1632-1704) erscheint es ebenfalls unwahrscheinlich, dass „any two men“ sich unter ein und demselben Wort das gleiche vorstellen.224
Der Universalgelehrte G. W. Leibniz (1646-1716) weiß, dass menschliche Erkenntnis Zeichen braucht, die auch das Differenzierungsvermögen des Denkens spiegeln. Doch machen Worte nur auf Dinge und Ideen aufmerksam, ohne sie jedoch hervorbringen zu können.225
Besonders deutlich wird die Zeichenwillkür der Sprache bei I. Kant (1724-1804). Denn die Sprache kann einen Begriff zwar begleiten und „nur gelegentlich reproduzieren“226, jedoch nicht „konstituieren“; weil aber das philosophische Denken Worte braucht 227, liegt hier die eigentliche „Quelle von potentiellen Missverständnissen“.228 Denn „die Bedeutung der Zeichen“ ist nur „in der Mathematik … sicher“. Außerhalb dieser wissenschaftlichen Eindeutigkeit haben „Worte ihre Bedeutung“ allein „durch den Redegebrauch“.229
F. Nietzsche (1844-1900) nimmt besonders das Wahrheitsverständnis der Sprache unter die Lupe. Er sieht in den „Conventionen der Sprache“ nichts anderes als „perspektivisch bedingte, letztlich im Dienst der Selbsterhaltung des Menschen stehende Formen der Realitätsverfälschung, d.h. „Conventionen zu lügen“. Denn die Sprache kommuniziert Begriffe nicht nur, sondern schafft sie auch; so geschieht Begriffsbildung in ihr durch metaphorische Übertragungsprozesse, „willkürliche Abgrenzungen“ von Dingen gegeneinander oder „einseitige Bevorzugung bald der bald jener Eigenschaften eines Dinges“.230
Den Abgrund zwischen Sprache und Wirklichkeit erkennen auch Ludwig Feuerbach (1804-1872) und Karl Marx (1818-1883). Überhaupt steht noch das Fin de siècle, das Ende des 19. Jahrhunderts, der Sprache ausgesprochen skeptisch gegenüber.231
Auch Heidegger (1889-1976) sieht sehr wohl, dass Sprache zum „Gerede“232 verkommen kann, dass sie damit „den primären Seinsbezug zum beredten Seienden verloren“ hat. Auf „dem Wege des Weiter- und Nachredens“ nimmt sie unkritisch die „durchschnittliche Verständlichkeit“ wieder auf, die in der „gesprochenen Sprache schon liegt“ und mit ihr überliefert wird, und in ihrer „Bodenlosigkeit“ stellt sie so „die Möglichkeit“ dar, „alles zu verstehen ohne vorgängige Zueignung der Sache“.233
Es soll nochmals betont werden, dass die Kluft zwischen Realität und ihrer sprachlichen Wiedergabe genau genommen folgende Ursache hat: Ein Zeichen ist zu einfach, als dass es Komplexität vollständig übersetzen könnte. Dies gilt für alle Sprachen, auch wenn diese sich in ihrer Differenziertheit unterscheiden. So kann ein Zeichensystem der natürlichen lebendigen Ordnung seines Benutzers umso flexibler folgen, je differenzierter es ist. Darum legt G. W. Leibniz auf den „Reichtum“ der Sprache als „das erste und nötigste“234 größten Wert. Dieser Reichtum hat an Übersetzungen in andere Sprachen seinen „Probierstein“.235 Überhaupt zeigt sich beim Übersetzen am deutlichsten, wie sehr Sprache das Denken beengt.236
Sprache lebt von ihrem Träger und seinem Körper. Augenausdruck, Mimik, Gestik, Stimme, Haltung, Bewegung tragen zum verlässlichen Verständnis des gesprochenen Wortes bei. Gehen jedoch Direktheit und Nähe der Gesprächspartner verloren, kann sie symbolisch nicht vollständig kompensiert werden.
Sprache ist kein Werk, sondern eine Tätigkeit; in ihr spiegelt sich die ewig wiederholende Arbeit des Geistes, den artikulierten Laut zum tauglichen Ausdruck des Gedankens zu machen. Die eigentliche Sprache liegt in der Rede. Ihre Erhaltung durch die Schrift wird immer eine unvollständige, mumienartige Aufbewahrung bleiben: denn durch Schrift geht zusätzlich Information verloren. Darum hat man auch zu allen Zeiten Kritik an der Schrift geübt.
203 Berger, R. 2008,250, 252
204 Berger, R. 2008, 250
205 Berger, R. 2008,251, 266
206 Berger, R. 2008, 253
207 Berger, R. 2008, 243-245, 266
208 Berger, R. 2008, 243
209 Schriefers, H. 1982, 118
210 vgl. Demokrit: VS 68 B 145
211 Bender, E. 1966/1967, 19
212 vgl. Hesiod: Erga 173-200
213 vgl. Hesiod: Erga 11-26
214 Ritter, J.; Gründer, K. Bd. 9 1995, 1440
215 Platon: Crat. 440 c 3ff
216 Parmenides, VS 28, B 8, 52
217 Ritter, J.; Gründer, K.; Bd.9 1995, 1441
218 Ritter, J.; Gründer, K.; Bd.9 1995, 1443
219 vgl. Hrabanus Maurus: De inst. III, c. 7-15
220 vgl. Bacon, F.: Instauratio magna, De dignitate er augmentis scient. VI, c. 1 (1623)
221 vgl. Bacon, F.: Instauratio magna, Novum org. I Aph.10, 13; 59, 171; 60, 171
222 Hobbes, Th.: Elem. philos. I: De corpore (1655) I
223 Descartes, R.: Reg. ad dir. Ingenii 13 (1628/29)
224 Locke, J.: An essay conc. human underst. III, ch. 10, §22 (1690), 283
225 Leibniz, G. W.: Unvorgreiffliche gedancken, betr. die ausübung und verbesserung der teutschen sprache (ca. 1697) §1
226 Kant, I.: Anthropol. in pragmat. Hinsicht (1798). Akad.-A. 8, 80, 79
227 Kant, I. KrV A 735
228 Ritter, J.; Gründer, K. Bd.9 1995, 1483
229 Kant, I: Unters. über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und der Moral (1764)
230 Nietzsche, F.: Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne 1 (1873), 372, 373, 375
231 Ritter, J.; Gründer, K. Bd.9 1995, 1488
232 Heidegger, M.: Sein und Zeit § 34 1976, 219
233 Heidegger, M.: Sein und Zeit § 35 1976, 224, 223
234 vgl. Leibniz, G. W.: Unvorgreiffliche gedancken betr. die ausübung und verbesserung der teutschen sprache (ca. 1697) § 57
235 Leibniz, G. W.: Unvorgreiffliche gedancken betr. die ausübung und verbesserung der teutschen sprache (ca. 1697) § 60, 470
236 Leibniz, G. W.: Unvorgreiffliche gedancken betr. die ausübung und verbesserung der teutschen sprache (ca. 1697) § 15, 454