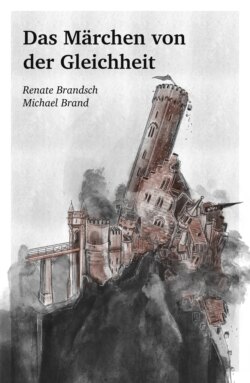Читать книгу Das Märchen von der Gleichheit - Michael Brand - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIn welcher Situation befinden wir uns heute?
Krisen, Krankheiten und Katastrophen, die das Leben auf diesem Planeten bedrohen, hat es immer gegeben, solange die Erde besteht. Doch im Gegensatz zu früheren Zeiten haben wir es nun mit menschengemachten, ständig zunehmenden und die gesamte Biosphäre erfassenden Schwierigkeiten zu tun. Von entscheidender Bedeutung ist, dass es kein Draußen mehr gibt, keinen Zufluchtsort mit regenerativem Potential. Alle wesentlichen Probleme sind Weltprobleme, die Situation, eine Situation der Menschheit.
Heute stehen Finanzkrisen und Migrationsströme im Vordergrund. Letztlich sind beide Phänomene Ausdruck einer gigantischen Leistungsvernichtung und lebensfeindlichen Entwicklung. Wir werden verstehen, warum das so ist.
Doch abgesehen davon bleibt das Bevölkerungswachstum bei knappen Ressourcen und zunehmender Belastung der Natur zentrale Bedrohung.
Dem neuen Phänomen der Globalisierung steht der Mensch ebenfalls ratlos gegenüber. Die rasante Entwicklung der Informationstechnologie und die Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen über die Grenzen der Einzelstaaten hinweg werden irrtümlicherweise als ein Zusammenwachsen der Länder zu einem einzigen weltweiten politischen System gedeutet. Doch das würde die Integrität der Einzelstaaten voraussetzen, deren Bedeutung zunehmend verloren geht. Denn globale Märkte funktionieren nach der „gewinnmaximierenden Logik privater, transnational und global operierender Akteure“ und schwächen „nationalstaatlich begrenzte, am Gemeinschaftsinteresse ausgerichtete Politik von Regierungen“,1 deren Handlungsspielraum territorial beschränkt bleibt. Weil Privatwirtschaft in großem Stil global agieren und Ressourcen einem Staat entziehen kann, kommt es zum Standortwettbewerb zwischen Staaten, was dazu führt, dass „falsche reglementierende Politik mit dem Abzug von Ressourcen bestraft wird und binnenorientiert-interventionistische Politik in eine Krise gerät.“2
Nationale Defizite können niemals durch eine „Weltregierung“ adäquat kompensiert werden. Unternehmen, Banken oder private Anleger, auch wenn sie transnational agieren, können den Staat nicht ersetzen. Denn Staaten bleiben die einzigen Instanzen, die kulturelle Identität sichern. Denn sie verfolgen ein – wie auch immer definiertes – Gemeinwohl ihrer Bürger, sie erlassen Gesetze und sorgen für deren Einhaltung und schaffen so die gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für privates Wirtschaften. Eine mögliche „Global Governance,“ deren Legitimation nicht auf dem Zusammenschluss autonomer Einzelstaaten beruht, sondern als Konsequenz aus deren Auflösung entsteht, birgt die Gefahr der Einflussnahme von Partikularinteressen in sich. Sie wird auch mit nicht zu bewältigenden Schwierigkeiten konfrontiert werden, denen man mit schärfster Überwachung und Beschneidung der individuellen Freiheit durch wie auch immer geartete Kontrollinstanzen begegnen wird.
Ein weiteres Problem liegt im Rückgang der Vielfalt. Angesichts der Tatsache, dass sie das Charakteristikum unserer Biosphäre darstellt, muss ihr anthropogen bedingter Verlust auf breiter Front alarmieren: es sterben Arten, Völker und Sprachen.3
Doch ohne Vielfalt kein Leben, wir finden sie schon auf molekularer Ebene. Hier ist sie verantwortlich für die Speicherung und Weitergabe der Erbinformation durch beispielsweise katalytisch aktive oder strukturbildende Proteine. Ohne Vielfalt gäbe es auch keine Evolution, denn Selektion kann nur dort auswählen, wo Variabilität existiert. Das führt dazu, dass sich die anpassungsfähigeren Systeme erfolgreicher fortpflanzen als die weniger flexiblen, und sich auf Kosten dieser weiter ausbreiten können.4
Die normale Artaussterberate der geschätzten hundert Millionen heute auf der Erde lebenden Arten (uns bekannt sind nicht einmal zwei Millionen)5 liegt im Durchschnitt bei etwa zwei Arten pro Jahr, die dann durch neue ersetzt werden. Doch sterben heute schon über zehn Arten pro Stunde endgültig aus. Ihnen folgen keine neuen nach. Die Welt-Naturschutz-Organisation (World Conservation Union WCU) schätzt den täglichen Verlust auf siebzig bis dreihundert Arten weltweit. Man nimmt an, dass in den nächsten fünfzig Jahren zehn bis fünfzig Prozent aller Tier- und Pflanzenarten von der Erde verschwunden sein werden6 (zu den Ursachen s. Anhang).
Als gleichermaßen alarmierend muss der Verlust kultureller Vielfalt gesehen werden. Zwar hat es Genozid (Völkermord) und Ethnozid (Kulturzerstörung) in der Menschheitsgeschichte immer gegeben, doch nicht in dieser Geschwindigkeit und in dem globalen Ausmaß wie heute. Mit ihrem Lebensraum verlieren beispielsweise viele Naturvölker bzw. Wildbeuter ihre Lebensgrundlage: Pygmäen, Buschmänner, Tasmanier, Samen, Indianer, Ik, Eipo und andere. Diese Gemeinschaften, die zum Teil noch bis in die Gegenwart hinein Jäger und Sammler und in ihrem natürlichen Raum verwurzelt gewesen sind, können ihre kulturelle Identität nicht hinüberretten in eine anonyme technisierte Massengesellschaft. Auch die sogenannte zivilisierte Welt wird im Rahmen ihrer multikulturellen Entwicklung immer uniformer. Denn letztlich sind alle Völker von dieser Entwicklung betroffen.
Worin besteht nun der Wert der biologischen Vielfalt, warum wird ihr Verlust für den Menschen zur existentiellen Bedrohung? Der vordergründige ökonomische Nutzen der Biodiversität soll hier der Vollständigkeit halber erwähnt werden, obwohl er angesichts der anderen Gefahr verblasst. Man schätzt, dass der Mensch täglich an die vierzigtausend andere Spezies direkt oder meist indirekt (Mikroben, Pilze, Pflanzen, Tiere) nutzt.7 Zahlreiche Pflanzen- und Tierarten sind für die Ernährung der Weltbevölkerung unverzichtbar. Die Artenvielfalt von Nutzpflanzen ist wichtig, weil landwirtschaftlich verwendete Sorten durch Einkreuzen verbessert werden können. Denn Monokulturen und eine standardisierte Landwirtschaft sind anfälliger für Krankheiten und weniger resistent gegen den Befall von Insekten und Würmern.8 Tierische und pflanzliche Genspeicher sind auch eine wesentliche Quelle zur Herstellung von Arzneimitteln. Ungefähr fünfundzwanzig Prozent aller in Europa und den USA verschreibungspflichtigen Medikamente enthalten pflanzliche Wirkstoffe. Unabhängig davon können Tiere und Pflanzen als Vorbild für technische Entwicklungen dienen (Bioengineering).9
Doch weit wesentlicher als dieser unmittelbare ökonomische Verlust ist die Tatsache, dass mit jeder Art, die unwiederbringlich verloren geht, das gesamte Ökosystem destabilisiert wird, da jeder Spezies eine stützende Funktion im Ganzen zukommt. Stirbt sie schneller aus, als sie es normalerweise tut, hat dies Konsequenzen nicht nur für unzählige andere Arten, die von ihr abhängen, sondern auch für die Biosphäre insgesamt.10 Denn wir sollten uns bewusst machen, dass es innerhalb dieses komplex vernetzten Systems keine Sieger geben kann; viel zu groß sind die gegenseitigen Abhängigkeiten. Es muss im Interesse eines jeden Subsystems, auch des Menschen liegen, das Gleichgewicht des Ganzen zu erhalten. Gerät es ins Wanken, ist nicht nur der Mensch gefährdet, sondern das Leben auf diesem Planeten überhaupt.
Evolution – im weitesten Sinne als Entwicklung, Veränderung verstanden – ist ein Prozess der Differenzierung und damit ein Vorgang, der nicht nur Vielfalt schafft, sondern ihre Variationsbreite auch als Voraussetzung braucht. Biodiversität, als genetische Vielfalt, ist die Grundbedingung von Leben überhaupt. Erst sie ermöglicht auch jede weitere erfolgreiche Anpassung der Natur an veränderte Umweltbedingungen.11 „Mit einer Standardisierung von Natur und Kultur versperrt sich der Mensch selbst den Weg zu existentiell notwendigen Entwicklungsmöglichkeiten.“12 Vielfalt ist die eigentliche Quelle von Veränderungen, sie ist der evolutionäre Motor schlechthin. Uniformität dagegen führt zu Stillstand, und Stillstand bedeutet Tod.
Tatsache ist, dass keine Population eine ähnliche Belastung für die Erde darstellt wie der Mensch. Durch seine zivilisatorische Evolution unterscheidet er sich von allen anderen Organismen: „Menschliche Lebensgemeinschaften, gleich welcher Kultur-, Zivilisations- oder Wirtschaftsstufe, bewirken, im Vergleich zu anderen Organismen und auf ihre Biomasse bezogen, die nachhaltigsten Reliefveränderungen, die höchsten Materialverlagerungen und Stoffumsätze, die gewaltigsten Energiefreisetzungen und damit nicht zuletzt auch die heftigste Unordnung in den unseren Planeten steuernden Ordnungssystemen.“13 Der Mensch, der sich all seiner natürlichen Wachstumsfesseln entledigt hat, nimmt Besitz von der ganzen Erde bis in ihre letzten Winkel. Wie kein anderes Wesen in der Geschichte der Erde bedroht der Mensch das Leben selbst auf unserem Planeten.
All diese Vorgänge sind ohne Beispiel in der Geschichte des Menschen. Überlieferte Maßstäbe, die uns Orientierung bieten könnten, gibt es nicht. Darum stehen wir den Herausforderungen der Zukunft ohne historische Lehren ratlos gegenüber.
Was macht nun den Menschen, dieses komplexeste aller Lebewesen, so gefährlich? Was unterscheidet ihn von allen anderen Arten? Kann er sich selbst, kann er das Leben auf diesem Planeten erhalten? Was ist Leben überhaupt, und: was ist der Mensch? Diesen Fragen müssen wir uns zuwenden, wollen wir schließlich die philosophische Kardinalfrage stellen: Was soll ich tun?
Um die Entwicklung des Menschen zu verstehen, sollten wir uns zunächst auf unsere Anfänge und Fundamente besinnen. Doch es gibt ein weiteres Problem: sicheres, absolut verlässliches Wissen, das uns in dieser Lage helfen könnte, haben wir nicht. Denn spätestens seit Kant (1724-1804) befinden wir uns in einem erkenntnistheoretischen Gefängnis (s. Anhang). Darauf müssen wir kurz eingehen.
All das, worauf sich frühere Generationen haben stützen können, hat sich nämlich als windig erwiesen. Es wäre so einfach, könnten wir der Evidenz vertrauen, unseren Sinnesorganen. Zwar funktionieren sie normalerweise gut, doch liefern sie kein sicheres Wissen, denken wir nur an Sinnestäuschungen.14
„Das hat schon Einstein gesagt!“ Wir orientieren uns gerne an Autoritäten, doch auch sie sind Menschen, die sich irren können. Das gilt genauso für alle überlieferten Bücher und Schriften, die ja auch von fehlbaren Menschen verfasst worden sind, das gilt für den menschlichen Verstand überhaupt. Wie oft sagen wir: „Überleg doch mal!“, aber auch unsere Vernunft kann kein sicheres Wissen bieten.15
Die Flucht in Logik und Mathematik hilft uns ebenfalls nicht weiter. Logische Schlüsse sind in höchstem Masse sicher, doch gehen sie von unbewiesenen Annahmen aus, die nichts über die Welt aussagen müssen. Letztlich bringen sie uns nicht weiter.16
Wir berufen uns gerne auf die Erfahrung. Auch wenn die Sinneseindrücke des einzelnen Menschen nicht verlässlich sind, glaubt man, „die vieler Menschen über lange Zeiträume sammeln, wiederholen und intersubjektiv überprüfen und durch Messinstrumente und Blind- und Doppelblindversuche objektivieren zu können“. Doch kein Verfahren ist sicher. Denn es ist durchaus möglich, dass wir alle uns irren: denken wir nur an die jahrtausendelange Vorstellung der Menschheit, die Erde sei eine Scheibe.17
Wir befinden uns in einer lähmenden Lage, denn wir können nicht einmal unseren Zweifeln trauen, auch sie lassen sich nicht beweisen. Um der vollständigen Paralyse zu entgehen, sollten wir uns allerdings bewusst machen, dass die Menschheit trotz ihrer Fehlbarkeit schon eine Weile besteht und uns deshalb von diesem lebensfeindlichen und eigentlich größenwahnsinnigen Absolutheitsanspruch verabschieden. Denn, was verstehen wir eigentlich unter „Wissen“? „Wissen“ kann man als „wahre und fundierte Überzeugung“ definieren.18 Danach hat der Wissensbegriff drei Komponenten: Die subjektive Komponente zeigt sich in der „Überzeugung“, die objektive in dem „Wahrheitsbegriff“; und die sichernde in der „Fundiertheit.“19 Die Schwierigkeit liegt nun bei diesem letzten Punkt, bei der „Fundiertheit“. Doch auch wenn unsere Beschränktheit kein sicheres, beweisbares Wissen, keine absolute Wahrheit, zulässt, bleibt uns dennoch die Möglichkeit, uns um „wahres Wissen“ zu bemühen und zu versuchen, es „durch vielfache Prüfungen und Falsifizierungen immer sicherer zu gestalten.“20 Wen die schwierige Erkenntnistheorie, die heute eine so zentrale Bedeutung besitzt, interessiert, kann das Kapitel im Anhang nachlesen.
Philosophen haben zu allen Zeiten die gleichen Fragen gestellt. Dennoch unterscheiden sich ihre Antworten. Wir sind von europäischem Denken geprägt. Doch „Philosophie beruft sich eben nicht auf kulturelle Besonderheiten, sondern auf die allgemeine Menschenvernunft und allgemein menschliche Erfahrungen. Als Philosophie interessiert sie sich für grundlegende Fragen, die in allen Kulturen gestellt werden. Sie ist ihrem Wesen nach eine die ganze Menschheit verbindende Instanz.“21
Der umfassende Anspruch unseres Themas, das nicht nur alle Bereiche menschlicher Kultur berührt, sondern auch nach der Natur fragen muss, nach dem Leben überhaupt, zwingt uns, das Fundament so tief wie möglich zu legen. Dabei werden wir überliefertes und aktuelles Wissen über die Welt zu Rate ziehen.
Doch zuvor soll nicht nur deutlich werden, wieso wir Wissen über die Welt brauchen, sondern, was genau es ist, das uns an der Welt hauptsächlich interessiert.
1 Opitz, P. J. 2001, 204
2 Opitz, P. J. 2001, 209
3 vgl. Wuketits, F. M. 2003
4 Linsenmair, K. E. 2007
5 Kalko, E. K. V. 2007
6 Opitz, P. J. 2001, 143
7 Eldredge, N. 1998
8 Opitz, P. J. 2001, 145
9 Opitz, P. J. 2001, 145
10 Opitz, P. J. 2001, 145
11 Opitz, P. J. 2001, 14
12 Wuketits, F. M. 2003, 179
13 Eichler, H. 1993, 15
14 Vollmer, G. 2007, 358
15 Vollmer, G. 2007, 358
16 Vollmer, G. 2007, 358, 359
17 Vollmer, G. 2007, 359
18 Vollmer, G. 2007, 357
19 Vollmer, G. 2007, 357
20 Vollmer, G. 2007, 360
21 Höffe, O. 2006